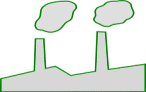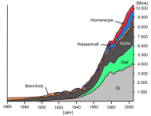Das Zeitalter der Industrie
Die Industrielle Revolution
Kohle und Kapitalismus prägen die Welt
Das Zusammentreffen von Erfindungen, die dem
ungeliebten Brennstoff Kohle neue Einsatzmöglichkeiten verschaffte
(Dampfmaschine und Verschwelung zu Kokskohle, mit der Eisen
hergestellt werden konnte) mit neuen Formen wirtschaftlichen Denkens
(“Kapitalismus”) prägten die Industrielle Revolution. Von England
aus breitete sie sich nach Westeuropa und in die Vereinigten Staaten
von Nordamerika aus; sie sollte das Leben der Menschheit nicht nur
in den Industriegesellschaften, sondern fast überall auf der Erde
ändern.

Die Kruppschen Hüttenwerke
Rheinhausen zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Seit 1880
übertraf die deutsche Industrieproduktion die englische (mehr).
Abb. aus wikipedia, Bild
Krupp Rheinhausen
Teil 1:
Kohle, Dampfmaschine und Stahl
Der Beginn der industriellen Revolution in
England
Die “Industrielle Revolution”, die in kurzer Zeit
die Lebensverhältnisse fast der gesamten Menschheit umstürzen
sollte, begann eher gemächlich: Vor allem die Nachfrage der neu
entstandenen Mittelschicht
hatte die mit Baumwolle aus den Kolonien versorgte englische
Textilindustrie zum wichtigsten Gewerbe des Landes gemacht. Die
Mechanisierung begann mit John Kays 1733 patentierten fliegenden
Weberschiffchen; damit und anderen technischen Innovationen
wie der Streichmaschine wurden Baumwollstoffe glatter und billiger.
1738 baute Lewis Paul die erste funktionsfähige Spinnmaschine, die
er und John Wyatt in ihrer 1741 eröffnete Baumwollspinnerei
einsetzten. Das Unternehmen musste zwar vier Jahre später schließen,
aber mit der 1764 von James Hargrave erfundenen "Spinning
Jenny" setzte sich die Spinnmaschine durch. 1771 baute Richard
Arkwright um eine von ihm verbesserte Spinnmaschine – die
durch Wasserkraft angetriebene "Waterframe" – herum
die erste Fabrik (eine Fabrik ist dadurch
gekennzeichnet, dass in ihr mit Hilfe von Maschinen und
unterschiedlichen Arbeitsvorgängen – also arbeitsteilig – produziert
wird). An Arkwrights Spinnmaschine konnten auch ungelernte Arbeiter
Garn spinnen. 1775 kam die noch Walzenkarde hinzu, mit der die rohen
Baumwollfasern zum Spinnen vorbereitet wurden – damit konnte der
gesamte Prozess vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt weitgehend mit
Maschinen und arbeitsteilig erledigt werden. Die (arbeitsteilige)
Produktion von Gütern in Fabriken (in der Regel mit einem hohen Grad
an Mechanisierung) wird Industrie genannt. Da
Nachfrage nach Baumwolltextilien war schon vorher groß gewesen,
aufgrund der jetzt möglichen Massenproduktion betrug der
Baumwollverbrauch im Jahr 1800 bereits das Zwölffache des Verbrauchs
von 1770.
Die Rolle dieser ersten Industrie wäre aber, da sie an Wasserkraft
gebunden war und auch diese durch alte Nutzungs- und Wasserrechte
nur eingeschränkt nutzen konnte, vermutlich sehr beschränkt
geblieben. Was sie prägen sollte, war die Dampfmaschine. Seit im
England des 13. Jahrhunderts Brennholz knapp geworden war, hatten
die Engländer in größerem Umfang angefangen, Kohle
zu verheizen. Die Kohle stammte aus Flözen, die entlang des Flusses
Tyne zutage traten. Im Jahr 1378 exportierte der Haupthafen
Newcastle bereits 15.000 Tonnen Kohle. Der Verbrauch an Kohle stieg
stetig; im Jahr 1700 wurden alleine in der Stadt London 1.700 Tonnen
Kohle pro Tag verbrannt. Durch diese Mengen waren die englischen
Bergwerke so tief geworden, dass sie mit Wasser vollliefen –
Pumpwerke wurden gebraucht. Die ersten wurden von Pferden
angetrieben, doch mit tierischer Arbeitskraft oder Windkraft
angetriebene Pumpwerke reichten bald nicht mehr. Auch die Geschichte
der Kohle wäre vermutlich zu dieser Zeit zu Ende gewesen, hätte
nicht 1712 Thomas Newcomen zum Abpumpen des Grubenwassers eine
Dampfmaschine entwickelt, die den im Jahrhundert zuvor
entdeckten
Luftdruck nutzte: Wasserdampf wurde in einem Zylinder durch
kaltes Wasser zur Kondensation gebracht, der dadurch entstehende
Unterdruck zog einen Kolben nach unten, und dieser zieht über eine
Wippe eine Pumpe aufwärts. Mit Newcomens Maschine konnte erstmals
Wärme (Kohle wurde verbrannt, um den Dampf zu erzeugen) in
mechanische Arbeit umgewandelt werden. 1769
ließ sich der geniale schottische Erfinder James Watt
zwei entscheidende Verbesserungen patentieren: Die Kondensation des
Wasserdampfes in einem separaten Kondensator, so dass der Zylinder
nicht mehr abkühlen und bei jedem Kolbenhub neu aufgeheizt werden
musste; und die Isolierung des Zylinders. Damit verbesserte er den
Wirkungsgrad um das Sechsfache – auf immer noch bescheidene drei
Prozent. Nach Jahren der Entwicklung gründete Watt gemeinsam mit dem
Fabrikanten Matthew Boulton die Firma Boulton
& Watt zur Herstellung von Dampfmaschinen, 1777 lief die erste
Watt’sche Dampfmaschine in der Erzmine von Chacewater. Boulton &
Watt wurde zum Riesenerfolg, denn die Firma stellte Maschinen her,
die nicht nur die Kohleförderung billiger machten, sondern mit der
auch Erze und andere Rohstoffe leichter und billiger abgebaut werden
konnten. Auf Drängen von Boulton arbeitete Watt zudem daran, mit der
Dampfmaschine Drehbewegungen zu erzeugen: Damit würde sie zur allseits
einsetzbaren Industriemaschine, geeignet zum Antrieb von
Mühlen, Spinnmaschinen, Walzwerken und anderen Maschinen. 1782
gelang es Watt, die “doppelt wirkende Dampfmaschine” herzustellen,
die dies konnte. (Aus der Zahl der von einer Dampfmaschine
eingesparten Pferde zum Abpumpen des Grubenwassers entstand übrigens
das lange gebräuchliche Maß für Leistung – die Pferdestärke [PS].)
Watts Dampfmaschine kam in eine Zeit, die auf sie gewartet zu haben
schien. In England, wo der Absolutismus sich nie hatte durchsetzen
können und die Bauern bereits seit dem Mittelalter frei waren,
hatten Kaufleute und Finanziers stärker als anderswo auch in das Gewerbe investiert.
Schon seit dem Mittelalter waren Maschinen genutzt worden – etwa um
Metall zu formen oder Getreide und Malz; viele von ihnen wurden
bereits mit Hilfe von Wasser- oder Windkraft mechanisch angetrieben.
Das Land war infolgedessen nicht nur in der Textil-, sondern auch in
der Eisenproduktion führend: 1709 wurde hier zum ersten Mal Koks
statt Holzkohle für die Eisenherstellung eingesetzt, 1740 Gussstahl
hergestellt und 1783/84 wurde Stahl mit dem Puddelverfahren zum
Massenprodukt.
Wie wird Wohlstand
geschaffen?
Die Investitionen in das Gewerbe waren darauf zurückzuführen, dass
nicht nur die Technik, sondern auch das Denken sich geändert hatten.
Die Annahme der Merkantilisten,
nach der der Handel Reichtum schuf, war schon zuvor von der auf den
französischen Ökonomen François Quesnay zurückgehende Denkschule der
"Physiokraten" angezweifelt worden, für die Reichtum letztendlich
nur auf die Natur, das heißt auf Grund und Boden zurückzuführen sei
und daher in Landwirtschaft und Bergbau erzeugt werde. Diese – und
nicht der Handel – seien daher von der Regierung zu fördern. (Die
Grundherren, die nicht arbeiteten, bezeichnete er dagegen im
Unterschied zu den "produktiven" Bauern als "sterile" Klasse.) Die
sich mit der Industriellen Revolution einsetzende Entwicklung
brachte insbesondere in England viele Denker dazu, diesen Ansatz
weiterzuentwickeln. 1776 veröffentliche der von der Aufklärung
geprägte schottische Moralphilosoph Adam Smith sein
Werk „Der Wohlstand der Nationen“, das ihn zum
Begründer der Wirtschaftswissenschaften machen sollte. Smith ging es
in seinem Werk – anders als den Merkantilisten – nicht in erster
Linie um den Reichtum des Staates (und der damit bezahlten
militärischen Macht), sondern um den (in Geld darstellbaren)
Wohlstand der Menschen. Anders als bei Quesnay und den Physiokraten
standen bei Smith aber nicht die Bauern, sondern die Arbeiter in der
Industrie im Mittelpunkt seiner Analyse. Smith hielt Arbeit, mit
der Güter hergestellt wurden, für die Quelle wirtschaftlicher Werte,
daher gilt er als Begründer der Arbeitswerttheorie (der
Annahme, dass der wirtschaftliche Wert einer Ware im Wesentlichen
von der für ihre Herstellung notwendigen Arbeitszeit abhängig
sei). Berühmt wurden seine Analysen, wie durch Spezialisierung die
Arbeitsproduktivität erhöht werden konnte: er beschrieb am Beispiel
einer Manufaktur für Stecknadeln, die er einst besucht hatte, wie
dort die Arbeitsteilung die Zahl der hergestellten Stecknadeln von
weniger als 20 pro Arbeiter auf ungefähr 4.800 erhöht hatte. Daraus
schloss er, dass die “sinnvolle Teilung und Verknüpfung aller
Arbeitsgänge ... die produktiven Kräfte der Arbeit mehr als alles
andere fördern und verbessern [dürfte].” Er erkannte aber auch, dass
mit der Mechanisierung eine weitere Steigerung der
Arbeitsproduktivität möglich war. Weiter beschäftigte er sich mit
der Rolle des Marktes, der zwischen Produzenten und Konsumenten
vermittele. Nach Smith würde die „unsichtbare Hand des
Marktes“ dafür sorgen, dass aus dem Eigennutz der
Marktteilnehmer Gemeinwohl entstünde: „Wir erwarten uns das
Abendmahl nicht von der Wohltätigkeit des Fleischers, Bauers oder
Bäckers, sondern von deren Bedacht auf ihre eigenen Interessen. Wir
wenden uns nicht an ihre Menschlichkeit, sondern an ihre
Eigenliebe.“ Der Kampf der Einzelnen um ihren Vorteil und ihren
Platz in der gesellschaftlichen Ordnung würde zu einer materiellen
Höherentwicklung führen, da sie aus Eigennutz dort investieren
würden, wo es der Gemeinschaft am meisten nützt, da das eingesetzte
Kapital dort am meisten Gewinn brächte.
Das Buch wurde zur “Bibel des (Wirtschafts-)Liberalismus” – Smith
glaubte, dass ein freier Markt die beste Möglichkeit sei, den Anteil
der produktiven Manufakturen und Fabriken an der Produktion zu
erhöhen und damit den Wohlstand fördern würde. Die Politik der
Merkantilisten, die mit Zöllen heimische Produzenten vor
ausländischer Konkurrenz schützen wollte, Zünfte, die über die
Privilegien von Handwerken wachten und Adelige, die ihr Geld für
übermäßigen Konsum verschwendeten, hielt er allesamt für
Hindernisse sinnvoller wirtschaftlicher Tätigkeit. Reiche sollten
am besten in den Kauf von Maschinen investieren, mit denen die
Produktivität erhöht werden konnte. Produktiv war Arbeit nur, wenn
sie dauerhafte Gegenstände oder verkäufliches Gut erschaffe, Händler
und Anwälte, aber auch der Staat, waren daher nicht produktiv. (Der
Staat sollte allerdings die äußere Sicherheit sowie das
Privateigentum schützen, auf die Einhaltung der Gesetze achten,
Monopole verhindern und Zinsen und Bankgeschäfte regulieren,
insofern war Smith kein Anhänger eines schwachen Staates, wie
mancher seiner Anhänger heute.) Da Smiths Erkenntnisse auch für den
Wettbewerb zwischen den Staaten galt – mit produktiver Arbeit
konnte man auch reicher werden, wenn man keine
Außenhandelsüberschüsse erwirtschaftete – unterstützten sie auch
Vorstellungen von einem freien Handel.
Smiths Ansatz wurde von David
Ricardo weiterverfolgt, der sich nach der Lektüre des
"Wohlstands der Nationen" mit der Frage beschäftigte, die ihm bei
Smith zu kurz gekommen schien: wie der geschaffene Wert in der
Gesellschaft verteilt wurde. Smith hatte erkannt, dass es drei Arten
von Einkommen gab: Die Löhne der Arbeiter, die Gewinne der
Unternehmer und die Renten von Grundbesitzern (Rente
wurde hier nicht im Sinne von Altersversorgung nach dem
Arbeitsleben – die es nicht gab – verstanden, sondern als Einkommen
ohne Gegenleistung). In seinem 1817 in erster Auflage erschienenem
Hauptwerk "Grundgesetze der Volkswirtschaft und Besteuerung"
erklärte Ricardo – darin seinem Freund Thomas
Robert Maltus folgend –, dass die Löhne der Arbeiter in erster
Linie deren Überleben dienten und dazu "ihre Rasse zu perpetuieren".
Eine zentrale Rolle spielten daher die Preise für Lebensmittel:
Sanken diese aufgrund höherer Produktivität in der Landwirtschaft,
konnten auch die Löhne sinken, wodurch die Gewinne der Unternehmer
stiegen und damit weitere Investitionen und eine wachsende
Wirtschaft ermöglichten. Damit wiederum wurde mehr Menschen eine
Lohnarbeit ermöglicht. (Eine wachsende Wirtschaft führt also nicht
dazu, dass es den Lohnarbeitern besser ging, sondern dass es mehr
von ihnen geben konnte.) Ein Wirtschaftshemmnis waren für Ricardo
die Grundherren: Da sie ihre Renten (die sie nur bezogen, da ihnen
das Land gehörte, auf dem produziert wurden) nicht produktiv
einsetzten, trugen sie nichts zum Wachstum der Wirtschaft bei.
Zudem würde mit wachsender Bevölkerung der Bedarf an Land wachsen,
wodurch die Grundherren mehr Geld verlangen und einen wachsenden
Anteil am Einkommen erhalten würden. Das Einkommen der Unternehmer
und damit ihre Fähigkeit (und aufgrund sinkender Gewinne auch
Bereitschaft) zu Investitionen würde sinken. Ricardos Argumentation
sollte 1846 zur Abschaffung der Getreidegesetze (corn laws)
beitragen, die mit Einfuhrzöllen die einheimische Landwirtschaft
geschützt und damit zur Macht der Grundherren beigetragen hatten.
Die Bedeutung der Unternehmer nahm in der Folge auf Kosten der
Grundherren zu. (Im Unterschied zu Smith hielt Ricardo auch den
Handel für eine produktive Tätigkeit: für ihn nutzte die
Herstellung von Gütern nichts, wenn diese nicht auch verkauft
wurden. Entscheidend war, was ein Händler mit seinen Gewinnen machte
– wenn er diese produktiv ausgab, etwa neue Handelsware kaufte, die
er gewinnbringend verkaufen konnte, war die Handelstätigkeit als
produktiv anzusehen.)
Schon Adam Smith hatte zwar schon das grundsätzliche Potenzial der
Mechanisierung für die Erhöhung der Produktivität erkannt; 1776 war
aber noch nicht in vollem Umfang erkennbar, welche Rolle die
Dampfmaschine schließlich spielen sollte. Arkwrights mit
Wasserkraft betriebene Fabrik belegt, dass die Mechanisierung schon
vor der verbreiteten Nutzung fossiler Brennstoffe begonnen hatte;
aber mit der Nutzung der Kohle konnte die mechanische
Produktion das ganze Land erobern. Damit änderten sich
die Spielregeln in der Wirtschaft: In einer von Handarbeit
abhängigen Manufaktur brauchte man die doppelte Anzahl von
Arbeitern, um seine Produktion zu verdoppeln, hatte also doppelte
Lohnkosten und dazu durch ein größeres Absatzgebiet höhere
Transportkosten – eine zu große Manufaktur war daher weniger
lohnend als eine kleine. Eine Fabrik lohnte sich aber erst ab einer
bestimmten Größe, und eine doppelt so große Maschine war nicht
doppelt so teuer: die Kosten je produzierter Einheit sanken, und
daher konnten immer größere Fabriken immer billiger produzieren. In
diesem “Skaleneffekt” (engl. economy of scales), der
systemtheoretisch eine positive Rückkoppelung ist, kann man einen
Ursprung des Zwangs zum wirtschaftlichen Wachstum
sehen, dem Unternehmen unterliegen: wer nicht immer größer wird,
wird von Wettbewerbern überholt, die weiter wachsen. (An seine
Grenzen stößt der Skaleneffekt jedoch durch den “abnehmenden
Grenznutzen”, der durch zusätzlichen Aufwand bedingt wird: Wenn die
Transportkosten etwa die eingesparten Stückkosten ausgleichen,
lohnt weiteres Wachstum sich nicht mehr.) Ein anderer Ursprung des
Wachstumszwangs liegt in der neuen Rolle des Kapitals:
Hatten die "Handwerker-Unternehmer" vor und während der frühen
industriellen Revolution noch mit relativ wenigen Werkzeugen Waren
produziert und für diese Geld erhalten, wurde viel Geld jetzt zur
Voraussetzung für die Produktion von Waren: es musste zunächst
investiert werden, um Maschinen zu kaufen, mit denen dann Waren
produziert werden konnten, die verkauft werden konnten. Das nötige
Geld für die Maschinen konnten einzelne Unternehmer nur noch selten
aufbringen, es wurde von privaten Kapitalgebern in der Hoffnung auf
Gewinne gegeben – die Direktoren und Geschäftsführer der
Gesellschaften waren nicht mehr immer die Eigentümer; mit der
Industriellen Revolution gewann der Kapitalismus
als Industriekapitalismus eine neue Bedeutung.
Industrialisierung,
Marxismus und Kapitalismus
Schon vor Karl Marx hatten sozialistische Kritiker die
Arbeitswerttheorie von Smith, der auch David Ricardo anhing, zum
Ausgangspunkt für die Frage gemacht, warum die Arbeiter, die ja den
Wert schufen, nicht auch die Einkünfte aus dem Verkauf der Waren
erhielten. Diese Frage hatte auch David Ricardo bei seiner
Untersuchung der Verteilung des geschaffenen Wohlstands nicht
beantwortet. Karl Marx, der 1848 mit Friedrich Engels das
"Kommunistische Manifest" veröffentlicht
hatte, kritisierte den Kapitalismus nicht nur, sondern
versuchte auch, diesen zu verstehen. Seine Erkenntnisse
veröffentlichte er in seinem Hauptwerk "Das Kapital", dessen
erster Band 1867 erschien (Band 2 und 3 wurden posthum von Friedrich
Engels herausgegeben). Darin entwickelte er seine eigene Version der
Arbeitswerttheorie: Die Quelle des Wertes war für Marx die
Arbeitskraft der Arbeiter, die die Unternehmer mit ihrem Geld
kauften. Mit ihrer Arbeit schufen die Arbeiter Werte. Wenn sie mehr
arbeiteten, als zur Wiederherstellung ihrer Arbeitskraft (also für
Wohnung, Nahrung und Kleidung) nötig, schufen sie einen Mehrwert.
Der Kapitalismus profitierte für Marx von seiner Fähigkeit, die
Produktion so zu organisieren, dass erheblicher Mehrwert entstand.
Diesen Mehrwert erhielten jedoch nicht die Arbeiter (daher wurden
sie für Marx "ausgebeutet"), sondern die Kapitalisten, die diesen
ansammelten ("Kapitalakkumulation") und wieder in Produktion
steckten, um noch mehr Gewinn zu machen. (Die Ausbeutung lag also
nicht am Unternehmer, sondern am "System": wer als Fabrikant nicht
ständig seine Produktivität erhöht – durch bessere Maschinen und
stärkere Ausbeutung der Arbeiter – würde nach Marx von anderen
Unternehmern unterboten und vom Markt verdrängt werden. Mit diesem
Veränderungsdruck sollte die Industrielle Revolution aber auch zu
einem wirksamer Treiber für technologische Neuentwicklungen werden;
weniger produktive Gewerbe – wie die vorindustrielle Weberei –
wurden verdrängt. Der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter
prägte hierfür später den Begriff "schöpferische Zerstörung".)
Marx stellte sich auch die Frage, wer neben den Arbeitern und den
Unternehmern noch an der Produktion beteiligt war. Wie schon David
Ricardo gehörten auch für Marx Dienstleistungen zur
Produktionssphäre, in der Mehrwert erzeugt wurde, aber auch (und
neu) neben dem Handel als Teil der "Zirkulationssphäre"
bestimmte Teile des Finanzsektors. Das Handelskapital "realisiert"
für Marx den vom Produktionskapital geschaffenen Wert, in dem es für
den Verkauf der Waren sorgt. Da es keinen Mehrwert schafft, als
kapitalistische Aktivität aber Profit erwartet, zweigt das
Handelskapital letztendlich einen Teil des vom Produktionskapital
geschaffenen Mehrwerts für sich ab (womit der durchschnittliche
Profit der Wirtschaft geschmälert wird). Daneben gehört zur
Zirkulationssphäre das "zinstragende Kapital", etwa der Banken.
Dieses erleichtert die Kapitalbeschaffung und verkürzt die
Umlaufzeit (der Produzent muss nicht warten, bis er seine Waren
verkauft hat, um neue Produktionsmittel einzukaufen), bringt aber
auch keinen Mehrwert hervor. Zinsen stehen für die Möglichkeit,
durch Investitionen künftig höhere Einkommen zu erzeugen, die sich
damit das Produktionskapital und das "zinstragende" Kapital teilen.
Diese Aktivität des "zinstragenden Kapitals" ist für Marx produktiv,
da sie zur Erhöhung des Mehrwerts beiträgt (im Unterschied etwa zur
Aktienspekulation, die nicht zu einer Schaffung von Mehrwert
beiträgt und daher nicht produktiv ist), führte aber auch zur
Abnahme der Bedeutung des Handelskapitals für die Bereitstellung von
Geld für die Produktion. Daneben sah auch Marx den Besitzer knapper
Dinge wie Land als Profiteur des Kapitalismus, statt "Renten" sprach
er von Mehrgewinnen, die sich aus Monopolen ableiteten. Diese
Monopolgewinne hatten auch für Marx nichts mit Wertschöpfung zu tun
und gingen daher zu Lasten der Gewinne der produktiv tätigen
Kapitalisten.
Marx sah aber auch, dass die Veränderungen durch die
"kapitalistische Produktion" nicht nur die Wirtschaft, sondern auch
die Gesellschaft insgesamt betrafen. Vor allem die massenhafte
Abwanderung von Landarbeitern in die Städte war unübersehbar. Hier
waren die Menschen gezwungen, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, um
ihren Lebensunterhalt zu sichern: auch die menschliche Arbeit wurde
daher im Kapitalismus zur Ware; Arbeitskraft wird gegen den
Arbeitslohn getauscht. Da ihnen die Produktionsmittel nicht mehr
gehören und sie zudem in Folge der (von Adam Smith noch gelobten)
Arbeitsteilung nur noch einzelne Aspekte der Produktion ausführen,
wurde die Arbeit "entfremdet", der Lohnarbeiter kann (jenseits des
Lohns) keine Beziehung mehr zum Ergebnis seiner Anstrengungen
herstellen. Die "Entfremdung" der Arbeit und der Warencharakter
kapitalistischer Arbeit standen bei Marx für eine Verdinglichung der
sozialen Beziehungen im Kapitalismus; der Arbeiter werde durch die
Entfremdung zum "Anhängsel der Maschine", die Arbeit werde geistlos
und fremdbestimmt, anstatt es dem Menschen zu ermöglichen, seine
Fähigkeiten und Talente zu entfalten. Die Höhe der Löhne – der
Ausgangspunkt der sozialistischen Überlegungen – hing auf einem
Markt dagegen von den Machtverhältnissen ab und wurden durch den "Klassenkampf"
geregelt: wenn Arbeiter knapp waren, konnten sie höhere Löhne
durchsetzen; Kapitalisten konnten dann aber Maschinen einsetzen und
damit die Knappheit beenden und die Löhne wieder drücken. Die
Kapitalisten versuchten daher für Marx, eine "Reservearmee" aus
Arbeitslosen zu schaffen, mit denen sie die Löhne niedrig halten
konnten, was ihren Gewinn erhöhte.
In der Systemlogik, nach der Fabrikanten ständig ihre Produktivität
erhöhen müssten, sah Karl Marx auch das für ihn unvermeidliche
Scheitern des Kapitalismus begründet: Durch die gnadenlose
Konkurrenz würden die Profitraten schließlich fallen, Insolvenzen
würden zur Monopolbildung führen, durch die Ausbeutung und Elend der
Arbeiter wachsen würden – bis diese schließlich in einer "proletarischen
Revolution" den Kapitalismus beenden würden. (Was auf ihn
folgen würden, hatten Marx und Engels bereits 1848 im
"Kommunistischen Manifest" verkündet: eine klassenlose Gesellschaft
ohne Privateigentum und Profitstreben und damit ohne Ausbeutung und
Entfremdung. Dennoch könne der Kommunismus genügend
Produktivkräfte wecken, um das allgemeine Wohl zu mehren.) Manche
spätere Ökonomen (wie Joseph Schumpeter) hielten Marx für einen
Spitzenökonomen, der vieles richtig vorhersah (etwa die Tendenz des
Kapitalismus, alles zur Ware zu machen); in anderen Punkten wurde er
aber widerlegt (so wird der Preis einer Ware nicht von der darin
enthaltenen Arbeit bestimmt, sondern vor allem durch die Nachfrage).
Der Begriff Kapitalismus wurde mit Karl Marx und
seiner Analyse der "kapitalistischen Produktionsweise" gebräuchlich,
zunächst wurde er in der Regel als Kampfbegriff zur Kritik an
Ausbeutung und Entfremdung benutzt. Spätestens mit den Werken von
Werner Sombart (Der moderne Kapitalismus, 1902) und Max Weber (Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904) ging der
Begriff aber auch in die Soziologie und Wirtschaftshistorie ein –
und es wurde erkannt, dass der Kapitalismus nicht erst mit der
Fabrikindustrie, sondern bereits weit früher
entstanden war. Der Handelskapitalismus
ist viel älter als die Industrialisierung (und führte trotzt weiter
Verbreitung nicht
zwangsläufig zur Industrialisierung); anderseits ist, wie später
das Beispiel der Sowjetunion zeigen sollte, Industrialisierung auch
ohne Kapitalismus möglich – beide Begriffe sollten daher getrennt
werden. Dennoch sind Industrialisierung und Kapitalismus eng
verknüpft: Zum einen beförderten vorindustrielle Gewerbe die
Industrialisierung, zum anderen sind die planwirtschaftlichen
Alternativmodelle alle gescheitert. Die enge Bindung zwischen
Kapitalismus und Industrialisierung ergab sich aus dem hohen
Kapitalbedarf für die immer größer werdenden Fabriken.
Zur proletarischen Revolution ist es aber nicht
gekommen: das Feedback der Märkte erwies sich als besseres Mittel
als zentrale Planungen, um die Investitionen an der richtigen Stelle
einzusetzen. Dennoch geronnen Marx' (mitunter auch veränderten)
Ideen zur Weltanschauung, dem Marxismus, auf die
sich im 20. Jahrhundert Revolutionäre in Russland, China, Vietnam
und anderen Ländern beriefen (mehr).
Insgesamt aber bestimmte mit der Industrialisierung der Kapitalismus
immer größere Teile der Welt – zum einen, indem die
Industrialisierung immer
neue Länder erreichte, zum anderen durch die von etwa 1860 bis
1915 und wieder seit etwa 1960 (und noch einmal beschleunigt seit
1990) einsetzende Globalisierung. Mit dem Erfolg der Industriellen
Revolution und der vor diesem ausgelösten Verstädterung und durch
technische Innovationen wie die Eisenbahn, die schließlich im 20.
Jahrhundert einen dynamisch ansteigenden Massenkonsum ermöglichten,
gewann auch der Handelskapitalismus weiter an Gewicht; der
Kapitalbedarf der Industrialisierung führte zudem zu einer schnellen
Ausweitung des Finanzkapitalismus. Der Agrarkapitalismus breitete
sich ebenfalls aus, zunächst jedoch vor allem durch die Ablösung der
alten Feudalordnung. Schließlich schwappten aber technische
Innovationen aus dem industriellen Gewerbe (industrielle
Kunstdünger, Mechanisierung) in die Landwirtschaft über und ließen
eine industrielle
Landwirtschaft entstehen.
Die Rolle der Eisenbahn
Die Dampfmaschine hatte Kohle in großen Mengen verfügbar und billig
gemacht, und so die Metallherstellung von ihrer Abhängigkeit von
Holzkohle befreit. Damit wurden Eisen und Stahl zum bevorzugten
Material im Maschinenbau. Das Wirtschaftswachstum in England betrug
Ende des 18. Jahrhunderts acht bis zehn Prozent pro Jahr –
vergleichbar mit China heute. 1786 gab es in Manchester die erste
dampfbetriebene Textilfabrik, um 1800 waren es bereits fünfzig. Die
wachsende Produktion verschärfte jedoch ein Problem, dass schon die
Kohlebergwerke hatten: wie konnte man die Kohle oder die Ware
transportieren? Straßen waren schon seit dem Ende des 17.
Jahrhunderts verstärkt gebaut worden, aber von Pferde gezogen
Fuhrwerke konnten keine große Mengen transportieren. 1761 wurde für
den Kohletransport nach Manchester – nach dem Vorbild des
französischen Canal du Midi, der schon seit 1681 zusammen mit
der Garonne Mittelmeer und Atlantik verband – der Bridgewater
Kanal für den Transport von Kohle nach Manchester gebaut,
dessen Erfolg eine canalmania in England auslöste. In den
nächsten 50 Jahren wurden weitere 6.500 Kilometer Kanal gebaut. Aber
Kanäle waren extrem aufwändig und teuer. Kurze Wege hatte man daher
mit Holzbalken für die Kohlewagen befahrbar gemacht. 1767 wurden zum
ersten Mal gusseiserne Schienen verlegt; auf diesen “tramways”
zogen Pferde die beladenen Wagen. 1784 baute Watts Freund und
Partner William Murdoch die erste mobile Dampfmaschine und 1804
Richard Trevithick die erste Dampflokomotive als
Zugmaschine für eine Bergwerks-Schienenbahn: Dies sollte die
Geburtsstunde der Eisenbahn sein. Allerdings war der erste Zug für
die gusseisernen Schienen zu schwer – sie zerbrachen. Erst 1812
konstruierte der Ingenieur John Blenkinsop eine Bahn, die schwere
Lasten aushielt. Die erste, 1825 eingeweihte Dampfeisenbahn
baute George Stephenson zwischen Stockton und Darlington, auf ihr
wurden noch ausschließlich Güter transportiert. Die erste
Fernbahnlinie vom Baumwollhafen Liverpool in die Textilstadt
Manchester ging 1830 in Betrieb, sie transportierte erstmals auch
Personen – die Eröffnung machte damals weltweit Schlagzeilen, weil
ein bekannter britischer Politiker dabei unter die Räder der Bahn
geriet und starb. Den Siegeszug der Eisenbahn konnte das aber nicht
aufhalten: 1850 gab es bereits 10.655 Kilometer Eisenbahnschienen in
England, 1900 dann bereits 35.198 Kilometer. 1884 war auch des Hin
und Her der Kolben durch die wirkungsvollere Drehbewegung der
Dampfturbinen ersetzt worden.
Die Eisenbahn hat den Transport von Waren und Menschen über Land
schneller und billiger gemacht – und damit die Welt verändert.
Bauern trieben ihre Tiere nicht mehr zum Markt in die nächstgelegene
Stadt, sondern zum Bahnhof, wo Händler sie aufkauften und mit der
Bahn in die großen Städte brachten. Das Geld, was die billigeren
Reisen überließen, erhöhte die Kaufkraft der Konsumenten; und jetzt
gelangten frische Milch und frisches Fleisch in die Städte. Auch die
Bauweise veränderte sich: hatte man früher notgedrungen
Baumaterialien aus der Umgebung verwendet, brachte die Eisenbahn
billige Ziegel ins ganze Land. Damit verschwanden auch lokale
Baustile, überall ähnliche "moderne" Entwürfe setzten sich durch.
Die Mobilität der Menschen nahm ebenfalls zu, und in der Folge
heirateten viele Menschen nicht mehr, wie Anfang des 19.
Jahrhunderts noch üblich, in ihrem Dorf oder höchstens im
Nachbardorf, sondern Menschen aus ganz anderen Regionen. Viele
Menschen kamen mit den Veränderungen freilich auch nicht zurecht und
litten unter dem Zusammenbrachen der traditionellen Dorfstrukturen,
viele von ihnen landeten entweder in den "Irrenhäusern", die ab 1845
jede Grafschaft in England eröffnen sollte, oder als Bettler in den
Städten. Aus Sicht der Produzenten vergrößerten der Zugang in
entfernte Regionen und die billigeren Preise vor allem die Märkte –
auf größeren Märkten rentieren sich große Maschinen aber noch
leichter. Damit förderte die Eisenbahn das Fabrikwesen ungemein.
Textilindustrie, Eisen- und Stahlindustrie und die
Eisenbahn waren die Pfeiler der
Industrialisierung
Die Nutzung der Kohle vergrößerte scheinbar die Fläche und
Bevölkerungszahl Englands: Im Jahr 1815 nutzte England 23 Millionen
Tonne Kohle – um eine entsprechende Energiemenge aus Holz zu
erzeugen, hätte das ganze Land mit Wald bestanden sein müssen. Jetzt
konnte man das Land anders nutzen. Hinzu kam noch, dass das
industrialisierte England auch weniger Flächen für die
Landwirtschaft brauchte: Es konnte nämlich seine industriell
hergestellten Waren gegen Getreide aus Amerika und Russland und
Zucker aus der Karibik eintauschen. Die aus der Kohle stammende
Energie leistete zudem etwa die Arbeit von 50 Millionen kräftigen
Männern – zu einer Zeit, als die gesamte Bevölkerung 13 Millionen
Menschen betrug, England also vielleicht über drei Millionen
kräftige Männer verfügte. Land und Menschen waren damals aber die
wichtigsten Machtfaktoren, und so lassen die Zahlen ahnen, wie sehr
Englands Bedeutung mit der Industriellen Revolution stieg.
Die Bedeutung fossiler Energien
Weit über 90 Prozent unserer Geschichte, die wir als Jäger und
Sammler verbrachten, waren wir Menschen vor allem auf unsere eigene
Muskelkraft angewiesen, deren Wirksamkeit nur durch Werkzeuge wie
Pfeil und Bogen erhöht wurde; dazu kam seit der Erfindung des Feuers
die Nutzung von Biomasse (meist in Form von Brennholz). Mit der
Domestizierung großer Tiere wurde auch deren Muskelkraft dem
Menschen nutzbar gemacht, und mit Wasser- und Windmühlen sowie
Segeln wurde schon in der Vorgeschichte die (bescheidene) Nutzung
erneuerbarer Energiequellen begonnen (mehr).
Mit der Ausbeutung fossiler Energiebestände, die während
geologischer Zeiträume entstanden waren, vervielfachte sich das
verfügbare Energieangebot in kürzester Zeit: in England konnten
schon bald nach Beginn der Industrialisierung kohlebefeuerte
Dampfmaschinen die Arbeit von 50 Millionen “Energiesklaven”
leisten. Dabei wurde aber nicht nur die Menge der geleisteten Arbeit
vervielfacht, sondern noch wichtiger: es wurden Arbeiten möglich,
die selbst Millionen Arbeitskräfte nicht hätten leisten können; etwa
das Schmelzen von Eisen. Die Nutzung fossiler Energie befreite die
Menschen von seit Jahrtausenden bestehenden Grenzen; sie schien es
ihnen zu ermöglichen, ihre tierische Vergangenheit endgültig hinter
sich zu lassen. Sie bilden auch heute noch die Basis moderner
Industriegesellschaften (mehr).
Die Nutzung fossiler Energien verstärkte alle Faktoren, die dem
Menschen schon im Zeitalter der Landwirtschaft erlaubt hatte, sich
einen immer größeren Anteil an den Energie- und Stoffflüssen der
Erde zu sichern (hier):
Sie waren eine zusätzliche Energiequelle, mit der
neue Werkzeuge (Dampfmaschine...) angetrieben
werden konnten, die den Handel beförderte
(Eisenbahn, Dampfschiff) und die eine neue Dimension der Ausbeutung
von Rohstoffen (Kohlebergbau) bedeutete. Sie
sollte dazu beitragen, diesen Anteil auf 40 Prozent zu steigern und
vervielfachte die Folgen menschlicher Aktivitäten für die Umwelt (hier).
Dies ist ein ungelöstes Problem, wenn wir etwa an den Klimawandel
denken.
Das andere Problem besteht darin, dass die fossilen
Brennstoffe im Zeitrahmen menschlichen Handelns nicht erneuerbar
sind. Beim Öl ist der Höhepunkt der Förderung schon erreicht oder
nahe bevorstehend (hier).
Das Zeitalter der fossilen Energien wird daher historisch eine
Episode bleiben, die zu Ende geht, lange bevor die fossilen
Brennstoffe ausgehen, weil die Förderung der verbliebenen Bestände
immer schwieriger und teurer wird. Die Frage, wie
Industriegesellschaften ohne fossile Energien aussehen
können; ist offen. Den aktuellen Stand der Überlegungen finden Sie hier.
Westeuropa zieht nach
Um 1800 war Englands Vorsprung für seine europäischen
Nachbarn unübersehbar geworden; zumal die billigeren
englischen Industriewaren auch den Handwerkern in anderen Ländern
Konkurrenz machte. Immer dringlicher schien es daher, die
notwendigen Kenntnisse auch zu erwerben und anzuwenden. Die
Voraussetzung für die Aufholjagd wurde im Gefolge der
Französischen Revolution geschaffen: In großen Teilen Europas
brach die alte politische Ordnung zusammen; die Befreiung der Bauern
und die Abschaffung der Zünfte schafften Gewerbefreiheit – jeder
konnte nahezu jedes Gewerbe ausüben. Wo es Kohle und Eisenerz gab,
entstehen danach mit der Einführung riesiger, dampfgetriebener
Maschinen Fabriken – und erste Industriegebiete: in Belgien, im
Nordosten Frankreichs, im Rheinland und im Ruhrgebiet. Die Region
von England bis zum Ruhrgebiet wurde daher auch schon der “Kohle-Halbmond”
genannt, um seine Bedeutung für die Industrielle Revolution analog
zum “fruchtbaren Halbmond” für die
Entstehung der Landwirtschaft zu betonen. Um den Vorsprung
Englands aufzuholen und um sich die inzwischen zwei Generationen
lang weiterentwickelten Maschinen leisten zu können, um passende
Gebäude und – vor allem – ein Eisenbahnnetz aufbauen zu können,
brauchten die Nachzügler vor allem eins: Geld. Es entstanden
überall in Europa neue Banken und Kapitalgesellschaften – wer Geld
hatte, konnte sich mittels Aktien und anderen Titeln an den neuen
Unternehmungen beteiligen. So wurde in Frankreich die von Jakob
Rothschild geleitete Filiale der von dem nach England
ausgewanderten Nathan Mayer Rothschild gegründeten Bank N.M.
Rothschild and Sons zum Finanzier des Eisenbahnbaus; ihr zur Seite
stand die von den Brüdern Jacob Émile und Isaac
Péreire gegründete Bank Société Générale du Crédit
Mobilier (sie bot zur Finanzierung Schuldverschreibungen an und
beteiligte sich mit den so eingesammelten Mitteln beteiligte an
zahlreichen Unternehmen. Bereits im ersten Jahr, 1853, zahlte sie
eine Dividende von 40 Prozent). Der Crédit Mobilier finanzierte
große Teile des Eisenbahnbaus in Österreich-Ungarn, Russland und
Spanien, auch englische, deutsche und später auch amerikanische
Banken investierten in den Eisenbahnbau und die Industrialisierung –
ab Mitte des 19. Jahrhunderts war die Industrialisierung Westeuropas
in vollem Gang.
Deutschland war dabei zunächst ein Nachzügler
gewesen. In Preußen wurden die Bauern erst nach längerem Zögern im
Jahr 1807 aus der Leibeigenschaft entlassen, 1810 wurden die Stände
aufgelöst und die Gewerbefreiheit eingeführt; 1834 schlossen sich
die Regierungen der deutschen Staaten zum Zollverein zusammen und
ermöglichten damit einen gemeinsamen, großen Markt. 1835 fuhr auch
in Deutschland die erste Dampfeisenbahn – die „Adler“ – auf der
Strecke von Nürnberg nach Führt. 1850 gab es in Deutschland bereits
11.089 Kilometer Eisenbahnlinie, 1900 waren es dann 51.678
Kilometer. Der Eisenbahnbau schuf wie in England Transportwege,
verband die Märkte und förderte die Eisenindustrie und den
Maschinenbau. Im Ruhrgebiet fanden sich große Mengen der für die
Koksherstellung geeigneten Fettkohle, wodurch die zuvor ländliche
Region zu einem der wichtigsten Industriereviere wurde. Als
"Gründervater" des Ruhrgebiets gilt der Unternehmer Friedrich
Harkort, der 1819 in Wetter an der Ruhr die "Mechanischen
Werkstätten Harkort & Co." gründete, die zunächst
Dampfmaschinen herstellten. Diese fanden im beginnenden
Kohlebergbau einen großen Markt; 1826 führte Harkort das
Puddelverfahren in Deutschland ein. Seine Unternehmen gossen u.a.
Eisenbahnschienen für den Bergbau, und Harkort setzte sich früh für
den Bau von Fernbahnen in Deutschland ein. Mit Kohle und dem
Eisenbahnbau gewann die industrielle Revolution auch in Deutschland
an Schwung; die Produktion von Eisen und Stahl stieg in manchen
Jahren um 30 bis 50 Prozent. Unternehmer wie August Borsig,
der 1836 das erste deutsche Werk für Lokomotivenbau gegründet hatte
(der Borsigplatz in Dortmund ist nach seinem Sohn Alfred benannt,
der 1872 in Dortmund die "Maschinenfabrik Deutschland"
mitbegründete), und Alfred Krupp, der aus der 1812
von seinem Vater Friedrich gegründeten Gussstahlfabrik das größte
Industrieunternehmen Europas machte, kamen zu großem Reichtum
(Friedrich Harkort dagegen nicht – was auch daran lag, dass er
jedem, auch seinen Konkurrenten, seine Fabriken und
Produktionsverfahren zeigte, um die Industrialisierung des Landes
voranzubringen). Die deutsche Industrie profitierte auch davon, dass
sich der Freihandel (im Umsetzung von Smith's Idee
des freien Wettbewerbs zwischen den Staaten) ab Mitte des 19.
Jahrhunderts zunehmend durchsetzte: Vor allem die englischen
Baumwollproduzenten suchten neue Märkte; wollte man aber in diese
exportieren, durfte man deren Ausfuhren nicht behindern. So fielen
Schutzzölle und andere Handelsbeschränkungen wie
Schifffahrtsgesetze, die nur der britischen Marine den Transport in
englische Häfen erlaubt hatten. Vergleichsweise niedrige Löhne bei
hohem technischen Standard führten um 1880 herum dazu, dass die
deutsche Industrieproduktion erstmals die englische übertraf. Dabei
kam es zu einer "Westwanderung" – Menschen aus dem
landwirtschaftlich geprägten Osten wanderten in die Industriegebiete
des Westens (ähnlich kam es in Großbritannien zu einer Süd- und in
Frankreich zu einer Nordwanderung).
Technik unter Kontrolle
Immer wieder explodierten in den ersten Jahrzehnten
der Industriellen Revolution die Dampfkessel: Mit Drücken von bis zu
10 Atmosphären wussten viele Ingenieure nicht umzugehen, die Anlagen
wurden oft von ungelernten Tagelöhnern bedient. Nach der Explosion
eines Dampfkessels in der Mannheimer Brauerei Mayerhof im Januar
1865, bei der der Kesselbursche ums Leben kam und Teile der Wände
des Brauhauses einstürzten, wurde auf Druck des badischen
Handelsministerium eine “Gesellschaft zur Überwachung und
Versicherung von Dampfkesseln” gegründet, deren Techniker zweimal im
Jahr die Dampfkessel der Mitglieder kontrollierten. Zuerst war die
Mitgliedschaft freiwillig, aber bald wurde die jährliche Inspektion
zur gesetzlichen Pflicht, und auch die anderen Bundesstaaten
gründeten Überwachungsvereine. Bald stellten diese auch Normen zum
Bau von Dampfkesseln und anderen technischen Anlagen auf; 1936
änderten sie ihren Namen in “Technische Überwachungsvereine” (TÜV).
Heute haben sie ihr Monopol für die Prüfung technischer Anlagen
verloren, aber deren Prüfung (heute durch "zugelassene
Überwachungsstellen") ist immer noch ein wesentlicher Bestandteil
des technischen
Arbeitsschutzes.
Auf dem Weg zur Weltmacht: Die USA
Noch schneller als Europa kam aber Nordamerika
voran. Im Norden der späteren Vereinigten Staaten blieb der
Landbesitz vor der Mechanisierung klein und mehr oder weniger
gleichmäßig verteilt, Familienbetriebe herrschten vor. Das Ideal
der USA, ein Land freier Menschen zu sein, schloss die
Gewerbefreiheit ein; zugleich brachte mancher Einwanderer
handwerkliche Kenntnisse mit – ein Nährboden für Unternehmertum.
Nach englischem Vorbild entstanden bald nach der Besiedelung erste
Manufakturen – und zur Zeit der Unabhängigkeitserklärung der
amerikanischen Kolonien im Jahr 1776 gab es dort bereits etwa 200
Eisenhütten. Die Amerikaner übernahmen nicht nur schnell englische
Maschinen, sondern verbesserten diese und exportierten sie bald
sogar nach England. Dabei spielte die Kohle in Amerika zunächst eine
wesentlich geringere Rolle bei der Industrialisierung als in Europa
– bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden vor allem Holz aus den
riesigen Wäldern und Wasserkraft genutzt, auch Lokomotiven und
Flussschiffe fuhren mit Holz. Erst ab 1880 sollte in großem Maßstab
Kohle genutzt werden, die in Pennsylvania, West Virginia, Kentucky
und Tennessee reichlich vorhanden war. In Pennsylvania wurde sie zur
Grundlage für den Aufbau einer Schwerindustrie. Der
Arbeitskräftebedarf wurde von Millionen von Einwanderern gedeckt,
die in großer Zahl ins Land kamen. Dazu trug auch das Dampfschiff
bei, das ab 1840 regelmäßig die alte und die neue Welt verband und
die Passagen schneller, weniger vom Wind abhängig und billiger
machte. Das erste hochseetaugliche Dampfschiff, die von dem
britischen Ingenieur Isambard Kingdom Brunel gebaute SS Great
Western, brauchte für die Atlantiküberquerung noch 14,5 Tage,
1855 schafften neue Schiffe sie schon in 9,5 Tagen (und 1900 in 5,5
Tagen). Die Einwanderer konnten sich aber oft untereinander kaum
verständigen, und sollten damit zum eigentlichen amerikanischen
Beitrag zur industriellen Revolution beitragen: Mit einfachen
Arbeitsvorgängen wurde die industrielle Fertigung stark vereinfacht,
das Können von Fachkräften war kaum noch gefragt. Die amerikanischen
Ingenieure sollten die Herstellung standardisierter Bauteile (das
“amerikanische Fabrikwarensystem”) bei der Produktion von Gewehren
für den
Bürgerkrieg lernen – und dies sollte dazu beitragen, dass um
1890 herum die amerikanische Industrieproduktion die Deutschlands
und Englands übertraf.
Ein wesentlicher Schritt hierzu war die endgültige Erschließung
des amerikanischen Westens nach dem Bürgerkrieg, deren Symbol
die Fertigstellung der ersten transnationale
Eisenbahnlinie im Jahr 1869 durch die beiden
Bahngesellschaften Union Pacific Company und Central Pacific Company
war. Sie wurde auch zum Symbol für ein neues Zeitalter: Wie schon in
Europa förderte der Eisenbahnbau – im Jahr 1900 gab es in den USA
354.000 Kilometer Gleise, mehr als in Gr0ßbritannien, Deutschland,
Frankreich, Österreich-Ungarn und Russland zusammen – die
Entwicklung der Eisen- und Stahlindustrie sowie den Maschinenbau,
und etwas später auch die Kohleförderung an der Ostküste. Sie schuf
zudem Zugang zu den Bodenschätzen und dem Holz des Westens; im
Mittleren Westen und den Great Plains wurde Viehzucht betrieben, um
die wachsenden Städte mit Fleisch zu versorgen. In dieser auch "gilded
age" (vergoldetes Zeitalter) genannten Blütezeit des
Kapitals entstanden Reichtümer, die bis heute sprichwörtlich sind: Cornelius
Vanderbilt machte sein erstes Geld mit 16 Jahren mit
einem Segelboot, mit dem er einen Fährdienst von New York nach
Staaten Island betrieb, und baute eine Flotte auf. 1818 verkaufte er
seine Flotte und verdingte sich als Dampfschiffkapitän; 1829
gründete er eine eigene Dampfschiffgesellschaft, die in den 1850er
Jahren eine Flotte von 100 Schiffen umfasste. 1847 investierte er in
die New York, Providence and Boston Railroad, seiner ersten
Eisenbahn; und nach dem Bürgerkrieg investierte er massiv in dieses
neue Transportmittel. 1873 eröffnete er etwa die Eisenbahnlinie New
York – Chicago. Mit diesen Investitionen wurde er zum damals
reichsten Amerikaner. Die Eisenbahn sollte auch andere reich machen:
Der Leiter der Western Division der Pennsylvania Railroad, Andrew
Carnegie, verließ diese 1865 und investierte in
zahlreiche Unternehmen – vor allem Eisenhütten und -werke. Auf
Besuchen in England kam er zu dem Schluss, dass Gusseisen zunehmend
von Stahl verdrängt werden würde und stellte ab 1870 selber
Stahl nach dem Bessemer-Verfahren her. Als er sein Unternehmen 1901
an den Bankier John Piermont Morgan verkaufte, war er nach
Vanderbilt der zweitreichste Amerikaner. John Piermont
Morgan hatte sein Geld, zunächst für das in London
ansässige väterliche Bankhaus, ab 1871 mit dem mit einem Partner
gegründeten Bankhaus Drexel, Morgan & Co. (das 1895 zu J.P.
Morgan & Co. umfirmierte), mit der Finanzierung der
Eisenbahngesellschaften gemacht. Mit dem Kauf von Carnegies
Stahlwerken, die er mit seinen eigenen zur United States Steel
Company verschmolz, schuf er die damals größte Aktiengesellschaft
der Welt. Übertroffen wurde der Reichtum dieser drei Männer aber
noch von dem John D. Rockefellers, der sein Geld
mit Erdöl machte (Eine kleine
Geschichte des Erdöls) und zum ersten Milliardär der Erde
wurde. Auch der Aufstieg dieser Männer aus teils einfachen
Verhältnissen – Carnegie begann als Telegraph, Rockefeller als
Buchhalter – trug zum amerikanischen Mythos, dass man es hier durch
Arbeit und Geschäftssinn vom Tellerwäscher zum Millionär bringen
könne, bei. Dieser Glaube ließ den Zustrom an Arbeitskräften nicht
abreißen.
Die USA wurden auch zum Vorreiter der
Industrialisierung der Landwirtschaft, um die wachsenden
Industriestädte mit billiger Nahrung zu versorgen. In den großen
Schlachthöfen von Chicago wurde das Fließbandsystem
zur Zerteilung der Rinder eingeführt. Ende des 19. Jahrhundert
begann der Ingenieur Frederick W. Taylor (“Taylorismus”),
industrielle Arbeitsvorgänge in einzelne Schritte zu zerlegen und
deren Dauer mit der Stoppuhr zu messen – ein weiterer Ausgangspunkt
für Rationalisierung und spätere industrielle Fließbandproduktion.
Die amerikanische Produktivität setzte damit die Maßstäbe für die
Welt. Die Massenproduktion machte in dem seit der Jahrtausendwende
zudem bevölkerungsreichsten Land der westlichen Hemisphäre einen
Massenkonsum möglich, und so sollten Telefon und Auto in Nordamerika
bereits selbstverständlich sein, als sie in Europa noch als Luxus
für Reiche galten.
Die sozialen Folgen
der Industrialisierung
Die massenhafte Lohnarbeit in der Industrie führte nicht nur dazu,
dass Arbeiter und Angestellte eine von Marktprinzipien geprägte
Tauschbeziehung eingingen, sondern es entstand auch ein ungleiches
Herrschaftsverhältnis mit vielfältigen sozialen Folgen. Bauern, die
aus der Leibeigenschaft befreit worden waren, waren mit den Worten
von Karl Marx “doppelt frei”: Frei von der Abhängigkeit, aber auch
frei vom Schutz des Grundherrn und jedem Eigentum. Sie wanderten vom
Land in die entstehenden (Industrie-)Städte. Auch viele Handwerker
verloren aufgrund der viel billigeren Preise für Industrieprodukte
ihre Arbeit. Das Überangebot machte Arbeitskraft billig. Die
Lebensbedingungen für die Arbeiter waren in den ersten Jahrzehnten
der Industrialisierung noch schlechter als zuvor: Industriearbeit
war Knochenarbeit und oftmals trostlos (auch diese Folge der
Arbeitsteilung hatte lange vor Karl Marx schon Adam Smith gesehen:
“Jemand, der tagtäglich nur wenige einfache Handgriffe ausführt, die
zudem immer das gleiche Ergebnis ... haben, hat keinerlei
Gelegenheit, seinen Verstand zu üben. ... So ist es ganz natürlich,
dass er so stumpfsinnig und einfältig wird, wie ein menschliches
Wesen nur eben werden kann”); die Städte waren dem Ansturm nicht
gewachsen. Zu beengten Wohnverhältnissen kam noch der Rauch der
Industrie: In Manchester starben 1840 sechs von zehn Kindern, bevor
sie fünf Jahre alt werden konnten – doppelt so viele wie auf dem
Land. Die Löhne reichten gerade zum Überleben, bei Arbeitslosigkeit
– die in Zeiten von Wirtschaftskrisen drei Viertel der Arbeiter
betreffen konnte – hatten die Armen oft nicht genug Geld für
ausreichendes Essen. Da trotzdem immer mehr Menschen aus den
landwirtschaftlich geprägten Gebieten (in denen noch mehr Menschen
hungerten) in die Industrieregionen zogen, konnten die Löhne auf dem
Minimum verbleiben; Frauen und Kinder waren zur Mitarbeit gezwungen
– was die Löhne weiter sinken ließ. Kein Wunder, dass die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz im Zeichen der
sozialen Frage stand.
Aber es gab auch Gewinner – die Unternehmer:
Am Anfang waren es oft Handwerker, die die neuen Techniken
beherrschten; mit zunehmender Größe der Betriebe musste er
handwerkliches Können, kaufmännische und organisatorische Talente
in sich vereinigen – vor allem musste er wissen, wie er die
Arbeiterschaft disziplinieren konnte. (Die Regelmäßigkeit der
Fabrikarbeit war ja etwas Neues – vorher hatten Aufgang und
Untergang der Sonne den Tagesrhythmus bestimmt, jetzt die Uhr; und
zur Durchsetzung der neuen Anforderungen wurden harte Strafen für
kleinste Vergehen in "Fabrikordnungen" festgelegt.) Viele der
Gründer kamen selber aus bescheidenen Verhältnissen, etwa Friedrich
Krupp und Werner von Siemens. Ein Aufstieg wie ihrer wäre vor den
Umbrüchen der industriellen Revolution unmöglich gewesen. In der
Phase des explosiven Wachstums wurden aus kleinen Unternehmen oft
riesige Konzerne: Krupp wuchs von 76 Arbeitern im Jahr 1847 auf
20.000 im Jahr 1887. Das musste auch zu einer Systematisierung von
Unternehmensstrukturen führen: Unternehmen wurden geplant und
erhielten eine hierarchische Struktur.
Eine neue Ökonomie
Unterdessen hatten auch die Wirtschaftswissenschaftler erkannt,
dass die Erkenntnisse der von Adam Smith und Devid Ricardo
begründeten klassischen Ökonomie nicht alle Fragen
beantworten konnten: Der Markt regelte Angebot und Nachfrage nicht
immer perfekt, Kursstürze an den Börsen wie die von 1836/37, 1847
und 1857 (mehr) und
die weiter anhaltende Armut der Arbeiter verlangten nach Antworten.
Der englische Ökonom John Stuart Mill, der 1848
die klassische Ökonomie in seinem Buch "Grundsätze der politischen
Ökonomie” zusammengefasst hatte, forderte, zur “gerechten Verteilung
der Früchte der Arbeit” müsse der Staat dort eingreifen, wo Märkte
nicht funktionieren – etwa beim Eisenbahnbau, wo es Monopole zu
verhindern gälte. Außerdem sollten die unteren Klassen durch Bildung
zu eigenverantwortlichem Handeln ermächtigt werden.
Die von Karl Marx vorhergesagte proletarische Revolution hatte
jedoch nicht stattgefunden (wohl aber waren Gewerkschaften und
sozialistische Parteien entstanden, die auf erheblichen Zuspruch
stießen); ebensowenig war die von Malthus vorhergesagte
Nahrungsmittelknappheit eingetreten. Stattdessen herrschte ein von
den naturwissenschaftlich-technischen Fortschritten inspirierter
Fortschrittsglaube. Auch die Ökonomen versuchten, ihre Arbeit auf
eine vergleichbare "wissenschaftliche" Grundlage zu stellen.
Ergebnis dieser Anstrengungen war die "Grenznutzenschule" der Neoklassiker,
die unabhängig voneinander von Carl Menger in Österreich,
dem in der Schweiz arbeitenden französischem Ökonomen Léon
Walras und den Briten William Stanley Jevons und Alfred
Marshall entwickelt wurden. Menger vermutete, der Wert einer
Ware werde nicht, wie von der Arbeitswerttheorie der klassischen
Ökonomie vermutet, von den Produktionskosten, sondern ihrem Nutzen
bestimmt. Walras, Jevons und Marshall packten diese Idee in
mathematische Gleichungen: Der Nutzen für den Kunden entscheidet
darüber, wie viel dieser für ein Produkt auszugeben bereit ist. Da
der Nutzen um so größer ist, je knapper ein Gut ist und abnimmt, je
mehr es von dem Gut gibt (0003),
wurde hierfür die mathematische "Grenznutzenfunktion" entwickelt.
Umgekehrt sinken bei zunehmender Produktion die Kosten pro Stück,
das wird in der "Grenzkostenfunktion" dargestellt. Diese beiden
Kurven kann man übereinanderlegen: Wenn sich kein Käufer mehr
findet, dem eine Ware ihren Preis wert ist, wird sich die
Produktion so einpegeln, dass die Grenzkosten erreicht werden. Das
System befindet sich in einem "Gleichgewicht" (das die bekannten
Darstellungen von sich schneidenden Angebots- und Nachfragekurven
abbilden).
Das bedeutet aber, dass Waren keinen objektiven (etwa durch die
Produktionskosten bestimmten) Wert mehr haben, sondern der Wert in
Form des Preises durch die vom Grenznutzen bestimmte Nachfrage
bestimmt wird. Diese Überlegung galt für die Neoklassiker für alle
Märkte: so konnte für sie auch nicht von Ausbeutung der Arbeiter die
Rede sein – der Arbeiter erhielt für seine Arbeit den Lohn, der ihm
der Verkauf seiner Freizeit wert war. Wer für den angebotenen Lohn
nicht arbeitet, dem ist schlicht der Genuss seiner Freizeit mehr
wert, Arbeitslosigkeit ist für Neoklassiker also eine freiwillige
Entscheidung. Von Marx' "industrieller Reservearmee" konnte für
die Neoklassiker also keine Rede sein; ohnehin war die Vorstellung
eines "natürlichen Gleichgewichts" zwischen Angebot und Nachfrage
das Gegenmodell zu Marx' Klassenkampf. Aber die Neoklassiker
wussten auch, dass die Umsetzung ihrer Vorstellungen einige
Voraussetzungen hatte, etwa der, dass Kunden den Nutzen eines
Produktes für sich tatsächlich objektiv erkennen konnten (daher die
Vorstellung des Menschen als jederzeit rational handelnder "Homo
oeconomicus"), oder der, dass die Preisbildung vollständig im
Markt erfolgt und nicht z.B. durch Monopole beeinflusst wird. Wenn
es Probleme gibt, liegen diese für Anhänger der neoklassischen
Theorie immer darin, dass ihre Vorstellungen mangelhaft umgesetzt
werden, irgendwelche Hemmnisse also die Bildung eines Gleichgewichts
verhindern. Diese zu beseitigen, ist Aufgabe des Staates.
Mit der Neoklassik wurde die Mathematik in die
Wirtschaftswissenschaft eingeführt; das Los der Arbeiter
verbesserte sich aber vor allem dank politischer Reformen aus Angst
vor der erstarkenden Sozialdemokratie (mehr)
– und der Erkenntnis der Unternehmer, dass sie ihre Arbeiter auch
für den Konsum brauchen. Irgendjemand musste die in großen Mengen
hergestellten Waren ja kaufen; mit diesem Gespür waren die
Unternehmer den Wirtschaftswissenschaftlern voraus, die die
Nachfrage erst später als fundamentalen Faktor begreifen sollten (mehr). Weiter musste man mit der
neoklassischen Theorie auch nicht mehr – wie in der klassischen
Ökonomie – über produktive und unproduktive Tätigkeiten
nachdenken: alles, was bezahlt werden muss, ist per Definition (da
es einen Preis besitzt) wertvoll, sein Entstehungsprozess also
produktiv. Das hat unter anderem Auswirkungen auf die Bewertung von
"Renten": galten sie der klassischen Ökonomie
noch als "unverdientes Einkommen", gibt es solches laut
neoklassischer Theorie nicht mehr: da der Preis den Wert bestimmt,
müssen auch die Einnahmen aus Renten produktiv sein. In der
neoklassischen Ökonomie gelten Renten aber dennoch als Hemmnis für
die Entfaltung eines freien Marktes, da sie den Zugang von
Produzenten und Konsumenten zum Markt erschweren; größere
Auswirkungen hat der neoklassische Wertbegriff bei der Art und
Weise, wie wir unseren Wohlstand messen.
Das Bruttoinlandsprodukt
Der neoklassische Wertbegriff liegt auch modernen Versuchen
zugrunde, den Wohlstand von Staaten zu messen. Zwar war vielen
Ökonomen klar, dass dieses unzureichend ist: 1920 forderte Arthur
Cecil Pigou (ein früherer Student Alfred Marshalls und dessen
Nachfolger als Professor für Politische Ökonomie in Cambridge) in
seinem Buch "The Economics of Welfare", dass auch solche
Aspekte der Wohlfahrt in die Betrachtung einbezogen werden müssen,
die nicht "mit dem Zollstock des Geldes in Beziehung zu bringen"
sind, die wirtschaftliche Wohlfahrt trage zur gesamnten Wohlfahrt
bei, sei aber nicht mit dieser identisch. Praktische Bedeutung
erhielt die Messung des Wohlstands in der Weltwirtschaftskrise:
Pigous Schüler Simon Kuznets schätzte deren Folgen für die
USA ab. Kuznet schloss in seine Berechnungen staatliche Zahlungen an
Haushalte ein, da diese von diesen für den Kauf von Waren ausgegeben
werden konnten, zog von diesen aber wieder einen Anteil ab, der nach
seiner Ansicht nicht zum materiellen Lebensstandard beitrug (z.B.
Gewerkschaftsbeiträge) – womit er durch die Hintertür wieder
zwischen produktiven und unproduktiven Beiträgen unterschied. Andere
Staatsausgaben als direkte Zahlungen Haushalte berücksichtigte er
aber nicht. Das sollte aber nicht so bleiben, denn 1940 machte der
in der Weltwirtschaftskrise zu Einfluss gekommene John
Maynard Keynes in seinem Buch "How to Pay for the War"
einen anderen Vorschlag: da Staatsausgaben, wie die Kriegsproduktion
zeigte, direkt auf die Produktion einwirken können, müssen sie bei
der Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft
berücksichtigt werden.
Keynes Idee setzte sich durch: Um die Berechnungen zu
standardisieren, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg unter der
Schirmherrschaft der Vereinten Nationen ein "System of National
Accounts" (SNA) entwickelt, mit dem Staaten ihre Bruttowertschöpfung,
den "Gesamtwert der im Produktionsprozess erzeugten Waren und
Dienstleistungen (Produktionswert), abzüglich des Werts der
Vorleistungen" ermitteln können, aus dem dann – mit geringfügigen
Korrekturen bezüglich Steuern und Subventionen – das Bruttoinlandsprodukt
(BIP) abgeleitet wird, mit dem die Wirtschaftsleistung von Staaten
berechnet und verglichen wird. Mit der Berechnung sind allerdings
zahlreiche Probleme verbunden, die immer wieder zu Veränderungen im
SNA und damit der Berechnung führen. So klagen etwa Feministinnen
seit langem darüber, dass nicht bezahlte Hausarbeit (und damit ein
erheblicher Teil der von Frauen geleisteten Arbeit) nicht im BIP und
damit bei der Berechnung des Wohlstands berücksichtigt wird. Das
geht auf die Nutzwerttheorie der neoklassischen Ökonomie zurück:
nicht auf dem Markt gehandelte Hausarbeit hat für diese keinen
"Wert". An anderer Stelle wird das Problem aber umgangen: so wird
für von ihren Eigentümern selbst genutzte Häuser – für die sie ja
keine Miete zahlen – eine "unterstellte Miete" angesetzt, damit man
die wirtschaftliche Entwicklung in Ländern mit hohem und niedrigem
Mieteranteil miteinander vergleichen kann. Anderswo verzichtet man
auf internationale Vergleichbarkeit: Prostitution wird etwa nur in
den Ländern – als positiv, da sie Einkommen schafft –
berücksichtigt, wo sie legal ist; in anderen Ländern nicht. Die
Beispiele zeigen, was zum Wohlstand laut BIP beiträgt und was nicht,
ist einfach durch Festlegungen geregelt, die man verstehen kann oder
auch nicht. Ob wirklich – jenseits der neoklassischen Theorie –
Werte geschaffen werden oder nicht, spielt für das BIP keine Rolle.
Für das Thema dieser Seiten zentral: Wenn Umweltverschmutzung kein
Geld kostet, taucht sie (als sogenannte "Externalität") im BIP nicht
auf. Wenn der Verursacher sie beseitigen muss, wird sie zu Kosten,
verringert also das BIP; und wenn – etwa weil der Verursacher nicht
zu ermitteln oder mittlerweile pleite ist – der Staat ein
Unternehmen mit der Beseitigung beauftragt, steigert die
Umweltverschmutzung das BIP. Das ist der Grund, warum ökologische
Ökonomen (und nicht nur die) das BIP für ungeeignet
für die Messung des Wohlstands halten.
Weiter mit:
Chemie, Elektrizität und Auto – Die zweite industrielle Revolution
Zurück zur:
Übersicht Das Zeitalter der Industrie