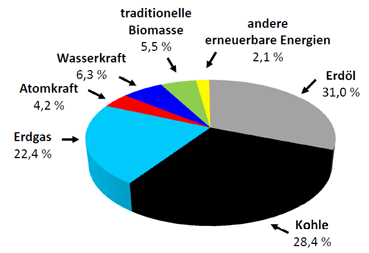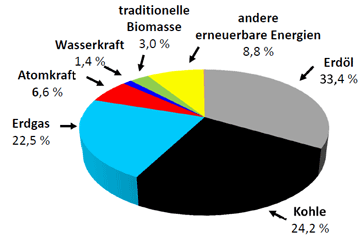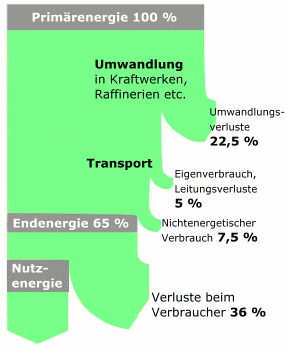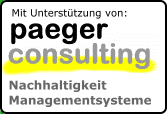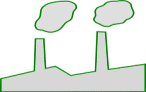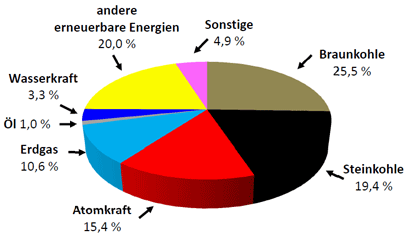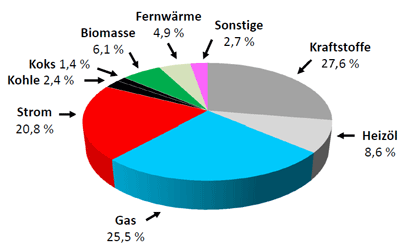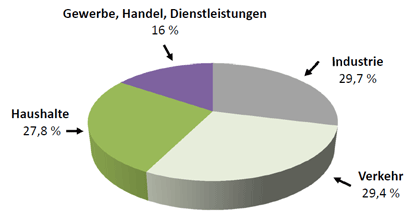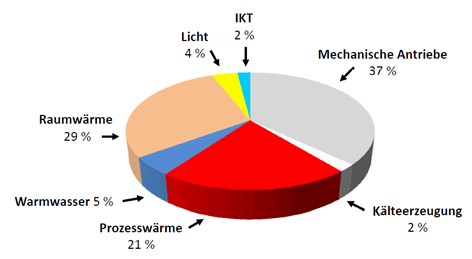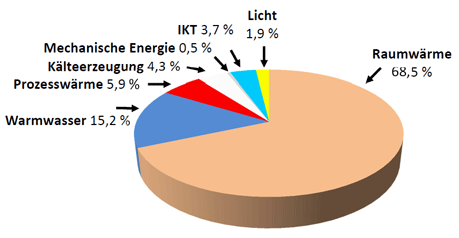Das Zeitalter der Industrie
Energie
Energie ist die Grundlage der modernen
Industriegesellschaft: Weltweit nutzen wir über 13.000 Millionen
Tonnen Erdöläquivalent im Jahr. Ein Bewohner Deutschlands verbraucht
im Schnitt 131 kWh/Tag, dies entspricht 4,1 Tonnen Erdöläquivalent
pro Jahr, an Primärenergie. Der größte Teil davon wird über die
Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugt, die die Luft verschmutzen
und die wichtigste Ursache für den Klimawandel sind. Außerdem sind
fossile Brennstoffe endlich - umso tragischer, dass die meiste
Energie verschwendet wird.

Kohlekraftwerk Scholven. Mit der Nutzung von Kohle
begann die industrielle Revolution;
die Verbrennung von Kohle ist die wichtigste Ursache für den
Klimawandel. Foto: Sebastian
Schlüter, aus wikipedia (Lizenz: >>
GNU FDL 1.2)
Die Geschichte der Menschheit ist (bisher) eine Geschichte immer
weiter zunehmenden Energieverbrauchs; und die Industrielle
Revolution beschleunigte diese Entwicklung um >> ein
Vielfaches. Am Anfang der Industriellen Revolution stand die
>>
Kohle, und damit der Übergang von nachwachsenden auf
fossile Brennstoffe. Die Nutzung der Kohle - und später
weiterer fossiler Brennstoffe wie >> Öl
und Gas - vervielfachte die Kraft und die Möglichkeiten der
Menschheit; fossile Brennstoffe trugen entscheidend dazu bei, dass
sich der materielle Wohlstand im reichen Teil der Welt
vervielfachte: Sie ermöglichten die Herstellung von Kunstdüngern und
Maschinen, die auf den Feldern die menschliche und tierische
Arbeitskraft und organische Dünger ablösten; trieben die Maschinen
in den Fabriken an und ermöglichten so den rapide anwachsenden
Ausstoß an Gütern; waren Energiequelle für Eisenbahnen, Autos und
Flugzeuge und veränderten so das Leben der Menschen. Mit der
Umwandlung fossiler Brennstoffe in die vielseitige Energieform Strom
wurden auch die Informations- und Kommunikationstechnologien und die
automatisierten Produktionsprozesse möglich, die die moderne Welt
ausmachen.
Die Nutzung fossiler Brennstoffe schuf aber auch eine neue
Dimension von Umweltveränderungen. Die erste war die >>
Luftverschmutzung. Hohe Schornsteine erwiesen sich als
Scheinlösung - sie verursachten “Sauren Regen” weitab der
Industriegebiete; aber Filter und der Übergang von Kohle zu Öl und
Gas bei den Hausheizungen haben das Problem zumindest in den
Industrieländern deutlich reduziert. Weltweit bleibt es akut, in
Peking ist heute die Luft so schlecht wie 1960 im Ruhrgebiet. Und
wir wissen heute, dass das unsichtbare Treibhausgas Kohlendioxid aus
der Verbrennung fossiler Brennstoffe eine Hauptursache für den
>> Klimawandel
ist. Die Entstehung von Kohlendioxid bei der Verbrennung ist
unvermeidbar, der Kohlenstoff im Brennstoff reagiert mit Sauerstoff
zu Kohlendioxid. Dazu kommt, dass fossile Brennstoffe nicht
unendlich zur Verfügung stehen; insbesondere beim Öl werden die
Stimmen immer lauter, die den >> Höhepunkt
der Ölförderung als bald bevorstehend oder gar erreicht sehen.
Diese Endlichkeit betrifft auch die Brennstoffe für die Atomenergie,
die zudem ihre eigenen >> Risiken
mit sich bringt; weshalb im letzten Jahrzehnt zunehmend in >>
erneuerbare Energieträger
investiert wurde.
Energieerzeugung weltweit und in Deutschland
Im Jahr 2013 betrug der weltweite Primärenergieverbrauch
13.497 Millionen Tonnen Erdöläquivalent, wenn
selbst gesammeltes Brennholz oder Wärmeerzeugung mit
Sonnenkollektoren zur Erwärmung des Wassers im eigenen Haus mit
betrachtet werden (700).
An diesem weltweiten Energieverbrauch hatte Öl einen Anteil von
4.185 Millionen Tonnen, Kohle von 3.827 Millionen Tonnen
Erdöläquivalent (Mtoe) und Gas von 3.020 Mtoe, die fossilen
Brennstoffen Öl, Kohle und Gas trugen also mit über vier Fünfteln
zur Energieerzeugung bei. Wasserkraftwerke produzierten 856 Mtoe,
der Beitrag der Atomenergie betrug 563 Mtoe (siehe aber hierzu die
Anmerkung >>
hier), traditionelle Biomasse hatte mit geschätzt 747 Mtoe
einen Anteil von 5,5 Prozent und kommerziell gehandelte andere
erneuerbare Energiequellen wie Strom aus Wind, Sonne oder Erdwärme
trugen mit 279 Mtoe oder 2,1 Prozent zur weltweiten
Energieversorgung bei.
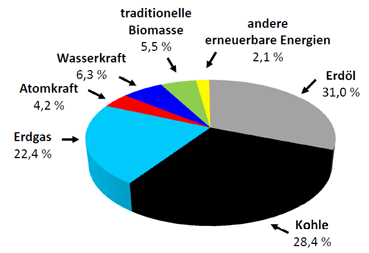
Primärenergieträger des globalen
Energieverbrauchs 2013.
Eigene Abbildung, Erläuterung der Zahlenbasis >> hier.
In Deutschland betrug der Primärenergieverbrauch im Jahr 2013
335,6 Millionen Tonnen Erdöläquivalent (701);
damit hatten wir einen Anteil von 2,5 Prozent am
globalen Verbrauch (bei einer Bevölkerungszahl, die knapp 1,2
Prozent der Weltbevölkerung entspricht - ein durchschnittlicher
Deutscher verbraucht also mehr als doppelt so viel Energie wie der
durchschnittliche Weltbürger). Und so sah unser "Energiemix" im Jahr
2013 aus:
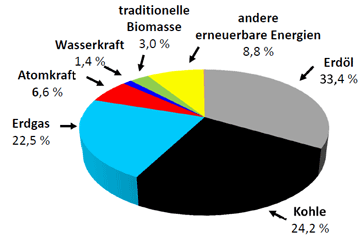
Primärenergieträger des deutschen
Energieverbrauchs 2013.
Eigene Abbildung, Erläuterung der Zahlenbasis >> hier.
Die meiste Energie geht verloren
Angesichts der Endlichkeit fossiler Brennstoffe und der
Umweltfolgen ihrer Verbrennung erscheint es unglaublich, aber der
größte Teil dieser Energie wird gar nicht genutzt. Weltweit werden
(nach den “Key Energy Statistics 2010” der Internationalen
Energieagentur) nur gut zwei Drittel der Primärenergie als Endenergie
genutzt, fast ein Drittel gehen verloren (in Deutschland betragen
die Umwandlungs- und Leitungsverluste “nur” 30 Prozent). Betrachtet
man dann von die Verluste bei den Verbrauchern, werden (auch in
Deutschland) weniger als ein Drittel der eingesetzten
Primärenergie tatsächlich genutzt, wie das folgende
beispielhafte "Energieflussbild" zeigt.
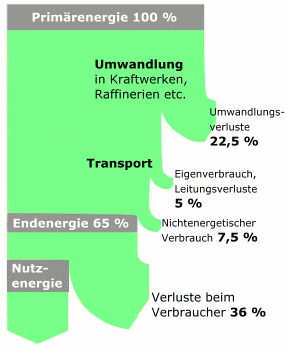
Energieflussbild für die Bundesrepublik
Deutschland. Verschiedene Quellen.
Energieverluste entstehen, wie die Abbildung zeigt, sowohl bei der
Erzeugung und Verteilung der Energie als auch beim Endverbraucher.
Bei der Erzeugung wird die in Primärenergieträgern
wie Kohle, Erdöl, Erdgas, Wind und Sonnenstrahlen steckende Primärenergie
in Kraftwerken, Raffinerien etc. in Sekundärenergieträger
umgewandelt und über das Stromnetz, das Tankstellennetz etc.
verteilt, bis sie als Endenergie an die
Verbraucher geliefert wird. Bei dieser Umwandlung und der
anschließenden Verteilung geht bereits viel Energie verloren:
In Deutschland waren das im Jahr 2011 30,1 Prozent (702)
- vom damaligen Primärenergieverbrauch von 323 Mtoe blieben nach
Abzug des "nichtenergetischen Verbrauchs" (etwa Öl, das als Rohstoff
bei der Plastikproduktion verwendet wird) 299 Mtoe, aber als
Endenergie standen nur 209 Mtoe zur Verfügung.
Diese Verluste sind zu einem großen Teil unvermeidbar: Bei der
Erzeugung von Strom in Wärmekraftwerken kann nur ein bestimmter
Anteil der in den Brennstoffen enthalten Energie in Strom
umgewandelt werden (warum das so ist, steht hier: >> Die
Qualität der Energie).
Noch immer wird ein großer Teil unseres Stroms in Wärmekraftwerken
erzeugt:
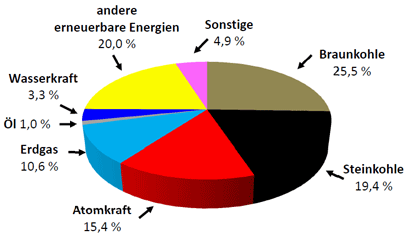
Energieträger der Stromerzeugung
in Deutschland 2013. Quelle: Eigene Grafik
nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Anm.),
Stand Juni 2014.
Braunkohle, Atomenergie, Steinkohle, Erdgas und Erdöl sowie
Biomasse erzeugen Strom in Wärmekraftwerken, deren
durchschnittlicher energetischer Wirkungsgrad in Deutschland 39
Prozent beträgt. Bei direkt erzeugtem Strom fallen diese Verluste
dagegen >>
nicht an. Die direkte Stromerzeugung erfolgt mittels
Wasserkraft, Windkraft (8,5 Prozent der Stromerzeugung) und
Photovoltaik (4,8 Prozent der Stromerzeugung) und macht inzwischen
bereits über 16 Prozent der Stromerzeugung aus; zusammen mit
Biomasse (6,7 Prozent der Stromerzeugung tragen erneuerbare
Energieträger mit 23,3 Prozent zur Stromerzeugung bei (703).
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz: Ein
Erfolgsmodell
Der schnell wachsende Anteil erneuerbarer Energien insbesondere an
der Stromerzeugung hat eine Ursache: Das (auf dem
Stromeinspeisungsgesetz von 1991 aufbauende)
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) aus dem Jahr 2000 (mehr: >>
Die Energiewende). Es sichert Strom
aus erneuerbaren Quellen einen Vorrang vor Atomstrom und fossilem
Strom bei der Einspeisung, und es garantiert den Erzeugern einen
festgelegten (von der Art der Energieerzeugung abhängigen) Preis.
Die Mehrkosten hierfür werden auf die Verbraucher umgelegt (nur
eingeschränkt bei stromintensiven Industrien oder Schienenbahnen).
Von 2000 bis 2009 hat das EEG Investitionen in erneuerbare Energien
in Höhe von 96 Milliarden Euro ausgelöst, die zu dem oben genannten
Anteil von über 23 Prozent an der Stromerzeugung führten.
Damit wurde das EEG so erfolgreich, dass es grundsätzliche
Interessen der Stromwirtschaft in Frage stellt (>>
hier), die - obgleich selbst nur durch ihre einstige
Monopolstellung zu Stärke gelangt - eine Marktverzerrung beklagt
(wobei sie freilich verschweigt, dass sie die externen Kosten der
fossilen und atomaren Stromerzeugung nicht zu tragen braucht, das
>> "größte
Marktversagen der Geschichte" (Sir Nicolas Stern). Tatsächlich
ist der transparent ausgewiesene Mehrpreis für erneuerbare Energien
geringer als die - freilich gut versteckten - Umweltkosten von Kohle
und Atom; sowohl volkswirtschaftlich als auch energiepolitisch -
Emissionsvermeidung, Nutzung heimischer Energiequellen - ist das EEG
ein Gewinn.
Siehe auch: >> Das
Märchen vom teuren Ökostrom.
Welche Endenergieträger in Deutschland nach der
Umwandlung an die Endverbraucher geliefert werden, zeigt die
folgende Abbildung:
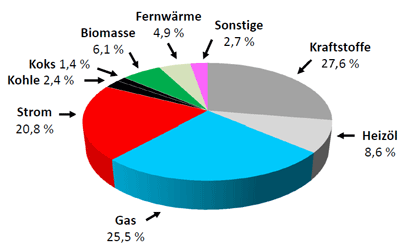
Endenergieträger in
Deutschland 2012. Hinter “Sonstige” verbergen sich z.B. Müll und
Klärschlamm.
Eigene Grafik nach Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (704), Stand
Juli 2013.
Wo und wofür wir Energie einsetzen
Beim Endverbraucher sieht es bezüglich der
Effizienz noch schlechter aus: hier geht insgesamt mehr
Energie verloren als genutzt wird. Auch sind hier die Gründe weniger
komplex als etwa in einem Wärmekraftwerk: Meist liegt es einfach an
schlecht durchdachter oder veralteter Nutzungstechnik. Die
Endenergie wird in vier Sektoren eingesetzt, die die folgende
Abbildung darstellt:
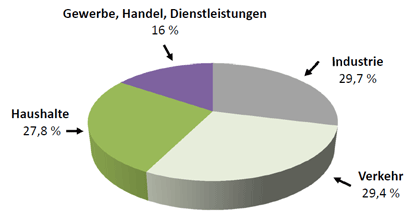
Sektoren des Energieverbrauchs
in Deutschland in 2012. Eigene Grafik, Datenquelle (705).
Auch beim Endverbrauch spielt die >> Energiequalität
eine Rolle: der Endenergieträger sollte dem Bedarf möglichst gut
angepasst sein. Verbraucher nutzten Endenergie,
um Wärme (Raumwärme, Warmwasser, industrielle Prozesswärme, in
Deutschland insgesamt 55 Prozent der Endenergie - 34 Prozent
Raumwärme und Warmwasser, 21 Prozent Prozesswärme), mechanische
Energie (Antrieb von Autos, Elektromotoren etc., 37 Prozent der
Endenergie) oder Licht (4 Prozent der Endenergie) zu erzeugen:
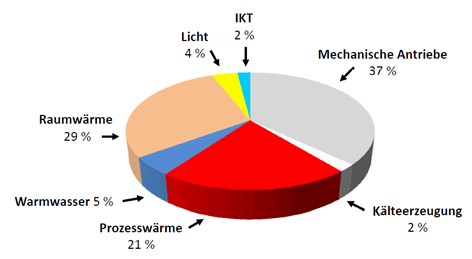
Anwendungsbereiche der Endenergie
in Deutschland 2012. IKT steht für
Informations- und Kommunikationstechnik. Eigene Grafik, Datenquelle
(702).
Der Verwendungszweck hängt aber auch vom jeweiligen Verbraucher ab:
Raumwärme und Warmwasser werden
in erster Linie (insgesamt zu etwa zwei Dritteln) in privaten
Haushalten gebraucht, der Rest in Gewerbe, Handel und Bürogebäuden
und in der Industrie; Prozesswärme wird vor allem
für industrielle Prozesse wie Schmelzen, Trocknen, Härten und Kochen
benötigt. Mechanische Energie wird zum größten
Teil im Verkehr genutzt, aber auch in großem Umfang in Industrie und
Gewerbe.
Die Zuordnung von Energieträgern und Nutzungsform ist nicht
eindeutig: Raumwärme und Warmwasser können etwa durch Fernwärme,
Sonnenkollektoren, Gas und Heizöl oder Strom erzeugt werden,
industrielle Prozesswärme wird meist durch Steinkohle, Gas und Strom
und mechanische Energie durch Strom (für den Antrieb von Motoren und
Pumpen, Drucklufterzeugung etc. in Industrie und Gewerbe) und
Kraftstoffe (Verkehr) erzeugt.
Dass die Anwendungsbereiche in den einzelnen Sektoren deutlich vom
Durchschnitt abweichen, zeigt das folgende Beispiel der privaten
Haushalten:
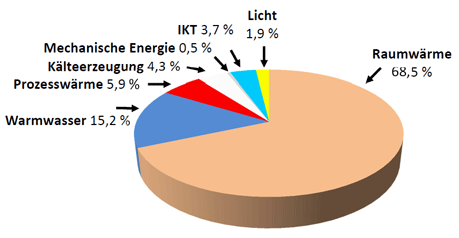
Endenergieanwendung in privaten
Haushalten in Deutschland in 2012.
Eigene Grafik, Datenquelle (705).
Der
Energieverbrauch eines Bundesbürgers
- eine Überschlagsrechnung
Der deutsche Primärenergieverbrauch von
335,6 Millionen Tonnen Erdöläquivalent im Jahr 2013 entspricht
bei knapp 82 Millionen Einwohnern einem Primärenergieverbrauch
pro Einwohner von 131 kWh/Tag
(wie man diese Einheiten ineinander umrechnen kann, steht auf der
Seite >> Energie
und ihre Einheiten). Die Umwandlungs- und Leitungsverluste
betragen rund 30 Prozent, so dass jedem Bundesbürger rund 92
kWh/Tag an Endenergie bleiben. Dem Anteil der Haushalte
hieran beträgt 27,8 Prozent, also 25,6 kWh/Tag,
Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen verbrauchen zusammen
je Einwohner 42 kWh/Tag und der Verkehr 27 kWh/Tag.
Bleiben wir zunächst beim direkten Energieverbrauch in den
Haushalten. Den größten Anteil machen Heizung und Warmwasser aus:
Für jeden Einwohner 21,4 kWh/Tag (etwa 17,5 kWh
Heizwärme und 3,7 kWh Warmwasser). Die wichtigsten dafür verwendeten
Energieträger sind Gas (mit einem Anteil von umgerechnet 9,5
kWh/Tag) und Heizöl (5,3 kWh/Tag; alle Daten, die nicht bereits oben
genannt wurden, wurden aus Angaben in [705]
errechnet). Aus dem Heizwärmebedarf und der durchschnittlichen
Wohnfläche von 40 m²/Einwohner lässt sich ausrechnen, dass der
durchschnittliche Heizwärmebedarf bei 160 kWh pro Jahr und m²
Wohnfläche lag. Renovierungsbedürftige Altbauten können über 300
KWh/m² liegen, ein 150 m²-Haus verbraucht dann 4.500 Liter Heizöl im
Jahr. Für Neubauten ist in Deutschland ein Wert von 100 kWh
vorgeschrieben, in der Schweiz von 42 kWh. Der Stromverbrauch in
Haushalten beträgt je Einwohner 5,2 kWh/Tag -
damit werden Haushaltsgeräte (Elektroherd, Waschmaschinen, Trockner,
Kühl- und Gefriergeräte, ...) und Unterhaltungselektronik
(Fernseher, Computer, ...) betrieben sowie Licht, in manchen
Haushalten auch Heizwärme und Warmwasser, erzeugt.
Der nächste große Posten ist das Auto: Ein durchschnittlicher
Autofahrer, so hat ein >>
Rechenbeispiel ergeben, verbraucht alleine an Treibstoff 21,6
kWh/Tag. Da in Deutschland auf 81,9 Millionen Menschen
etwa 41 Millionen Autos kommen, das heißt 1 Autofahrer auf 2
Einwohner, entspricht dies je Einwohner 10,8 kWh/Tag.
Der Energieverbrauch im Verkehr verteilte sich im Jahr 2010 (Daten:
[706]) zu 71,1
Prozent auf den Personen- und zu 28,9 Prozent auf den Güterverkehr;
auf den Personenverkehr entfallen also 19,2
kWh/Tag, und davon 15,7 kWh auf die
Straße (und da die in der Quelle nicht gesondert ausgewiesenen Busse
kaum ein Drittel des Treibstoffverbrauchs ausmachen dürften, zeigt
dies, liegt der tatsächliche Treibstoffverbrauch des
durchschnittlichen Autofahrers offenbar höher als in der
Beispielsrechnung angenommen),
0,91 kWh/Tag auf die Bahn und 2,6 kWh/Tag
auf den Flugverkehr. Zum Vergleich: Eine einzige Fernreise im Jahr
entspricht einem Verbrauch von bis zu 30 kWh/Tag, also mehr, als ein
durchschnittlicher Autofahrer im Jahr verbraucht. Ein
Mittelstreckenflug, etwa Düsseldorf - Málaga, im Jahr entspricht gut
3 kWh/Tag. Auf den Güterverkehr entfallen 7,8
kWh/Tag, davon 6,3 kWh pro Tag auf den Straßenverkehr und
1 kWh/Tag auf den Flugverkehr.
Energie steckt aber auch in den Produkten, die wir kaufen: dies sind
die 42 kWh/Tag, die Industrie, Gewerbe, Handel und
Dienstleistungen je Einwohner verbrauchen. Diese Energie ist der
>> "Energierucksack"
der Produkte. Zugegeben: Die Gleichsetzung ist ungenau - ein Teil
der deutschen Industrieproduktion wird ja exportiert. Aber
andererseits kaufen wir auch importierte Produkte; wir gehen für
diese Überschlagsrechnung einfach mal davon aus, dass sich beide
Werte etwa ausgleichen. Ein Beispiel: Wer alle drei Jahre einen PC
kauft, “verbraucht” damit schon 11,6 kWh/Tag. Wie
solche Werte zustande kommen, zeigt das folgende Beispiel eines
Autos.
Wie viel Energie verbraucht ein Auto wirklich?
Wenn Sie den gesamten Energieverbrauch ihres Autos berechnen
wollen, wird die Rechnung von etwas komplizierter: Da bereits die
Ölförderung, der Öltransport in die Raffinerie, die Herstellung von
Benzin und dessen Verteilung an die Tankstellen Energie kosten,
müssen die Verbrauchswerte für eine vollständige Bilanz mit 1,4
multipliziert werden. Der durchschnittliche Autofahrer verbraucht
bei Berücksichtigung des Energieaufwands der gesamten
Erzeugungskette also 21,6 x 1,4 = 30,2 kWh/Tag.
Dazu kommt der Energieaufwand für die Herstellung des Autos. Hierzu
ist mir keine nachvollziehbare Untersuchung bekannt, die wirklich
alle Vorstufen berücksichtigen; die Angaben schwanken von 10 bis 15
Prozent des Treibstoffverbrauchs (also 3 bis 4,5 kWh/Tag) bis zu
76.000 kWh (Treloar et al. 2004, zitiert nach >> MacKay;
bei einer Lebensdauer des Autos von 15 Jahren wären dies von 13,8
kWh/Tag. So lange wir es nicht besser wissen, müssen wir mit dieser
Ungenauigkeit leben, ein durchschnittliches Auto bräuchte also
insgesamt etwa 33 bis 44 kWh/Tag. Dazu käme noch
die Energie, die für die Infrastruktur (Straßenbau etc.) gebraucht
wird. Nur der direkte Treibstoffverbrauch und die Transporte finden
sich in der Statistik unter “Verkehr”, die anderen Beiträge werden
unter Gewerbe und Industrie verbucht (bzw., wenn sie wie die
Energiekosten der Ölproduktion im Ausland stattfinden, in der
deutschen Statistik überhaupt nicht berücksichtigt oder in unserem
Rechenbeispiel oben mit den deutschen Exporten “verrechnet”).
Wie energieeffizient ist ein Auto?
Aufschlussreich ist übrigens auch die Nutzung des
direkten Treibstoffverbrauchs in einem Auto: Etwa 88 Prozent
produziert Wärme - den größten Teil der Motor (von der ein winziger
Anteil für die Heizung des Innenraums genutzt wird), aber auch die
Bremsen und das Kraftübertragungssystem, 12 Prozent werden zur
Fortbewegung des Autos genutzt. Da ein Auto heute im Schnitt 1.500
Kilogramm wiegt und der (es überwiegend allein nutzende) Fahrer 75
Kilo, werden nur 0,6 Prozent der Energie für den
eigentlichen Zweck, den Transport des Fahrers,
verwendet.
Der Energieverbrauch der Landwirtschaft
wird auf >>
15 kWh/Tag geschätzt. Dazu kommt noch der Energieaufwande der
Ernährungsindustrie von 1,9 kWh/Tag, so dass
unsere Ernährung insgesamt etwa 17 kWh/Tag an
Energie verbraucht (wobei etwa 10 kWh nicht in der bundesdeutschen
Statistik auftauchen, da sie etwa beim Sojaanbau oder der
Rinderzucht im Ausland verbraucht werden).
Mehr zum Thema Energie auf diesen Seiten:
>> Energie
und ihre Einheiten
>> Eine
kleine Geschichte des menschlichen Energieverbrauchs
>> Eine
kleine Geschichte des Erdöls
>> Das
Ende des billigen Öls
>> Eine
kleine Geschichte der Atomenergie
>> Energiewende
Webtipps
>>
Grundlagen auf der Seite >> “Regenerative
Zukunft”
Strategien für die Zukunft:
>> Saubere
Energie
Weiter mit:
>> Die
Gefährdung der Böden