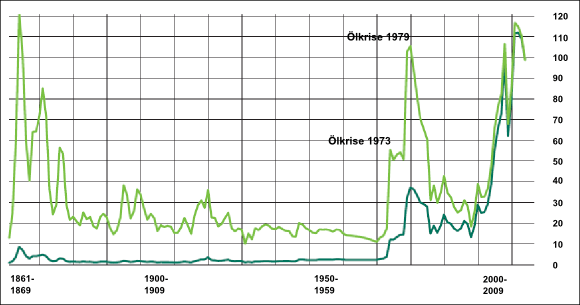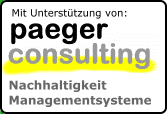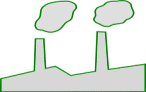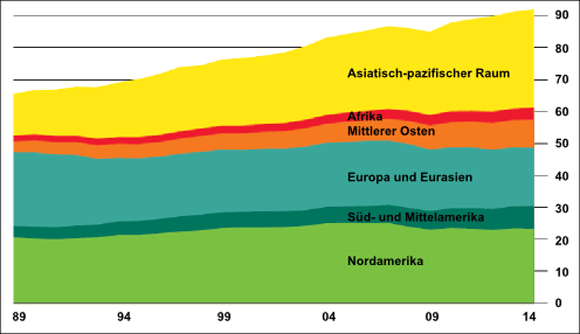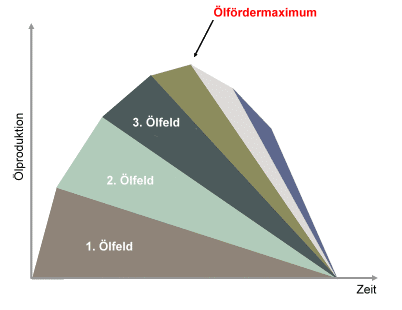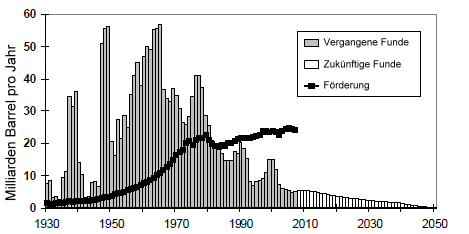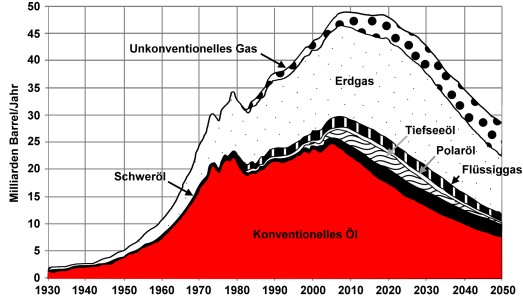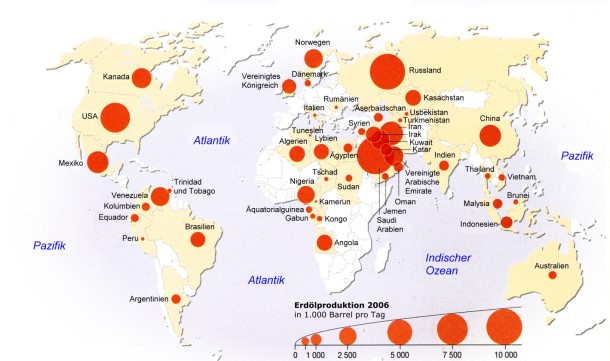Das Zeitalter der Industrie
Das Ende des billigen Öls
und andere gute Gründe,
warum wir weniger Öl verbrauchen sollten
Erdöl gilt als Lebenssaft der
Industriegesellschaft: weltweit ist er mit einem Anteil von 31
Prozent vor Kohle und Erdgas der wichtigste Energieträger. Der
weltweite Ölverbrauch steigt immer noch jedes Jahr. Der Preis dafür
ist hoch: nicht nur finanziell (die Zeit des billigen Öls ist bei
allen Preisschwankungen wohl vorbei), sondern wir bezahlen auch mit
politischer Erpressbarkeit, Ölförderung in immer sensibleren
Ökosystemen und mit immer problematischeren Fördermethoden.
Im Jahr 2014 wurden auf der Erde jeden Tag ca. 92,1 Millionen
Barrel Öl verbraucht, das war gegenüber dem Vorjahr 2013 ein
Anstieg um 0,9 Prozent. Die Produktion lag mit 88,7 Millionen
Barrel/Tag deutlich unter dem Verbrauch (300),
stieg aber gegenüber dem Vorjahr um 2,3 Prozent, also stärker als
der Verbrauch. Das lag unter anderem am mittels Fracking gewonnenen
amerikanischen >> "Schieferöl", das im
dritten Jahr in Folge die amerikanische Ölproduktion um mehr als
eine Million Barrel am Tag ansteigen ließ und damit die USA vor
Russland und Saudi-Arabien zum weltgrößten Ölproduzenten machte.
Alleine die Mehrproduktion an amerikanischem "Schieferöl" übertraf
im Jahr 2014 den weltweiten Verbrauchsanstieg, der vor allem
aufgrund des Strukturwandels in China langsamer ausfiel als in den
Vorjahren, und trug damit zu einem fallenden Ölpreis bei, der zum
ersten Mal seit 2010 wieder unter 100 US-Dollar im Jahresschnitt lag
(und seither weiter gefallen ist).
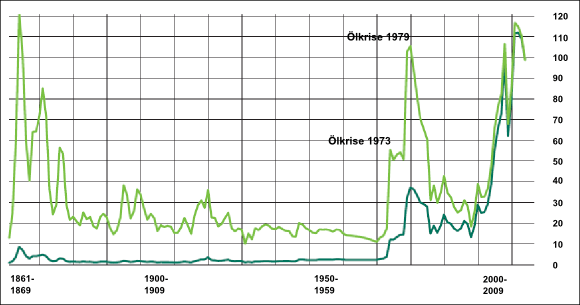
Ölpreise von 1861-2014
(dunkelgrün: US-$ zum Tageskurs, hellgrün: US-$ 2014, also
inflationsbereinigt). Der Ölpreis betrug im Jahr 2010
durchschnittlich 98,95 US-$. Nach BP Weltenergiestatistik, Juni
2015.
Der fallende Ölpreis liegt nicht nur an amerikanischem "Schieferöl"
und einer langsamer steigenden Nachfrage (die nicht am
Strukturwandel in China, sondern auch an einer weltweit langsamer
wachsenden Wirtschaft liegt). Auch im Irak und in Syrien ist, der
IS-Miliz und dem Bürgerkrieg zum Trotz, die Produktion im Jahr 2014
gestiegen - die Kriegsparteien brauchen allesamt das Geld aus der
Ölproduktion, um den Krieg zu finanzieren. Noch wichtiger für den
fallenden Ölpreis ist aber die Rivalität zwischen dem Iran und
Saudi-Arabien, die beide um Einfluss im Nahen Osten und um Ölmärkte
kämpfen. So kämpfen beide mit Dumpingpreisen um Marktanteile in
China, das als der Exportmarkt im 21. Jahrhundert gilt.
Nur so konnte der Preis auf ein Niveau fallen, der weit unter dem
liegt, der in den USA für eine profitable Schieferölproduktion sorgt
(der liegt bei rund 70 US-$/Barrel).
Diese Situation muss aber nicht anhalten. Bei steigender Nachfrage
könnte schnell wieder wirksam werden, worauf die
Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem
Weltenergiebericht 2014 hingewiesen hat: dass angesichts einer
relativ kleinen Anzahl von Erzeugern die Versorgungssicherheit
weiterhin ein Thema bleibt. Wie dauerhaft der amerikanische
Schieferölboom ist, ist umstritten, die IEA geht davon aus, dass
bereits um 2020 die Schieferölproduktion wieder zu sinken beginnt.
Ein weiteres Problem entsteht durch die sinkenden Preise:
Investitionen in zukünftige Ölförderung lohnen sich bei den
gegenwärtigen Preisen nicht; und dazu ist weder die politische Lage
im Nahen Osten noch Russland sonderlich investitionsfördernd - wenn
nicht Investitionen ohnehin durch Sanktionen erschwert werden. Die
Zeiten vergleichsweise niedriger Ölpreise dürften also mittelfristig
wieder zu Ende gehen, die IEA sieht nach 2020 neue Bedrohungen auf
die Ölversorgung zukommen.
Ölpreis: Welche Rolle spielen Spekulanten?
Der Einfluss von Spekulanten auf den Ölpreis ist
umstritten: Die einen glauben, dass es ihn gar nicht gibt -
Spekulanten handelten ja nicht mit Öl, sondern nur mit Verträgen.
Wenn sie etwa überzeugt sind, dass Öl in Zukunft teurer wird, kaufen
sie zukünftige Liefermengen, um diese später teurer verkaufen zu
können. Vor der Lieferung müssen sie aber die Verträge zum
tatsächlichen Marktwert weiterverkaufen, sie könnten mit dem Öl ja
nichts anfangen. War ihre Einschätzung richtig, haben sie Geld
verdient. Der Haken an dieser Theorie: Hätte dieser Handel keinen
Einfluss auf den Preis hätte, würden die Spekulanten an diesem
Geschäft im Durchschnitt auch nichts verdienen. Dann wäre der Umfang
der Spekulation nur schwer erklärlich. Tatsächlich hat der Preis
auch eine psychologische Komponente, und Käufe oder Verkäufe großer
Mengen Öl können den Preis wohl doch beeinflussen. Die meisten
Ökonomen glauben daher, dass die Spekulation die Ausschläge des
Ölpreises verstärkt: Schlechte Nachrichten lassen den Preis über
Gebühr ansteigen, gute Nachrichten über Gebühr fallen. Die
grundsätzliche Richtung des Ölpreises wird aber nicht von den
Spekulanten, sondern von realen Gegebenheiten bestimmt.
Der Ölverbrauch steigt weiter
Nach den Theorien der Wirtschaftswissenschaftler hätten hohe
Ölpreise eigentlich zu sinkenden Verbräuchen führen sollen - das war
aber auch den Jahren 2010 bis 2013 nicht der Fall. In der Praxis ist
der Ölverbrauch wenig “elastisch”: Anpassungen brauchen ihre Zeit -
zwar kann man leicht die Raumtemperatur absenken und öfter Bahn
fahren, aber die Isolierung von Häusern, der Austausch von
Heizungssystemen und der Ersatz spritschluckender Autos gehen nicht
so schnell. Einen leichten Rückgang des Ölverbrauchs gab es in
Europa und in Nordamerika, weltweit stieg er aber. Das lag, wie die
Abbildung unten zeigt, vor allem am asiatisch-pazifischen Raum.
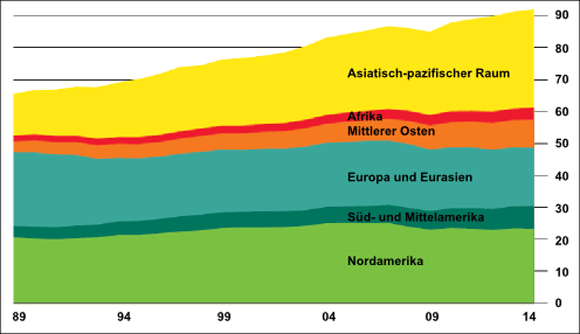
Ölverbrauch von 1989 bis
2014 nach Regionen (in Mio. Barrel/Tag). Abb. aus BP
Weltenergiestatistik, Juni 2015, eigene Übersetzung.
Dabei spielen die aufstrebenden Schwellenländer China und Indien in
absoluten Mengen eine besonders wichtige Rolle: steigender Wohlstand
und die damit einhergehende Motorisierung sind die wichtigste
Triebkraft dieser Entwicklung. China beispielsweise ist inzwischen
der weltgrößte Automarkt der Welt. Dass der chinesische Ölverbrauch
im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr "nur" um 3,3 Prozent stieg
(gegenüber Steigerungsraten von über 10 Prozent in den Vorjahren,
etwa 2010), hat zum Preisrückgang ab 2014 erheblich beigetragen. Bis
zum Jahr 2030 könnte er sich aber vervierfachen (so das
Referenzszenario 2007 der Internationalen Energieagentur). Auch in
Indien ist Treibstoff der Sektor, in dem die Nachfrage am stärksten
wächst, in Indien (wie auch in Bangladesch) ist Öl zudem in der
Landwirtschaft unverzichtbar: Millionen Bauern bewässern ihre Felder
mit dieselbetriebenen Pumpen. Daneben stieg auch der Verbrauch in
den nach wie vor reichen Produktionsländern im Mittleren Osten (im
Jahr 2014 um 7,3 Prozent in Saudi Arabien, um 8,6 Prozent in den
Vereinigten Arabischen Emiraten), während in Russland die
Wirtschaftskrise zu einer schwächeren Steigerung (2014 0,9 Prozent,
gegenüber 9,2 Prozent im Jahr 2010) führte.
Am Beispiel der USA, wo fünf Prozent der Weltbevölkerung 20 Prozent
des Öls verbrauchen, zeigt sich die typische Entwicklung in den
reichen Industrieländern deutlich: nachdem die Ölkrisen der 1970er
Jahre vergessen waren, stieg der Durchschnittsverbrauch
amerikanischer Autos wieder; und da 70 Prozent des amerikanischen
Öls in den Verkehr gehen, stieg auch der Ölverbrauch des Landes –
seit Mitte der achtziger Jahre um 25 Prozent. Erst mit dem hohen
Ölpreis und Programmen zur Förderung von Biotreibstoffen begann er
ab 2006, langsam wieder zu sinken (und, aufgrund der mit sinkenden
Ölpreisen wieder steigenden Nachfrage nach großen SUV und Pick-Ups
zu vermuten, dürfte 2015 wieder steigen). In den OECD-Ländern
insgesamt sank der Verbrauch im Jahr 2014 um 1,2 Prozent; in
Deutschland um 1,7 Prozent. Die insgesamt bescheidenen Rückgänge in
den reichen Industrieländern und die Aufholjagd der Schwellenländer
summieren sich: Aus den 92,1 Millionen Barrel täglichen Ölverbrauch
könnten so bis zum Jahr 2035 99 Millionen Barrel werden, schätzte
die Internationale Energieagentur in ihrem Weltenergiebericht 2010
(und das bereits unter Berücksichtigung der ergriffenen Maßnahmen
zur Bekämpfung des >> Klimawandels,
zuvor - im Weltenergiebericht 2006 - hielt sie sogar einen Verbrauch
von 116 Millionen Barrel/Tag im Jahr 2030 für möglich, siehe auch
>> hier).
Wie viel Öl liegt noch in der Erde?
Für die mittel- und langfristige Entwicklung des Ölpreises ist -
neben unabsehbaren politischen Entwicklungen - entscheidend, welche
Reserven der vorhergesehenen Verbrauchssteigerung entgegenstehen.
Dabei sagt die oft verwendete “statische Reichweite” (das Verhältnis
der Reserven zum Verbrauch, zur Zeit auf 40 Jahre geschätzt) wenig
aus, wenn der Verbrauch weiter ansteigt; und auch die Angaben
zu den Reserven selbst sind mit Vorsicht zu betrachten:
Sie stammen entweder von den Förderstaaten, die sie möglicherweise
aus politischen Gründen manipulieren (bei den Mitgliedsstaaten der
OPEC beispielsweise hängt die Förderquote von den Reserven
ab), oder von Ölfirmen, die an ihren Aktienkurs denken müssen.
Unabhängige, geprüfte Angaben zu Reserven gibt es nicht. Dazu kommen
unterschiedliche Verwendungen des Begriffs, so unterscheiden sich
nachgewiesene Reserven (die beim aktuellen Ölpreis mit einer
Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent gefördert werden können) von
wahrscheinlichen Reserven (Förderwahrscheinlichkeit 50 Prozent) (301). Mancher
Zuwachs in der Statistik kommt nur daher, dass der Ölpreis steigt
und teurere Fördertechnik lohnend wurde oder das Wissen über eine
Ölquelle wächst und wahrscheinliche zu nachgewiesenen Reserven
werden, die etwa in der BP-Weltenergiestatistik aufgeführt werden -
in beiden wurde aber kein Tropfen Öl mehr gefunden.
Die Theorie vom "Peak Oil"
Geeigneter für die Abschätzung der künftigen Ölförderung ist daher
die Untersuchung der historischen Entwicklung von Fund- und
Förderverläufen. Eine Ölquelle steht zu Anfang ihrer Ausbeutung
unter hohem Druck, danach kann die Förderung mit einigem technischen
Aufwand auf einem Plateau gehalten werden; und am Ende des
Lebenszyklus' läuft die Förderung langsam aus. Im Jahr 1956 hat der
Geologe King Hubbert eine mathematische Gleichung aufgestellt, die
den Produktionsverlauf einer Gruppe von Ölfeldern in Form einer
Glockenkurve beschrieb: mit langsamer Steigerung der Produktion bis
zum Höhepunkt bei der Hälfte der Reserven – und danach einem
zunehmenden Rückgang der Fördermenge. Mit
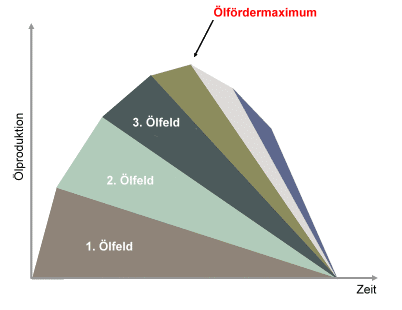
Typisches Förderschema einer
Ölregion: Zuerst werden die großen Ölfelder
erschlossen, im Laufe der Zeit immer kleinere. Gibt es nicht mehr
genug
neue Ölfelder, geht die Produktion zurück. Quelle: Energy Watch
Group 2008:
Zukunft der weltweiten Ölversorgung, Seite 42, eigene Übersetzung.
dieser Gleichung hat er auch den Beginn des Rückgangs der
amerikanischen Ölförderung für den Zeitraum von 1966 bis 1972
vorhergesagt - tatsächlich wurde der Höhepunkt der amerikanischen
Ölförderung mit konventionellen Fördermethoden 1970 erreicht. Diese
Glockenkurve bedeutet: Lange bevor die Vorräte erschöpft sind, geht
die Produktion zurück. Der Zeitpunkt der maximalen Ölförderung, nach
dem die Förderrate sinkt, wird englisch Peak Oil genannt
(der “Gipfel des Öls” - gemeint ist der Gipfel der Ölproduktion; in
Deutschland meist mit Ölfördermaximum übersetzt).
Diese einfache statistische Auswertung funktioniert aber vor
Erreichen des Fördermaximums nicht immer; genauere Ergebnisse erhält
man, wenn auch die Funde neuer Ölquellen in die Betrachtung
einbezogen werden: Bevor ein Ölfeld ausgebeutet werden kann, muss es
erst einmal gefunden und erschlossen werden (das scheint trivial,
sei aber hier nochmal gesagt, da es in mancher Diskussion vergessen
wird). Trotzt immer besserer Erkundungstechnologie gehen bereits
seit den 1970er Jahren Zahl und die Größe der gefundenen Ölfelder
zurück; seit den 1980er Jahren übersteigt die Fördermenge die Menge
des neu gefundenen Öls.
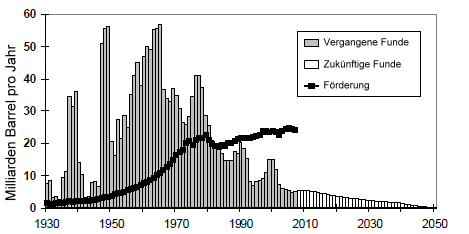
Ölfunde von 1930 bis 2050
(Schätzungen ab 2009: weiße Balken); im Vergleich
die Ölförderung bis 2008. Änderungen sind zurückdatiert (302).
Quelle:
ASPO Newsletter 100, April 2009, eigene Übersetzung.
Zur Erklärung gibt es zwei grundverschiedene Annahmen: Die einen
(oft Ökonomen) sehen keinen Grund zur Unruhe. Dass seit den 70er
Jahren wenige neue Ölfelder gefunden wurden, liege daran, dass
ölreiche Länder wie Irak, Iran und Saudi Arabien in den vergangenen
Jahren keinen Grund hatten, Öl zu suchen – und hohe Ölpreise wären
ein Grund. Allerdings gibt es keinen nachweisbaren Zusammenhang
zwischen Ölpreis und Ölfunden, und geopolitische Hindernisse der
Suche nach neuen Erdölquellen (wie die Irakkriege) alleine reichen
nicht aus, den Rückgang der Funde zu erklären.
Die anderen Seite (oft Geologen) sehen den Grund daher vor allem in
einer Erschöpfung der Ölvorräte. Einer der ersten dieser Mahner war
der ehemalige Produktionschef von Saudi Aramco, Sadad Al Husseini,
der seit Mitte der 90er Jahre darauf hinweist, dass weniger Öl
entdeckt als gefördert wird, die Vorräte also zurückgehen.
Prominentester Sprecher dieser Experten ist heute Colin Campbell,
der als Geologe für zahlreiche Ölgesellschaften arbeitete und jetzt
im Ruhestand Regierungen und Ölfirmen berät – vor allem aber als
Gründer der Association for the Study of Peak Oil and Gas
(ASPO) zur "Kassandra der Ölindustrie" (Neue Zürcher Zeitung) wurde.
Die Botschaft dieser Mahner: Inzwischen kennen wir die Voraussetzung
für die Entstehung von Erdöl gut genug, um zu wissen, wo wir suchen
müssen; die wesentlichen Erdölvorkommen sind bereits entdeckt, die
lohnenden werden bereits ausgebeutet. Die Schätzung der Geologen,
wie viel Öl noch zu entdecken ist, liegen alle unter oder um 200
Milliarden Barrel (siehe auch Abbildung oben) – wir müssen daher uns
auf eine in Zukunft sinkende Ölproduktion einstellen. Campbell geht
von folgenden Zahlen aus: In der Vergangenheit wurden 944 Milliarden
Barrel Öl gefördert; 764 Milliarden Barrel liegen noch in den
bekannten Ölfeldern und weitere 142 Milliarden Barrel werden aus
Ölfeldern hinzukommen, die als sicher gelten, aber noch zu entdecken
sind. Nach diesen Annahmen aber wäre die Hälfte der konventionellen
Ölvorräte bereits verbraucht – und nach der Hubbert'schen
Glockenkurve der Höhepunkt der Ölförderung erreicht (303, Abbildung
unten).
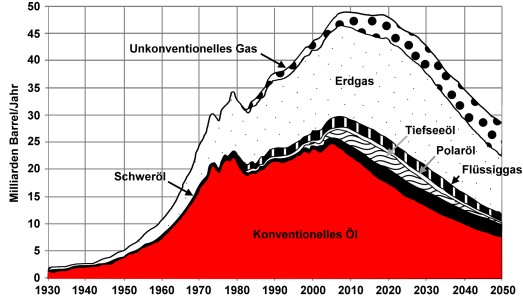
Colin Campbells Szenario der
Weltöl- und Gasförderung. Beim konventionellen Öl
ist der Höhepunkt der Förderung erreicht, unkonventionelle Ölquellen
können ihn
um ein paar Jahre hinauszögern. Beim Gas sieht er den Höhepunkt um
2010 erreicht.
Abb. nach ASPO Newsletter 100, April 2009, eigene Übersetzung.
In ihrem Weltenergiebericht (World Energy Outlook) 2010
hat auch die Internationale Energieagentur (IEA) vermutet, dass der
Spitzenwert der Rohölproduktion aus dem Jahr 2006 von etwa 70
Millionen Barrel nicht wieder erreicht wird, und damit indirekt den
Mahnern zumindest teilweise nachträglich Recht gegeben. Die IEA
rechnete aber damit, dass die Rohölproduktion bis zum Jahr 2020 noch
auf einem Niveau von 68 bis 69 Millionen Barrel gehalten werden
kann. Dabei rechnet sie damit, dass neue Ölfunde die zur Neige
gehenden Rohölquellen ersetzen können; die Differenz zur steigenden
Nachfrage müsste durch Öl aus “unkonventionellen Ölquellen” wie Öl
aus der Tiefsee, Schweröl aus Venezuela oder Öl aus Teersanden
kommen - die schwieriger und teurer zu fördern bzw. gewinnen sind.
Wie viel Öl fördern wir im Jahr 2030?
| |
|
| Internationale
Energieagentur, World Energy Outlook 2004: |
121 Millionen Barrel/Tag |
| Internationale
Energieagentur, World Energy Outlook 2006: |
116 Millionen Barrel/Tag |
| Internationale
Energieagentur, World Energy Outlook 2008: |
106 Millionen Barrel/Tag |
| Internationale
Energieagentur, World Energy Outlook 2010: |
96 Millionen Barrel/Tag* |
| Energy Watch Group,
Zukunft der weltw. Erdölvers., 2008: |
39 Millionen Barrel/Tag |
ASPO-Newsletter
100, April 2009: Rohöl
Rohöl plus unkonventionelle Ölquellen |
36 Millionen Barrel/Tag
55 Millionen Barrel/Tag |
* Bezugsjahr 2035
Können neue Technologien oder Schieferöl Peak Oil
verhindern?
Das amerikanische "Schieferöl" scheint nun zu neuen Hoffnungen
Anlass zu geben: Optimisten wie der dänische Statistiker Björn
Lomborg behaupten schon lange, dass es derart riesige Mengen an
Schieferöl gäbe, dass diese "ausreichen, um unseren gesamten
Energiebedarf für 5.000 Jahr zu decken" (>> Running
on Empty?, 2001). Echtes Schieferöl kann jedoch nur mit
erheblichem Energieaufwand gewonnen werden: Ölschiefer enthält
nämlich gar kein Öl, sondern ein festes organisches Material namens
Kerogen, eine Zwischenstufe bei der >> Ölentstehung.
Zur Ölgewinnung muss es auf 500 °C erhitzt und - wie Teersande - mit
Wasserstoff versetzt werden, dessen Gewinnung ebenfalls Energie
kostet. Der Nettoenergiegewinn ist derart gering, das bisher alle
großtechnischen Projekte zur Ölgewinnung aus Ölschiefer daran
gescheitert sind.
Was dagegen - vor allem in den USA - stattfindet, ist eine
Weiterentwicklung der seit 30 Jahren eingesetzten enhanced oil
recovery (EOR-)Verfahren, mit denen die Ausbeute von
Lagerstätten erhöht wird: Sie bestehen in einer Erhöhung des Drucks
durch Einpressen von Erdgas, Wasser, Kohlendioxid oder Stickstoff in
Lagerstätten oder im Einpressen von Chemikalien oder oder der
Erwärmung des Öls zur Verringerung seiner Viskosität. In den USA
wird jetzt mit dem zuvor bereits in der "unkonventionellen
Gasförderung" eingesetzten Fracking die
Durchlässigkeit des ölhaltigen Gesteins in den Lagerstätten erhöht,
so dass das darin noch eingeschlossene Rohöl leichter zu den
Bohrungen fließen kann. Dazu wird unter hohem Druck eine Flüssigkeit
in das Gestein gepresst, um Risse im Gestein zu erzeugen und
auszuweiten. Das funktioniert jedoch nur in der unmittelbaren
Umgebung des Bohrlochs, so dass wesentlich mehr Bohrtürme als bei
der konventionellen Ölförderung eingesetzt werden müssen. Die
Ölgewinnung mittels Fracking ist daher nur bei hohen Ölpreisen
wirtschaftlich, in den USA mussten aufgrund des Rückgangs der
Ölpreise bereits mehrere (vor allem kleinere Firmen) Konkurs
anmelden oder (vor allem größere) Milliardeninvestitionen
abschreiben. Umstritten ist, wie groß die mittels Fracking zu
gewinnende Ölmenge insgesamt ist - die amerikanische Energieagentur
hat 2014 ihre Schätzung des größten amerikanischen Vorkommen um 96
Prozent (und damit der amerikanischen Vorkommen insgesamt um zwei
Drittel) reduziert (304).
Der Energieaufwand der Energiegewinnung
Die Gewinnung von Energie kostet selber Energie: Um
konventionelles Rohöl aus der Erde zu holen, müssen mindestens
Löcher gebohrt werden; zur Gewinnung von Öl aus Ölschiefer muss
dieser auf 500 °C erhitzt werden, der zur Ölgewinnung notwendige
Wasserstoff muss ebenfalls energieaufwendig hergestellt werden. Der
Energieaufwand, der zur Energiegewinnung betrieben wird, wird als EROEI
(engl. Energy Return on Energy Input) gemessen. Er ist das
Verhältnis Gewonnene Energie / Aufgewendete Energie - ein EROEI von
20 bedeutet also, dass je Einheit aufgewendeter Energie 20 Einheiten
Energie gewonnen werden. In der Frühzeit des Öls lag der EROEI bei
über 100, heute liegt er in den USA für importiertes Öl aus dem
Nahen Osten bei etwa 8. Das heißt, es muss immer mehr Energie
aufgewendet werden, um Öl zu fördern; und das Verhältnis wird bei
immer aufwendigeren Fördertechniken immer schlechter (siehe oben).
Spätestens bei einem EROEI von 1 macht die Ölförderung - jedenfalls
als Energiequelle - keinen Sinn mehr.
Unabhängig von der Frage nach der Menge ist aber sicher: Die Zeit
des billigen Öls ist mittel- und langfristig vorbei. Die Produktion
aus zur Neige gehenden Ölfeldern wird immer teurer, da der Aufwand
steigt; neue Ölfelder sind in der Regel kleiner und liegen in immer
unzugänglicheren Regionen der Erde, was ihre Ausbeutung ebenfalls
teuer macht, und die Gewinnung von Öl aus der Tiefsee, aus
Teersanden oder mittels Fracking ist noch teurer. Wenn die Lücke
zwischen Nachfrage und Produktion wieder aufgeht, können aufgrund
der Konzentration der Ölförderung in wenigen Ländern können die
Produzenten ihre Kosten auch wieder weitergeben. Steigende Preise
sind überhaupt die Voraussetzung dafür, dass der prognostizierte
Bedarf gedeckt werden kann, da sich nur dann weitere Investitionen
in die Ölgewinnung lohnen. Die einzige Chance, diese Spirale zu
durchbrechen, wäre eine dauerhaft sinkende Nachfrage.
Neue Ölgroßmacht Brasilien?
Im Herbst 2007 ging eine Nachricht um die Welt: Im
Santos-Becken vor der Küste Brasiliens wurde ein “Tupi” genanntes
Ölfeld gefunden, in dem 5 bis 8 Milliarden Barrel lagern sollen,
ähnlich groß soll das daneben gelegene “Jupiter”-Feld sein. Im
Frühjahr 2008 wurde das vermutlich noch viel größere “Carioca”-Feld
gefunden. Wenn diese bisher noch nicht bestätigten Schätzungen
stimmen, wäre dies der bedeutendste Rohölfund seit den 1970er
Jahren, und Brasiliens Ölreserven wären mit denen von Venezuela oder
Russland vergleichbar. Aber auch dieser Fund wird nicht ausreichen,
um den Verlust anderer Fördergebiete auszugleichen; und: das
gefundene Öl liegt bis zu 6.000 Meter unter dem Meeresspiegel. Die
brasilianische Erdölgesellschaft Petrobras gilt als führend bei offshore-Fördertechniken,
ihre bisher tiefste Förderstelle liegt aber bei 2.000 Metern.
Zwischen 2.000 und 6.000 Meter Tiefe werden die Bohrungen und die
Förderung auf jeden Fall sehr teuer - das billige Öl werden sie auf
keinen Fall retten.
Mehr: >> DIE
ZEIT 25/2008: Die brasilianische Hoffnung
Was uns Öl außer Geld noch kostet
Wenn der Ölpreis auch von der Rivalität zwischen dem Iran und
Saudi-Arabien abhängt, sollte uns das nicht freuen: Der Konflikt
zwischen den beiden großen Mächten im Nahen Osten steht hinter dem
innermuslimischen Bürgerkrieg zwischen Sunniten und Schiiten. Der
überwiegend schiitische Iran unterstützt schiitische Milizen im
Irak, die dort gegen den sunnitischen "Islamischen Staat" (IS)
kämpfen, sponsert die schiitische Hisbollah, die unter anderem das
Regime in Syrien im dortigen Bürgerkrieg unterstützt und den IS
bekämpft (sponsert aber - was zeigt, dass nicht die Religion,
sondern Machtinteresse die zentrale Triebkraft ist - in Gaza auch
die sunnitische Hamas, die ebenso wie die Hisbollah Israel bekämpft)
und steht auch im Bürgerkrieg im Jemen an der Seite der schiitischen
Huthis. Damit hat sich der Iran gegen das sunnitische Saudi-Arabien
gestellt, das die islamistischen Assad-Gegner in Syrien mit Geld und
Waffenlieferungen unterstützt, im Jemen direkt in den Krieg gegen
die Huthi-Rebellen eingegriffen hat und ohnehin glaubt, dass der
Iran hinter dem arabischen Frühling steckt, in dem sunnitische
Herrscher ringsum eine Bedrohung ihrer Macht sahen und gegen dessen
Folgen Saudi-Arabien überall mit Predigern und der Finanzierung von
Koranschulen kämpft, die die totalitäre wahhabitische
Islam-Auslegung verbreiten sollen. Die Flüchtlinge, die aus Syrien
und anderen Ländern des Nahen Ostens nach Europa kommen, sind eine
Folge dieser Kriege.
Dass Amerika und der ganze Westen insbesondere dem Treiben seines
Verbündeten Saudi-Arabiens, obgleich das Land mit dem Iran zu den
großen Finanziers des islamistischen Terrorismus gehörte, zusah,
hatte nur einen Grund: "geostrategische Interessen" oder mit anderen
Worten: das arabische Öl. Wenn schon der Iran nach dem Sturz des
Schahs eigene Wege ging, war Saudi-Arabien um so wichtiger geworden.
Und wie Drogensüchtige auch nicht interessiert, was mit ihrem Geld
eigentlich angerichtet wird, sah das bei unseren Ölimporten nicht
anders aus. Immerhin versuchten die Amerikaner (der Vergleich
unserer Ölabhängigkeit mit Drogensucht stammt Georg W. Bush!) mit
der Übertragung des bei der Gasförderung erprobten Frackings sich
von Öl aus dem Nahen Osten unabhängig(er) zu machen und den Iran
wieder an die internationale Gemeinschaft anzunähern
(Atomverhandlungen), aber der mit Ölgeldern finanzierte
innermuslimische Bürgerkrieg dürfte uns noch lange beschäftigen,
zumal mit China längst ein neuer Käufer nach Ware sucht. Nach
Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) wird der Anteil
der OPEC an der Weltölproduktion im Jahr 2030 auf über 50 Prozent
steigen.
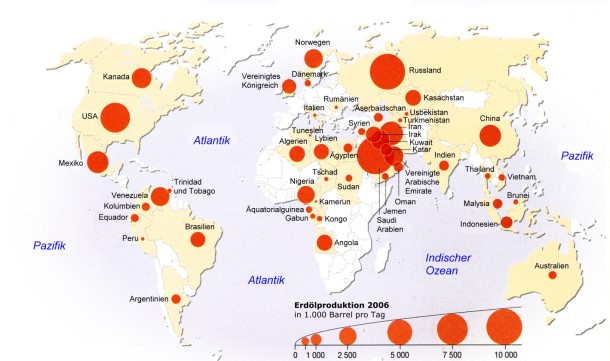
Die Ölproduzenten der Erde.
Nicht alle Ölproduzenten sind auch Ölexporteure, China und Indien
beispielsweise sind Netto-Importeure, da ihr Verbrauch die
Fördermenge überschreitet. Ölexporteure sind der Mittlere Osten,
Russland, Lateinamerika und Afrika. Abbildung nach Le Monde
diplomatique: L’atlas environnement, basierend auf Zahlenangaben aus
der BP Weltenergiestatistik Juni 2007; eigene Übersetzung.
Anmerkung: Im Jahr 2014 waren die USA dank ihres Schieferöls der
größte Ölproduzent der Welt.
Den Förderländern selbst hat das Erdöl auch oft kein Glück
gebracht: Wenn man Reichtum einfach aus dem Boden pumpen kann,
fördert das nicht unbedingt Erfindungsreichtum und Produktivität,
wohl aber autokratische Herrschaftsformen und Korruption: Es gibt
unter den Ölförderländern mehr Venezuelas, Libyens oder Kasachstans
als Norwegens. (Fallende Ölpreise schaffen dann natürlich Probleme,
selbst für große Ölförderländer wie Russland oder Saudi-Arabien, die
momentan ihre Devisenreserven aufzehren.)
Steigende Umweltbelastungen
Die andere Seite der Medaille ist die zunehmende Ölförderung in
sensiblen Lebensräumen wie der Tiefsee
oder der Arktis oder die Umweltbelastungen bei der
Nutzung "unkonventioneller Ölquellen". Teersande,
wie sie beispielsweise in Kanada abgebaut werden, erfordern den
Abbau und die Verarbeitung von zwei Tonnen Sand, um ein Barrel Öl zu
gewinnen. Das in Teersanden enthalte Öl ist nämlich oxidiert und
ähnelt eher Bitumen; bei seiner Aufbereitung werden enorme Mengen an
Energie und Wasser verbraucht: die Sande werden mit heißem Wasser
und Ätznatron so lange durchspült, bis sich Bitumen absetzt, das
anschließend vom enthaltenen Schwefel befreit und in sogenannten upgradern
mit Wasserstoff aus Erdgas versetzt wird, um synthetisches Öl zu
erhalten. Dabei entstehen auch riesige Mengen giftiger Abfälle, die
in Auffangbecken “endgelagert” werden. Krebserregende
Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle wie Arsen in diesen Abfällen,
die aus undichten Becken immer wieder in Gewässer gelangen, werden
für eine Häufung von Krebsfällen in der Region verantwortlich
gemacht. Die wirtschaftlich abbaubaren kanadischen Teersande werden
aber auf - je nach Quelle 40 bis 174 Milliarden Barrel Öl geschätzt;
wenn wir die Umweltfolgen in Kauf nehmen, kann der Höhepunkt der
Erdölförderung um ein bis einige Jahre verschoben werden.
Auch das Fracking ist hoch umstritten: der
eingepressten Flüssigkeit (dem "Fracfluid") sind Additive und
Stützmittel zugesetzt, die z.T. giftig oder krebserregend sind. Ein
Teil kommt nach dem Fracking als Rückfluss wieder an die Oberfläche
und muss entsorgt werden, ein Teil verbleibt unter der Erde, wo es -
etwa durch Lecks in der Verrohrung - möglicherweise nicht nur
Tiefen-, sondern auch Grundwasser verschmutzen könnte. Die Industrie
hält allerdings dagegen, dass die Verrohrung aus mehreren ineinander
steckenden Rohren mit überwachten Zwischenräumen bestehe, so dass
dieses nicht geschehen könne.
Kann Erdgas das schwindende Erdöl ersetzen?
Erdgas scheint auf den ersten Blick die ideale
Alternative zum Erdöl: Es verbrennt sauberer, kann Autos, Lastwagen
und Busse antreiben und wird bereits zur Stromerzeugung sowie zum
Kochen und Heizen verwendet, so dass eine Infrastruktur zu seiner
Nutzung bereits besteht. Die nachgewiesenen Reserven betragen laut
BP Weltenergiestatistik 2011 187.100 Milliarden Kubikmeter, bei
einem Jahresverbrauch wie im Jahr 2010 (3.169 Milliarden Kubikmeter)
würden diese noch knapp 60 Jahre reichen. Allerdings würde diese
Reichweite drastisch sinken, wenn der Verbrauch stark ansteigen
würde, um eine zurückgehende Ölproduktion zu ersetzen; und ähnlich
wie beim Erdöl würde die Förderung nicht in 60 Jahren plötzlich zu
Ende gehen, sondern lange vorher langsam sinken. Die Entdeckung
neuer konventioneller Gaslager hat längst - wie beim Erdöl - seinen
Höhepunkt überschritten, so dass ein Peak Gas ebenfalls
absehbar ist. Er dürfte allerdings später eintreten als beim Erdöl.
Die norwegische Erdgasproduktion könnte aber schon bald ihren
Höhepunkt erreichen, so dass wir in Deutschland noch abhängiger von
unserem bisherigen Hauptlieferanten Russland oder Ländern wie
Turkmenistan, Aserbaidschan oder Kasachstan werden, in denen die
Lagerstätten am Kaspischen Meer liegen. Die Alternative wäre ähnlich
wie beim Öl die Nutzung von “unkonventionellem Gas”, wie etwa
Schiefergas. Auch beim Erdgas ist die Förderung dieser Vorkommen
jedoch besonders umweltbelastend (unter anderem werden
krebserregende Chemikalien eingesetzt; siehe z.B. >> hier
[ZEIT online]). Damit gibt sich ein gemischtes Bild - es gibt wohl
genug konventionelles Gas, um die Stromversorgung bis zur Umstellung
auf erneuerbare Energiequellen abzusichern (>> hier)
und einen Anteil des Kraftstoffbedarfs zu decken, aber Erdgas wird
nicht oder nur unter Inkaufnahme erheblicher Umweltbelastungen
ausreichen, das schwindende Erdöl für Jahrzehnte zu ersetzen.
Die Alternative: sinkender Verbrauch
Für die bedeutende Rolle des Erdöls in der modernen
Industriegesellschaft gibt es gute Gründe: Kaum ein anderer
Energieträger ist so vielseitig, leicht zu transportieren und zu
speichern. Daher sind Erdölprodukte vor allem als Treibstoffe -
Benzin, Diesel, Kerosin - unschlagbar bequem; Ersatzstoffe sind
meist teurer und stehen auch nicht ausreichend zur Verfügung. Große
Hoffnung setzt die Politik auf Treibstoffe aus Biomasse, die jedoch
angesichts der gegenwärtigen Praxis mit erheblichen ethischen
Problemen behaftet sind (Treibstoffe für die Reichen statt Anbau von
Nahrungsmitteln, mehr >> hier).
Die IEA wies in ihrem World Energy Outlook 2010 aber darauf hin,
dass die Preise im Jahr 2035 „deutlich niedriger“ lägen, wenn die
Staatengemeinschaft ihr Ziel, den Anstieg der Erderwärmung auf zwei
Grad Celsius zu begrenzen (>> hier),
ernsthaft angehen würde. Dann würde die Nachfrage nach Erdöl kurz
vor 2020 ihren Höhepunkt erreichen, und danach stark zurückgehen.
Diese Produktionsspitze wäre dann nicht durch mangelnde Reserven
verursacht, sondern würde das bestätigen, was der ehemalige
saudische Ölminister Scheich Yamani sagt, seitdem er diesen Posten
verlassen hat: „Die Technologie ist der wahre Feind der OPEC“. Saudi
Arabien bremste zu seiner Zeit oft den Anstieg der Ölpreise, da
Yamani nicht indirekt die Entwicklung von effizienterer Techniken
und alternativer Energiequellen fördern wollte. (Er hatte den Westen
richtig eingeschätzt – immer wenn die Preise sanken, wurden diese
Programme wieder zurückgefahren.)
Zu steigenden Ölpreisen gibt es nur eine Alternative, und das ist:
sinkender Verbrauch. Damit könnte auch die Nutzung der hochgradig
umweltschädlichen Teersande verringert werden, die in der Summe auch
noch um 5 bis 15 Prozent höhere Kohlendioxid-Emissionen als
konventionelles Rohöl verursachen, und das Klima daher doppelt
belasten. Wie die IEA schreibt: Peak Oil kommt auf jeden
Fall; unsere Wahl ist es, ob als „als geladener Gast, oder als
ungewollter Geist“. Wie wir diesen sinkenden Verbrauch erreichen
können, finden Sie >> hier.
Zum Weiterlesen
Daniel Yergin: Der Preis. Die Jagd nach Geld, Öl und Macht. S.
Fischer Verlag 1991: Gut geschriebene, umfassende Geschichte des
Öls.
Colin Campbell: Ölwechsel! DTV 2002: Umfassende Darstellung der
geologischen, historischen und ökologischen Hintergründe und
Auswirkungen des Erdöls.
Energy Watch Group: Die Zukunft der weltweiten Erdölversorgung.
Umfassende Untersuchung zum Thema Peak Oil, download auf >>
www.energywatchgroup.org (pdf, 2,8 MB)
Weblinks
>>
www.energieverbraucher.de/de/Energiebezug/Heizoel/Ende-des-Oels__337/:
Webseite des Bundes der Energieverbraucher zum ”Ende des Öls” mit
weiteren links;
>> http://aspo-deutschland.blogspot.de/:
Webseite des deutschen ASPO e.V.;
>> http://ww.peakoil.net:
Webseite der von Colin Campbell gegründeten Association for the
Study of Peak Oil & Gas (englischsprachig);
>> The Wolf
at the Door: Schöne, leider im Jahr 2006 eingestellte, aber
nach wie vor zugängliche Webseite zum Thema aus Großbritannien, die
englische Fassung ist viel umfangreicher als die deutsche
Übersetzung;
>> http://www.theoildrum.com/:
Leider im Jahr 2013 eingestellte, aber nach wie vor zugängliche
Seite mit News zu Peak Oil auf der Webseite des Institute für
the Study of Energy and Our Future (einer gemeinnützigen
amerikanischen Organisation, die vor allem im Internet
publiziert).
Mehr zum Thema Energie auf diesen Seiten:
>> Hauptseite Energie
>> Energie und ihre Einheiten
>> Eine kleine Geschichte
des menschlichen Energieverbrauchs
>> Eine kleine Geschichte
der Erforschung der Energie
>> Eine
kleine Geschichte des Erdöls
>> Eine
kleine Geschichte der Atomenergie
>> Energiewende
Strategien für die Zukunft:
>> Saubere
Energie
Zurück zu:
>> Übersicht:
Das Zeitalter der Industrie
>> Unsere
Rohstoffe