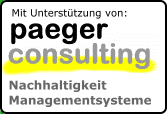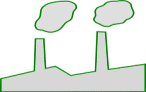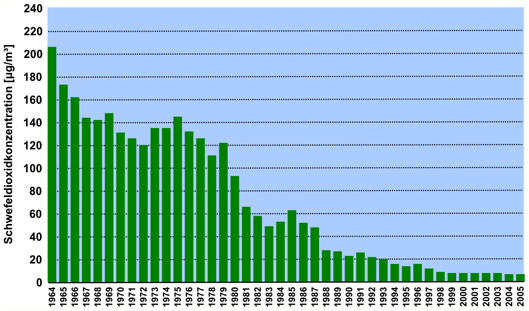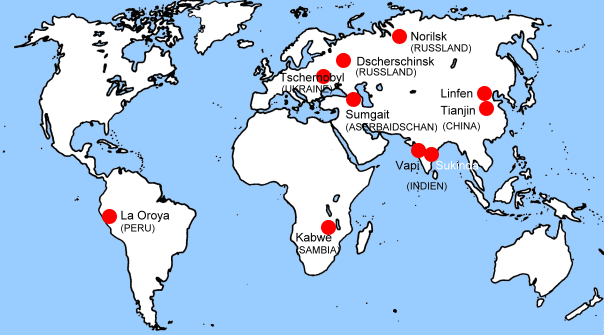Das Zeitalter der Industrie
Dunkle Wolken im "großen Luftozean"
Eine kleine Geschichte der
Luftverschmutzung

Luftverschmutzung in Santiago de
Chile, Winter 2003. Foto: Michael Ertel, aus >> wikipedia,
abgerufen 5.3.2010. Lizenz: >>
FDL 1.2.
Vorindustrielle Luftverschmutzung
Die Geschichte der Luftverschmutzung begann, als die Menschen das
Feuer bändigten: Die Rußschichten in prähistorischen
Höhlen und geschwärzte Lungen bei mumifizierten Leichen aus der
Steinzeit beweisen, dass die Luft in den Höhlen unserer Vorfahren
nicht immer die beste war. (Noch heute ist die >>
Luftverschmutzung durch offene Feuer – die vor allem in armen
Entwicklungsländern zum Kochen genutzt werden – eines der
drängendsten Umweltprobleme.) Die teils durch Brandrodung
betriebene Vernichtung der Wälder seit Erfindung der Landwirtschaft
war ein Beitrag zur möglicherweise >>
ersten großflächigen Umweltveränderung, in jedem Fall aber
eine Quelle der Luftverschmutzung. Als der Mensch >>
lernte, Metalle zu verarbeiten, trugen auch diese zur
Luftverschmutzung bei: In Proben aus dem Grönlandeis lassen sich
noch heute Spuren von Blei- und Kupferemissionen
aus vorindustrieller Zeit nachweisen; die Luftverschmutzung beim
Bergbau wurde bereits von Agricola in seinem De Re Metallica
aus dem Jahr 1556 beschrieben. Auch die >>
Luftqualität mittelalterlicher Städte ließ oftmals zu wünschen
übrig, wie historische Schilderungen sowohl aus der arabischen als
auch aus der christlichen Welt belegen. Die vorindustrielle
Luftverschmutzung war aber in ihren Auswirkungen auf die
unmittelbaren Entstehungsorte beschränkt.
Eine neue Dimension: Die Kohleverbrennung
Ganz neue Dimensionen nahm die Luftverschmutzung mit der >>
Industriellen Revolution an. Kohle wurde zum wichtigsten
Brennstoff; um 1870 besaß Großbritannien ca. 100.000 kohlebetriebene
Dampfmaschinen. Mit sinkenden Transportkosten konnte Kohle auch in
die Städte transportiert werden und dort sowohl für Öfen und Herde
als auch für Industrieanlagen genutzt werden. Im Viktorianischen
England waren etwa ein Viertel aller Todesfälle auf
Lungenkrankheiten zurückzuführen. Mit der zweiten Phase der
industriellen Revolution ab 1870 entstanden Schwerindustrien –
Eisen, Stahl, Chemikalien – mit riesigem Kohleverbrauch auch in
anderen europäischen Ländern sowie in den USA und Japan, im 20.
Jahrhundert dann auch in Russland, Kanada, Lateinamerika und Asien.
Die Luft um die Hüttenwerke, in den Städten und Industriegebieten
war katastrophal schlecht, schien aber der unvermeidliche Preis des
entstehenden Wohlstands zu sein. Industrielle, Arbeiter und
Staatsminister sahen in rauchenden Schornsteinen ein Symbol für
Fortschritt, Wohlstand und Macht.
Die erste Folge waren verschmutzte Kohlestädte
wie London. 1880 gab es in London 3,5 Millionen Feuerstellen, der
hauptsächlich im Winter auftretende Smog (das Wort verbindet smoke,
Rauch und fog, Nebel; es wurde 1905 auf dem in London
stattfindenden Hygiene-Kongress geprägt) wurde zum regelmäßigen
Ereignis. Dabei sollen sogar Fußgänger in die Themse gefallen sein,
weil sie den Fluss nicht sahen; in der Londoner Innenstadt lag in
den 1920er bis 50er Jahren die Zahl der Sonnenstunden 20 Prozent
niedriger als in den Vorstädten. Auch im Ruhrgebiet wurde Kohle
schon vor der Industrialisierung genutzt. Bei Dortmund war bereits
im 13. Jahrhundert Kohle gefunden worden, 1578 begann im Muttental
bei Witten der Stollenbergbau – zunächst in waagerechten Stollen.
Auch hier war die dreckige Kohle eigentlich unbeliebt, aber in Essen
waren bereits 1794 die Häuser aufgrund der zahlreichen Kohleöfen
schwarz "als hätte man sie mit Absicht geschwärzt" (1203).
Irgendwann ließen sich die Folgen der Luftverschmutzung bei allem
Fortschrittsglauben nicht mehr übersehen. Die ersten Bemühungen zur
Reinhaltung der Luft begannen in den USA, in St. Louis und
Pittsburgh, wurden aber während des Krieges nicht fortgeführt. Im
Dezember 1952 kam es in London während einer Kälteperiode zu einem
einwöchigen Smog, der so dicht war, dass die andere Straßenseite
nicht mehr zu erkennen war, örtlich betrug die Sichtweite zeitweise
sogar nur 30 Zentimeter. Eine Aufführung der Oper "La Traviata"
musste abgebrochen werden, da die Zuschauer die Bühne nicht mehr
sehen konnte – im Theaterinnenraum! In dieser Woche starben in
London etwa 4.000 Menschen mehr als gewöhnlich, und die Todesrate
blieb noch drei Monate lang erhöht – insgesamt hat "the Great
Smog" (wie er später benannt wurde) wohl
12.000 Menschen das Leben gekostet (1205).
Obwohl die Regierung, wie der damalige Kommunal- (und spätere
Premier-)minister Harold Macmillan sagte, neue Gesetze nicht für
nötig hielt (1206),
sorgte öffentlicher Druck dafür, dass 1956 in einem "Clean Air
Act" (Luftreinhaltungsgesetz) die häusliche Kohlefeuerung
streng geregelt. Hilfreich kam hinzu, dass seit 1950 zunehmend
>> Öl
und Gas an die Stelle der Kohle traten, deren Verbrennung
weniger Schadstoffe, vor allem Rauch und Ruß, erzeugen. Bis 1970
sank der Rauchgehalt der Londoner Luft um 80 Prozent, bis 2005 um 98
Prozent.
Industrielle Luftverschmutzung
England, Westeuropa, Amerika
Luftverschmutzung ging auch von der Metallverhüttung und der
Chemieindustrie aus. Die chemische Großindustrie entstand mit der
Herstellung von Natriumcarbonat für die Glas- und Seifenherstellung
sowie die Textilindustrie. Dabei entstand ätzender Chlorwasserstoff,
der in die Umgebung abgegeben wurde. Die auf Grundlage des 1863
verabschiedeten britischen Alkali Act im Jahr 1865 gegen diese
Verschmutzung gegründete Alkali-Aufsichtsbehörde gilt als erste
“Umweltbehörde” der Geschichte. (Sie bewirkte wenig;
besser wurde die Situation erst, als das heute genutzte
Solvay-Verfahren eingeführt wurde.) Mit der >>
zweiten Phase der industriellen Revolution nahm der Bedarf an
Kupfer zu. Kupferminen wie die 1873 von einem britischen Konsortium
übernommene, schon seit phönizischen Zeiten genutzte Mine am Río
Tinto in Andalusien lieferten auch Schwefelsäure für die chemische
Industrie; bei der (in England verbotenen) Verhüttung im Freien
wurde aber ein Teil des Schwefels aus dem Erz als >> Schwefeldioxid
freigesetzt, das mit dem Wasser in der Luft zu "saurem Regen"
reagiert. Ein britischer Handelsagent berichtete, dass "Augen und
Kehlen schmerzen, und alles Eisen korrodiert". 1888 streikten die
Bergarbeiter gegen die Minenbetreiber, unterstützt von den Bauern
aus der Umgebung. Bei einer Protestkundgebung erschoss die Polizei
45 Menschen (1215).
Auch die Abgase der im 20. Jahrhundert wichtig werdenden
Nickelproduktion (Nickel wird zur Stahlveredelung verwendet)
schädigten die Umgebung der Hüttenwerke in weitem Umkreis. In den
Nickel-Kupfer-Hüttenwerken im kanadischen Sudbury etwa wurde das Erz
ebenfalls unter freiem Himmel verhüttet; als 1920 der erste Schlot
gebaut wurde, war die Umgebung bereits in eine schwarze Wüste
verwandelt (1215).
Am schlimmsten aber war die Luftverschmutzung in den
Industriegebieten, die gleichzeitig über Kohle- und Erzvorkommen
verfügten, wie im Ruhrgebiet, im “Schwarzen Land” (Black Country) in
Mittelengland oder in der Region der Großen Seen in Nordamerika.
Eine der ersten Umweltkrisen war der Oktobersmog in der Kleinstadt Donora
(Pennsylvania, USA), wo im Oktober 1948 eine
Inversionswetterlage verhinderte, dass die Rauchwolken der örtlichen
Stahl- und Zinkhütten abzogen; rund die Hälfte der 14.000 Einwohner
erkrankte an Atemwegs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 40 Menschen
starben. Die Stahlgesellschaft "American Steel" gab der
Inversionswetterlage die Schuld an den Schäden und stritt jedwede
Mitschuld ab; nach diesem und ähnlichen Ereignissen begann aber die
wissenschaftliche Erforschung der Zusammenhänge zwischen
Luftverschmutzung und Gesundheitsschäden.
Beispiel
Ruhrgebiet
In Europa wurde das Ruhrgebiet
zum Sinnbild für Umweltverschmutzung. In der kohlereichen Region
wurde 1756 die erste Eisenhütte in Betrieb genommen; die eigentliche
Industrialisierung begann aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts. 1834
wurde auf der Zeche Franz bei Essen-Borbeck erstmals die
Mergelschicht durchteuft, die weiter nördlich im Ruhrgebiet die
verkokbare Fettkohle bedeckte, und mit der Einführung des
Kokshochofens, der Dampfmaschine und der Erschließung des
Ruhrgebiets durch Eisenbahnen begann um 1850 die eigentliche
Industrialisierung (1219).
Klagen hierüber gab es vor allem von Nachbarn, etwa Bauern, denen
die giftigen Abgase aus Metallhütten oder chemischen Betrieben die
Ernten verdarben. Die meisten Einwohner waren aber "stolz auf die
amerikanisch genannte Entwicklung des Heimatortes und seiner
Nachbarschaft" und fühlten sich "als Angehörige eines zielstrebigen
Gemeinwesens voller Arbeitszähigkeit und Schaffensfreude" (1220).
Auch im Ruhrgebiet wurden bei der Verhüttung von Erzen enorme Mengen
schwefliger Säure freigesetzt, und die Ruhrkohle enthielt ebenfalls
zwischen 0,5 und 3 Prozent Schwefel, die ebenfalls bei der
Verbrennung freigesetzt wurden – im Ruhrgebiet wurde sogar bevorzugt
besonders schwefelhaltige Kohle eingesetzt, da diese billiger war
und sich weniger zum Export eignete. Die 1847 bei Essen-Borbeck
errichtete Zinkhütte etwa verfeuerte 1884 täglich 105 Tonnen Kohle
und setzte 3.700 kg schweflige Säure frei.
Im Jahr 1900 war das Ruhrgebiet bereits die größte Industrieregion
Europas, und wohl auch die am stärksten verschmutzte (1215).
In Essen berichteten Behördenvertreter 1912, dass in der Nähe der
Kruppschen Fabrik und der Zechen zweimaliges Staubwischen am Tag in
den Wohnungen das mindeste sei, was geschehen muss, und dass der
Staub fast nur aus Kohle und Rußpartikeln "manchmal von erheblicher
Größe" bestehe. Da die Stahl- und Eisenwerke von Krupp und Thyssen
für die deutsche Rüstungsindustrie von zentraler Bedeutung waren,
hatten ernsthafte Umweltauflagen kaum eine Chance, obwohl es bereits
rechtliche Möglichkeiten hierzu gab (1230).
Auch für die Industriegewerkschaften zählten Arbeitsplätze mehr als
die Umwelt. So kam es zur dann doch allerorts beklagten Ruß-
und Rauchplage, die auch der Bau höherer Schornsteine (1232) kaum
änderte, da die ständig zunehmende Zahl der Fabriken deren Effekt
zunichte machte (die im Rauch aus Eisen- und Stahlindustrie
enthalten giftigen Stoffe wie Blei, Kadmium, Arsen und Fluoride
wurden erst allmählich als Problem wahrgenommen; die damalige
Medizin vermutete zwar Zusammenhänge zwischen Luftverschmutzung und
Erkrankungen, konnte diese aber mangels Kenntnissen der
Ausbreitungs- und Wirkungsmechanismen noch kaum beweisen [1233]).
Das Ausmaß der Luftverschmutzung im
Ruhrgebiet wurde deutlich, als 1923 nach der Besetzung durch
französische Truppen (wegen ausgesetzter Reparationszahlungen nach
dem Ersten Weltkrieg) Streiks die Kohle-, Koks- und Stahlgewinnung
lahmlegten: Der Himmel wurde wieder sichtbar; die Ernten erhöhten
sich um die Hälfte, die Jahresringe an den Bäumen waren dicker als
in den Jahren davor und danach. Die Arbeiterfamilien litten aber in
dieser Zeit Hunger und Elend, und so wurde die Luftverschmutzung
weiter als notweniges Übel akzeptiert (1235).
Besser wurde die sichtbare Lage in den Städten mit dem elektrischen
Strom: zahllose Dampfmaschinen konnten durch außerhalb der Städte
gebaute Kraftwerke ersetzt werden. Auch diese verschmutzten ihre
Umgebung erheblich, das Anfang der 1920er Jahre am bei Wetter
gelegenen Harkortsee gebaute Kraftwerk etwa stieß soviel Asche aus,
dass bei nebligem Wetter der See vollständig von einer Ascheschicht
bedeckt war (von Auflagen zur Reduzierung der Rauchintensität hatte
der zuständige Kreisausschuss "im Lebensinteresse" des Werkes
abgesehen), die Verschmutzung traf aber weniger Menschen.
Als 1927 in Sodingen bei Herne das damals modernste Zechenkraftwerk
ohne Rauchgasentstaubung in Betrieb genommen wurde, musste aufgrund
des enormen Flugaschenauswurfs die benachbarte Schule geschlossen
werden – sie wurde nie wieder eröffnet, dafür wurden dort, nachdem
zwei der drei Kessel des Kraftwerks aufgrund der Wirtschaftskrise
stillgelegt wurden, 1930 vorübergehend obdachlose Menschen
untergebracht (1220).
In der Weltwirtschaftskrise wurde zudem die Erforschung der Frage,
ob Industrieluft Menschen und Umwelt schädigt, aus Geldmangel
eingestellt. Die Haltung gegenüber der Luftverschmutzung änderte
sich auch unter den Nazis nicht, die Rüstungskonjunktur und die
Kriegsvorbereitung verschärften die Lage sogar noch (“Die
Leidenschaft der Nazis galt wohl dem deutschen Blut und deutschen
Boden, nicht aber der deutschen Luft.” [John R. McNeill, 1215]).
So durfte das Kraftwerk am Harkortsee, über das sich mittlerweile
auch andere Industrieunternehmen beschwerten und das den
Fremdenverkehr stark beeinträchtigte, keinen höheren Schornstein
errichten, da dieser das Werk "für die Lufterkundung zu auffällig
mache", die daraufhin beschlossenen Elektrofilter konnten nicht
eingebaut werden, da der Antrag auf Zuteilung für Eisen zugunsten
der Rüstungsindustrie abgelehnt wurde. Immerhin:
Rauch und Dunst über dem Ruhrgebiet führten im Zweiten Weltkrieg
dazu, dass hier die Bombenabwürfe der Alliierten weniger zielgenau
waren als anderswo. Die meisten Industriebetriebe wurden dennoch
zerstört – und wieder ging die Luftverschmutzung zurück.
Aber im Kalten Krieg brauchte Europa deutsche Kohle, deutsches
Eisen und deutschen Stahl; das Ruhrgebiet wurde schnell als
Industriegebiet wieder aufgebaut. Mit dem Wirtschaftswunder
erreichte die Eisen- und Stahlproduktion neue Rekorde, die chemische
Industrie wurde ausgebaut. In den 1950er Jahren gingen über das
Ruhrgebiet weit über 300.000 Tonnen Staub pro Jahr hinab, Messungen
in den (besonders belasteten) nördlichen Stadtteilen von Duisburg
ergaben Staubbelastungen von bis zu 6,8 kg je 100 Quadratmeter im
Monat. Anträge, dass die Stadt Musterprozesse gegen besonders
luftverschmutzende Betriebe finanziere, wurden vom Oberstadtdirektor
abgewiesen, aber zur systematischen Luftuntersuchung 51 Messstellen
eingerichtet: und Spitzenwerte von 20,2 kg Staub je 100 Quadratmeter
im Monat gemessen. Der Unmut über nahezu unerträgliche Rauchwolken,
gegen die es praktisch keine Klagemöglichkeiten gab, führte 1952 zur
Gründung gegründete "Interparlamentarische Arbeitsgemeinschaft für
naturgemäße Wirtschaft" (IPA), die sich ab Mitte der 1950er Jahre
auch für ein Gesetz zur Luftreinhaltung einsetzte. Beim Verein
Deutscher Ingenieure (VDI) wurde eine Kommission zur Reinhaltung der
Luft gegründet, die hierzu Vorschläge erarbeiten sollte. Aber die
Bevölkerung war mehr am "Wirtschaftswunder" als an sauberer Luft
interessiert; das Grundgesetz trug ebenfalls nicht dazu bei, den
Umweltschutz weiterzuentwickeln, da der Bund hier kaum
Gesetzgebungskompetenzen hatte (1240).
Immerhin trugen die Arbeiten dazu bei, dass die Möglichkeit von
Nachbarn und Geschädigten, Schadenersatz einzufordern, verbessert
wurden: 1959 entfiel die bis dahin im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB)
enthaltene Pflicht, "ortsübliche" Belastungen ersatzlos zu dulden (1241). Aber
damit konnte nicht verhindert werden, dass Luftverschmutzung
entstand. Mit der im gleichen Zug stattfindenden Änderung der
Gewerbeordnung wurde aber die Möglichkeit einer nachträglichen
Anordnung geschaffen, der den Behörden zumindest theoretisch ein
Werkzeug zur Verbesserung der Luftqualität in die Hand gab. Aber als
die Kohle aus dem Ruhrgebiet gegenüber der billigeren (weil nicht so
tief unter der Erde geförderten) Kohle aus dem Ausland (und auch
gegenüber dem billigeren Öl) Ende der 1950er Jahre nicht mehr
konkurrenzfähig ist, wird ihr Abbau mit Subventionen gefördert, das
alte Denken in Gewerbesteuern und Arbeitsplätzen setzt sich durch.
Der Umschwung, der sich leise anzukündigen begann,
verstärkte sich in den 1960er Jahren. Ein Rückgang des
wirtschaftlichen Wachstums ließ erstmals die Grenzen des
"Wirtschaftswunders" erkennen und skeptische Stimmen wurden
zunehmend gehört. 1961 griff Kanzlerkandidat Willy Brandt diese
Stimmung auf einem Parteitag auf und redete davon, dass der Himmel
über dem Ruhrgebiet wieder blau werden müsse. Brandt wollte hiermit
die SPD über die Arbeiterschaft hinaus wählbar machen, der Slogan
wurde aber kaum ernst genommen (ein Politiker, der das Blaue vom
Himmel versprach...); und Brandt wurde auch nicht gewählt. Aber 1962
schuf Nordrhein-Westfalen (ohne Gegenstimme) das erste
Landes-Immissionsschutzgesetz, ein "modernes" Gesetz zur
Luftreinhaltung, das zum Vorbild für das spätere
Bundes-Immissionsschutzgesetz wurde. In den Verwaltungsbehörden
wurde dieses Gesetz und spätere Umweltgesetze aber nicht umgesetzt (1245), und so
bestand der praktische Umweltschutz oft weiterhin im Bau hoher (und
noch höherer) Schornsteine, so dass die verschmutzte Luft vom Wind
weiter verteilt werden konnte.
Japan
Die japanische Industrialisierung ab der >>
Meiji-Zeit brachte ebenfalls stark verschmutzte
Industriegebiete hervor, etwa die Hanshin-Region (Osaka-Kobe). Hier
entstanden ab 1880 Eisen- und Stahlwerke, Zement- und Chemiewerke;
bis 1900 vervierfachte sich die Einwohnerzahl von Kobe und Osaka. Ab
1912 wurde die Luftverschmutzung gemessen: sie war so schlimm wie in
London. Produktion und Luftverschmutzung stiegen weiter (angeblich
stürzten sogar Flugzeuge wegen schlechter Sicht ab), bis im Zweiten
Weltkrieg die amerikanische Luftwaffe die Industrie der Region in
Schutt und Asche legte. Aber die Amerikaner halfen auch bei
Wiederaufbau, und 1955 lag der Staubniederschlag über den
Vorkriegswerten. Mit der einsetzenden Motorisierung wuchs die Region
mit dem Großraum Kyoto zu einem Ballungsraum zusammen, in dem über
zehn Millionen Menschen von der Luftverschmutzung betroffen waren.
Ein anderer Schwerpunkt der japanischen Umweltverschmutzung war Ube
im Nordwesten, ein Zentrum für Zement, Chemie und Kohle. Nachdem
Wissenschaftler der Universität von Ube die gesundheitlichen Folgen
der Luftverschmutzung gezeigt hatten, begann 1954 der Kampf gegen
die Luftverschmutzung – auf Initiative des Vorsitzenden des lokalen
Industrieverbandes, Kanichi Nakayasu! Bei einem Besuch in Pittsburgh
erkannte er, dass die Region das Problem lösen kann, und setzte sich
für strenge Grenzwerte ein. 1965 war der Himmel über Ube wieder
blau; und die Stadt wurde zum Vorbild für andere Regionen Japans
(>> mehr)
– 1968 wurde in Japan ein Gesetz zur Luftreinhaltung verabschiedet,
in dem vor allen den lokalen Präfekten Spielraum zur Festlegung von
Grenzwerten gegeben wurde.
Sowjetunion und Osteuropa
Die >>
sowjetische Industrialisierung ab 1927 wiederholte das Muster
des Westens und übertraf es bei der Umweltverschmutzung sogar – hier
konnte man sich auf Marx und Engels berufen, die das Bild vom
Menschen als Naturbeherrscher gezeichnet hatten. Wie die Natur der
Gesellschaft nutzbar gemacht werden konnte, war den Staatslenkern
klar: Priorität hatte immer die Produktion. Das wohl dreckigste
Hüttenwerk der Welt war das sowjetische von Norilsk in Sibirien, von
Stalins Geheimpolizei geführt und von Gulag-Arbeitern errichtet: Es
stieß in den 1980er Jahren mehr Schwefeldioxid aus als ganz Italien.
(Norilsk gehört noch heute zu den zehn dreckigsten Orten der Welt,
>>
mehr.) Die Luft in Moskau verschlechterte sich ab den 1930er
Jahren, und in den 1960er Jahren waren die Werte von Schwefeldioxid
und Stickoxiden in einigen Vororten weit jenseits jeden Grenzwerts.
Noch schlimmer war die Lage in den Industriegebieten von Donezk und
Magnitogorsk.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das sowjetische Modell auf Osteuropa
übertragen. Eine Folge war die Entstehung des “Schwefeldreiecks”
zwischen Dresden, Prag und Krakau. Die Braunkohlekraftwerke hier
erzeugten drei Viertel des Strombedarfs Polens und zwei Drittel des
Bedarfs in der Tschechoslowakei und in der DDR, die Konzentration
an Schwefeldioxid in der Atemluft übertraf die Grenzwerte der
Weltgesundheitsorganisation um das Zwanzigfache. Auf Krakau gingen
jedes Jahr 170 Tonnen Blei und 7 Tonnen Cadmium nieder. Die DDR
entwickelte sich in der Folge – etwas verzögert – ganz ähnlich wie
die Bundesrepublik (nur dass hier – siehe oben – die noch
umweltschädlichere Braunkohle zur Basis der Energiewirtschaft
wurde). Ende der 1950er Jahre begann der Ausbau der Chemieindustrie:
Plaste und Elaste aus Schkopau (Werbeslogan für die Chemischen Werke
Buna) wurden zur Basis einer Industrieproduktion, die oftmals auf
Anlagen aus der Zwischenkriegszeit erfolgte. Die Luft im
"Chemiedreieck" zwischen Merseburg, Halle und Bitterfeld wurde
sprichwörtlich schlecht: "Bitterfeld, Bitterfeld, wo der Dreck vom
Himmel fällt...". Die Fünfjahrespläne und die Jahrespläne, die für
die betriebliche Planung verbindlich waren, enthielten
ausschließlich Vorgaben zur Produktivität, eine Verminderung der
Luftverschmutzung war kein Planziel.
Andere Regionen
Die anderen Regionen, in denen die Industrialisierung einsetzte,
hatten alle ähnliche Probleme: in Brasilien etwa wurde die Umgebung
von Cubatão im Bundesstaat São Paulo auch “Tal des Todes" genannt –
die Kindersterblichkeit lag hier zehnmal höher als im Durchschnitt
des Bundesstaates..
Umweltbewegung und Gesetze zur Luftreinhaltung
Deutschland stand mit seiner ab Mitte der 1960er Jahre zunehmenden
Aufmerksamkeit für Fragen der Umweltverschmutzung nicht allein:
überall in den Kernländern der Industialisierung – Nordamerika,
Europa und Japan – begannen wirksame Proteste der Bevölkerung gegen
diese Verschmutzung. Japan war wie oben dargestellt das erste Land,
das ein im gesamten Land geltendes Gesetz zur Luftreinhaltung
erließ. 1966 erinnerte ein Smogalarm in New York – ausgerechnet zum
Thanksgiving-Fest – die Amerikaner an den Londoner Smog;
und nachdem am 22. Juni 1969 der schwer verschmutzte Fluss Cuyahoga
in Brand geraten war, organisierte der US-Senator Gaylord Nelson am
22. April 1970 den ersten Earth Day: 20
Millionen Amerikaner demonstrierten an diesem Tag gegen die
Umweltverschmutzung; vor allem gegen die Luftverschmutzung durch
Kohlekraftwerke. 20 Millionen Menschen – das Signal war so deutlich,
dass auch eine konservative Regierung wie die von Richard Nixon es
nicht überhören konnte: 1970 begann mit dem Clean Air
Act das Zeitalter der modernen amerikanischen
Umweltgesetzgebung (1250),
das Umweltamt Environmental Protection Agency
wurde gegründet. Auch in Deutschland begann mit dem Amtsantritt der
sozialliberalen Koalition und dem Entstehen zahlreicher
Bürgerinitiativen für Umweltschutz die moderne Entwicklung des
staatlichen Umweltschutzes. 1971 verkündete die Bundesregierung das
erste Umweltprogramm, 1972 wurde das Grundgesetz geändert und im
Jahr 1974 erhielt auch Deutschland mit dem mit dem nach dem
nordrhein-westfälischen Modell erarbeiteten Bundesimmissionsschutzgesetz
(1255) ein
Gesetz zur Luftreinhaltung. Mit ihm Gesetz wurde die
Genehmigungspflicht für umweltbelastende Betriebe aus dem
Gewerberecht herausgelöst und in das neue Gesetz überführt. Im
gleichen Jahr wurde auch in Deutschland ein Umweltbundesamt
gegründet.
Bis das neue Recht zur Luftreinhaltung greifen konnte, dauerte es
allerdings (1258).
Dabei war inzwischen die Verteilung der Luftverschmutzung durch hohe
Schornsteine zu einem nicht mehr zu leugnende Problem geworden:
Rauch und Ruß als lokale Probleme wurden so zwar verringert, aber
Schwefel- und Stickstoffoxide konnten sich über Tausende Kilometer
verbreiten und bildeten den Hauptbestandteil des „Sauren Regens“,
der in den 1980er Jahren zum >>
länderübergreifenden Umweltproblem wurde. In Deutschland
wurden die Waldschäden, für die der saure Regen als Hauptverursacher
galt, unter dem Schlagwort "Waldsterben" zum politisch brisanten
Thema. Es wurde klar: hohe Schornsteine sind keine Lösung, die
Emissionen mussten reduziert werden. In Deutschland zwang eine 1983
erlassene Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (1260)
die hauptsächlich für die Schwefel- und Stickoxidemissionen
verantwortlichen Betreiber von Großkraftwerken zum Einbau von
wirksamen Filteranlagen. Zusammen mit Effektivitätssteigerungen beim
Energieeinsatz sowie der Ersatz von Kohle durch Öl und Gas führten
solche auch in anderen Ländern erlassenen Regelungen mittlerweile zu
deutlichen Verringerungen der Schwefeldioxid-Emissionen – in den
Kohlestädten Nordamerikas, Westeuropas und Japans nahm der Gehalt an
Rauch, Ruß und Schwefeldioxid wie zuvor in London um 70 bis 95
Prozent ab. Weniger erfolgreich waren die Ansätze zur Verringerung
der Stickstoffoxid-Emissionen,
die zudem noch zur Bildung des >>
Sommersmogs beitragen, der auch heute noch ein Problem der
Großstädte auch der westlichen Welt ist. Verursacher für diese
Belastung ist auch der >> Autoverkehr.
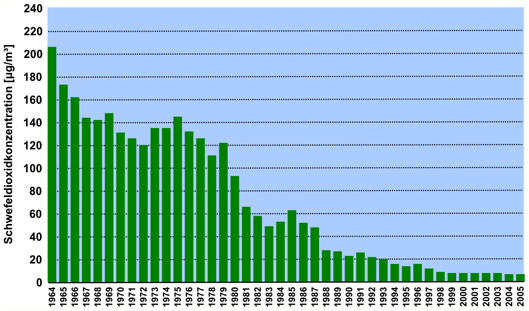
Die Entwicklung der
Schwefeldioxid-Konzentration in der Luft im Rhein-Ruhr-Gebiet von
1964
bis 2005 zeigt beispielhaft die Verbesserung der
Luftqualität in dieser Industrieregion seit Beginn
der Umweltschutzaktivitäten in den 1960er Jahren. (Zuverlässige
ältere Werte dieses im Ruhrgebiet
schon lange (>> 1235)
als "schweflige Säure" (die in der Luft aus >>
Schwefeldioxid entsteht)
bekannten Verursachers schwerer Schäden sind leider nicht verfügbar.
Abb.: siehe >> 1264.
Weniger Gehör fanden die Proteste der Umweltschützer dagegen in den
nicht-demokratischen Ländern. Dort änderte sich die Situation erst
nach dem Fall der jeweiligen Regime: In Brasilien nach dem Ende der
Militärdiktatur 1984; in der Sowjetunion und den Ländern Osteuropas
nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 – hier zum größten Teil
nicht durch sauberere Produktion, sondern durch den Zusammenbruch
der Wirtschaft nach dem Wegfall der Subventionen. In Indien und
China werden die Bemühungen um Umweltschutz oftmals vor Ort nicht
umgesetzt (>>
mehr).
Das Zeitalter des Öls
Seit 1920 wurde in den USA, seit 1950 im Rest der Welt zunehmend
Kohle durch Öl ersetzt. Dies hatte weitreichende Folgen: Öl konnte
leichter transportiert und genutzt werden als Kohle, und daher wurde
die relativ konzentrierte (aber damit auch durch zentrale Maßnahmen
leichter zu bekämpfende) Luftverschmutzung durch Kohleverbrennung
durch eine weiträumigere Luftverschmutzung durch die Verbrennung von
(dafür jedoch etwa saubererem) Öl abgelöst. Ein Symbol für dieses
neue Zeitalter ist das Auto, das die Eisenbahn als technisches
Transportmittel Nr. 1 verdrängte.
Luftverschmutzung durch Autos
Die entscheidende Entwicklung war die Einführung des Fließbands: Es
ließ Autos erschwinglich werden, und die Massenmotorisierung begann
– zuerst in den USA, dann in Europa und zuletzt in Japan und
Ostasien. 1900 waren Automobile noch eine Seltenheit, 1996 gab es
weltweit 500 Millionen von ihnen. Sie lösten ab den 1960er Jahren
die Kohlefeuerung als schlimmste Verschmutzungsursache ab. Autos
geben vor allem Kohlenmonoxid, Stickstoffoxide und
Kohlenwasserstoffe ab, die zum “Sommersmog”
beitragen. Dieser wurde seit den 1940er Jahren – zuerst in Los
Angeles – beobachtet, er entsteht, wenn leichtflüchtige
Kohlenwasserstoffe und Stickoxide unter intensiver
Sonneneinstrahlung Ozon bilden (>> Die
wichtigsten Schadstoffe).
Seit den 1920er Jahren wurde dem Benzin
Tetraethylblei zugesetzt, um unkontrollierte Selbstentzündungen des
Benzins (“Klopfen”) zu verhindern. Dies führte im Laufe der Zeit zu
hohen Bleikonzentrationen im Boden entlang der Straßen und zu erhöhten
Bleiwerten im Blut. Blei wird in Knochen eingelagert und
reichert sich daher im Laufe der Zeit an; eine chronische
Bleivergiftung kann zu Schädigungen der Blutbildung, des
Nervensystems und von Embryos führen. 1967 wurde verbleites Benzin
in den Großstädten der Sowjetunion verboten, in den USA begann der
Übergang zu bleifreiem Benzin in den späten 1970er Jahren, und in
Europa in den 1980er Jahren. Die Bleikonzentration in der Luft sank
in den USA zwischen 1977 und 1994 um etwa 95 Prozent, auch die Werte
im Blut sanken deutlich. (Als Parallele zum heutigen Widerstand
gegen den Klimaschutz (>> mehr)
verkündete die Autoindustrie damals ein Massensterben der Motoren,
falls Blei verboten werden sollte; und die ersten Hersteller, die
Motoren für bleifreies Benzin anboten, kamen aus Japan. Die
vergleichsweise unbedeutende Autoindustrie in der Sowjetunion
erleichterte wahrscheinlich deren ungewohnte Vorreiterrolle.)
Bleifreies Benzin war auch die Voraussetzung für den Einsatz von
Katalysatoren, mit denen in den letzten Jahren die Schadstoffmengen
der Autoabgase verringert wurde. Ein Teil des erreichten
Fortschritts wurde aber durch die zunehmende Anzahl an Autos sowie
durch höhere Fahrleistungen wieder aufgehoben. In anderen Fällen
setzt die Automobilindustrie bestehende Techniken zur Abgasreinigung
nicht konsequent um: So können Stickoxide, in aufgrund der höheren
Verbrennungstemperaturen vor allem in Dieselmotoren gebildet werden,
mittels eines selektiver katalyischer Reduktion (SCR) genannten
Verfahrens (in Deutschland als "AdBlue" bekannt) zu 90 Prozent aus
den Autoabgasen entfernt werden. 2003 wurde aber bekannt, dass
LKW-Hersteller ihre Fahrzeuge so einstellen, dass die Grenzwerte
außerhalb des Testzyklus überschritten werden; nach Aufdeckung des
VW-Abgasskandals im Jahr 2015 wurde bekannt, dass dieses auch bei
PKW üblich ist (im Falle von VW sogar mittels Verstoß gegen
gesetzliche Vorschriften [1270]).
Globale Luftverschmutzung
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde die
Luftverschmutzung zu einem länderübergreifenden Phänomen. Dabei
spielte die “Politik der hohen Schornsteine” eine zentrale Rolle,
aber auch die zunehmende Bevölkerung und ihre Verstädterung: 1950
gab es drei Ballungsgebiete mit mehr als 10 Millionen Einwohnern auf
der Welt (sogenannte Megacities), 1997 bereits zwanzig.
Saurer Regen
In den 1960er Jahren erkannten skandinavische Wissenschaftler, dass
die Versauerung der Flüsse und Seen Südschwedens und Norwegens durch
Schwefel- und Stickstoffoxide aus England verursacht wurde ("Saurer
Regen", der durch die Reaktion dieser Stoffe mit Wasserdampf in der
Atmosphäre entsteht); Luftverschmutzung wurde als globales Problem
erkannt. Entstanden war das Problem durch höhere Schornsteine, die
lokale Umweltprobleme minderten, aber die Schadstoffe höher
aufsteigen, länger in der Atmosphäre bleiben und weiter verteilt
werden ließen. Bald zeigte sich, dass auch in Kanada (durch Abgase
aus den USA) und in Japan (durch Abgase aus China) die Seen
versauerten. Mit Messinstrumenten auf Satelliten konnten die
Schwefeldioxid- und Stickstoffoxidwolken ab den 1990er Jahren dann
auch direkt erfasst werden. Saurer Regen schädigte ausgedehnte
Waldgebiete (“Waldsterben”) und die Lebensgemeinschaften der Flüsse
und Seen; er ließ auch Kalkstein und Marmor verfallen, wovon einige
der bedeutendsten Kulturdenkmäler der Welt, aber auch Brücken und
andere Gebäude betroffen waren.
Mit der Verringerung der Emissionen an Schwefeldioxid und
Stickstoffoxid ging das Problem im Westen zurück; allerdings steigen
in China die Emissionen durch die zunehmende Kohleverbrennung an: 60
Prozent des Landes sind von Saurem Regen betroffen, ebenso wie
Japan, Taiwan, Korea und die Philippinen.
Das Ozonloch
Die 1929 erstmals hergestellten “FCKW”
(Fluorchlorkohlenwasserstoffe, chemische Substanzen, die Fluor,
Chlor und Kohlenstoff enthalten) haben viele gute Eigenschaften: Sie
sind ungiftig, nicht entzündlich, leicht zu verarbeiten und
reagieren nicht mit anderen Stoffen. So wurden sie bald vor allem
als Kühlmittel in Kühlschränken und Klimaanlagen, als Treibgas in
Spraydosen und als Lösemittel verwendet. 1971 entdeckte der Chemiker
James Lovelock (siehe >> hier)
diese FCKW in der Atmosphäre. Lovelock hatte sie nur als Marker für
andere Formen industrieller Luftverschmutzung betrachtet, die FCKW
selbst hielt er für ungefährlich. Dem amerikanischen Chemiker Sherwood
Rowland fiel aber auf, das die gemessenen Konzentrationen
in etwa der weltweiten Produktion bis zu diesem Zeitpunkt
entsprachen. Was, fragte er sich, würde schließlich mit ihnen
passieren? Er setzte seinen aus Mexiko stammenden Kollegen Mario
Molina auf die Frage an, und im Juni 1974
veröffentlichten beide die Hypothese, dass die FCKW in die
Stratosphäre aufsteigen können, dort von kurzwelligem Sonnenlicht
aufgebrochen werden und dass das dabei freigesetzte Chlor
Ozon-Moleküle der Ozonschicht (siehe >> hier)
zerstört.
Dieser Beitrag blieb zunächst fast unbeachtet. Die FCKW-Industrie
machte mittlerweile acht Milliarden Dollar Umsatz im Jahr und griff
Rowland und Molina als Panikmacher an, und im Laufe der Jahre geriet
das Thema von der Tagesordnung. Erst 1985 erschien eine Publikation
des britischen Geophysikers Joe Farman, dass die Ozonschicht
über der Antarktis ausdünnte – schon seit 1977. Farman hatte die
Veröffentlichung hinausgezögert, da er seinen eigenen Erkenntnissen
nicht recht traute – zumal ein NASA-Satellit seit fünf Jahren
ebenfalls den Ozongehalt gemessen hatte und keinen Rückgang
feststellte. (Nach Farmans Veröffentlichung überprüfte die NASA ihre
Daten: Die eigentlichen Satellitendaten zeigten seit Jahren die
gleiche Tendenz – waren aber vom Computer als Fehler aussortiert
worden, weil sie nicht den Erwartungen entsprachen.) Der gemessene
Rückgang war noch schlimmer als der von Rowland und Molina
erwartete.
Bald wurden auch “Ozonlöcher” über Chile und Australien entdeckt.
Als Ursache wurden im Jahr 1987 von einer NASA-Expedition in die
Antarktis die von Rowland und Molina verdächtigten FCKW bestätigt.
Warum aber der gemessene Rückgang soviel stärker war als der von
Rowland und Molina erwartete, wurde von dem in Deutschland tätigen
niederländischen Meteorologen Paul Crutzen
entdeckt: Es lag an den stratosphärischen Eiswolken der Antarktis.
Deren Oberfläche erleichterte Reaktionen, bei denen Chlor
freigesetzt wurde. Dieses Chlor konnte dann mit der aufgehenden
Sonne im Frühjahr seine zerstörerische Wirkung entfalten – ein
einziges Chloratom kann bis zu 100.000 Ozonmoleküle vernichten.
(Rowland und Molina sowie Crutzen sollten 1995 für ihre Forschungen
den Nobelpreis für Chemie erhalten.) Die Folgen der ausgedünnten
Ozonschicht wurden auch immer klarer: Verstärkte UV-Strahlung
schädigt Plankton und damit die Nahrungskette in den Meeren,
schädigt Pflanzen und damit die Nahrungsmittelproduktion, verursacht
Hautkrebs und Grauen Star beim Menschen.
Das “Ozonloch” rief eine ungewöhnlich schnelle politische Antwort
hervor: Das Protokoll von Montreal (1987) und darauf folgende
Zusatzvereinbarungen führten ab 1988 zu einem Rückgang der
FCKW-Produktion um rund 80 Prozent. Das Protokoll von
Montreal wurde noch vor dem endgültigen Nachweis der FCKW
als Verursacher des Ozonlochs verabschiedet, insofern ist es das
erste Beispiel des Vorsorgeprinzips im Umweltschutz. Anderseits
waren sie der Beweis, dass der Mensch globale Umweltveränderungen
auslösen kann. Und: FCKW sind in der Atmosphäre sehr stabil, so dass
die Ozonschicht in der Stratosphäre nur langsam heilt und wohl noch
bis ins Jahr 2070 ausgedünnt bleiben wird. Insbesondere hellhäutige
Menschen in sonnigen Ländern wie Australien sind hiervon durch
höheres Hautkrebsrisiko betroffen.
Weblink: >> In
letzter Minute – Ein Beitrag der ZEIT zum Montrealer
Protokoll.
Megacities
In den Megacities sind die Menschen besonders von den Auswirkungen
des Rauches und des Autoverkehrs betroffen; die zehn Städte auf der
Erde mit der schlechtesten Luftqualität sind nach Angaben der
Weltbank Kairo (Ägypten), Delhi und Kolkata (Kalkutta) in Indien,
Tianjin und Chongqing in China, Kanpur und Lucknow (Indien), Jakarta
(Indonesien) sowie Shenyang und Zhengzhou (Gina). 2007 schätzte die
WHO, dass die Luftverschmutzung jedes Jahr 865.000 Menschen tötet,
dazu kommen Millionen von Menschen, bei denen sie
Atemwegserkrankungen auslöste oder verschlimmerte oder gar Krebs
auslöste. Die zehn am meisten verschmutzten Orte der Erde nach
Angaben des Blacksmith Institute (eine private Organisation, die
Schwerpunkte der Verschmutzung identifiziert und Programme zu deren
Sanierung anregt, www.blacksmithinstitute.org),
sind auf der folgenden Karte dargestellt.
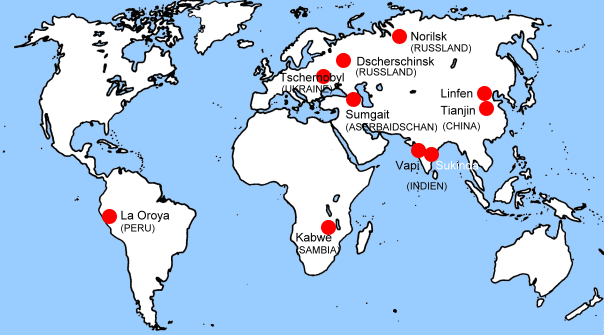
Die zehn meist verschmutzten Orte
der Welt im Jahr 2007. Nach Angaben des Blacksmith
Institute. Mehr Informationen, auch zu den einzelnen Orten, auf der
Webseite
www.worstpolluted.org (englischsprachig).
Lichtverschmutzung
Von vielen noch nicht als Problem erkannt: Auch Licht “verschmutzt”
die Umwelt. Ein Fünftel der Menschheit (darunter die meisten
Deutschen) kann nachts die Milchstraße nicht mehr erkennen, da der
Nachthimmel von künstlichem Licht überstrahlt wird. Die Folgen für
den Menschen sind neben eingeschränkter Beobachtungsmöglichkeit für
Hobbyastronomen wohl vor allem spiritueller Natur (der Blick in den
Nachthimmel kann uns unseren Platz im Universum zeigen und könnte so
vielleicht so manchen menschlichen Größenwahn korrigieren); aber
viele Tiere leiden konkret: So laufen etwa frisch geschlüpfte
Meeresschildkröten in Hotels statt ins Meer, da sie vom Licht
angezogen werden (das früher nachts auf der Meeresoberfläche
reflektierte und damit die richtige Richtung wies); Insekten und
Vögel fliegen (“angezogen wie die Motten vom Licht”) gegen hell
erleuchte Häuser.

In einer klaren Nacht sind auf
Satellitenaufnahmen die Leuchtflecken der Städte
deutlich zu erkennen. Foto: NASA
Abhilfe wäre einfach: Für die Außenbeleuchtung gibt es
längst ausschließlich nach unten strahlende Lampen. Immerhin wächst
langsam ein Bewusstsein für das Problem: In den USA gibt es erste
Dark-Sky-Parks, der englische Peak District National Park
bewirbt sich um einen solchen Titel.
Die Folgen der Luftverschmutzung
Zuverlässige Statistiken aus der Frühzeit der Industrialisierung
gibt es nicht, mögliche Folgen der Luftverschmutzung interessierten
erst ab den 1950er Jahren. Aber einen Eindruck können die Zahlen aus
den osteuropäischen Städten geben, die nach dem Zusammenbruch der
Sowjetunion zugänglich wurden und deren Belastung den
frühindustriellen Städten ähnlich ist: In Oberschlesien betrug die
Kindersterblichkeit 44 von 1000 Kindern und drei Viertel aller
zehnjährigen Kinder brauchten ständige ärztliche Behandlung. In den
tschechischen Industriegebieten lag die Lebenserwartung um 4 Jahre
unter dem Durchschnitt.
Es gibt Schätzungen, nach denen die Luftverschmutzung im 20.
Jahrhundert insgesamt 40 Millionen Menschenleben forderte, zur Zeit
kommen nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation 865.000
Menschen im Jahr vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern
dazu – zwar ist die Luftqualität insgesamt besser geworden, die
Verschmutzung trifft aber mehr Menschen. Nach über 30 Jahren
Umweltpolitik sind dagegen in den reichen Industrieländern die
offenkundigsten Belastungen heute beseitigt, die Atemluft ist wieder
relativ sauber. Auch wenn einzelne Probleme (>>
Stickstoffoxide, >>
Feinstaub; siehe auch >> Chemikalien
in der Umwelt) akut bleiben: Das größte Problem sind hier
heute die nicht unmittelbar zu erkennenden Belastungen wie der
>> Klimawandel,
der etwa zur gleichen Zeit wie das Ozonloch in den Blickwinkel der
Öffentlichkeit geraten ist – wahrscheinlich das wichtigste
Umweltthema der kommenden Jahrzehnte. Da die nötigen Maßnahmen auch
die Industrien der Entwicklungs- und Schwellenländer betreffen
(>> mehr),
würde sich bei ihrer Umsetzung auch die Luftverschmutzung
reduzieren.
Weiter zu:
>> Klimawandel
Zurück zu:
>> Übersicht
Industriezeitalter