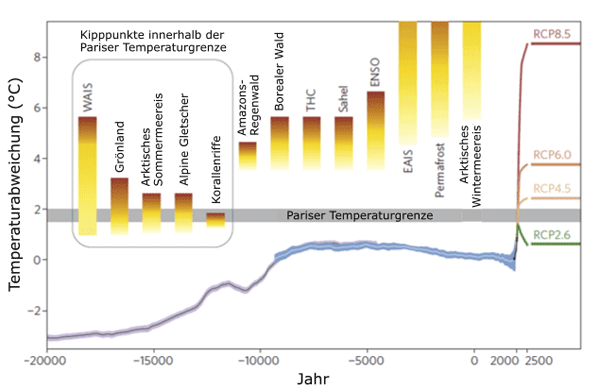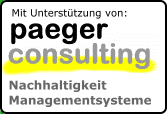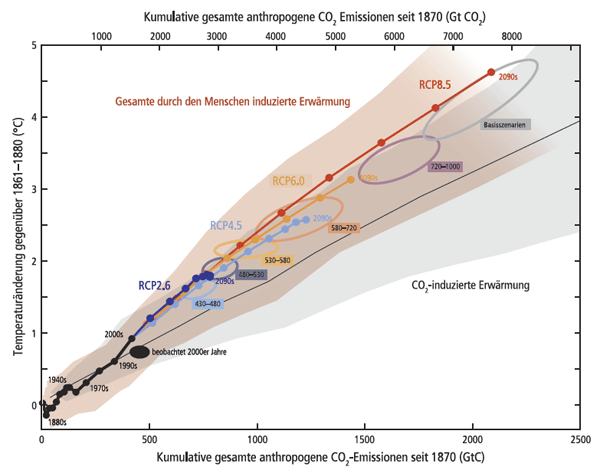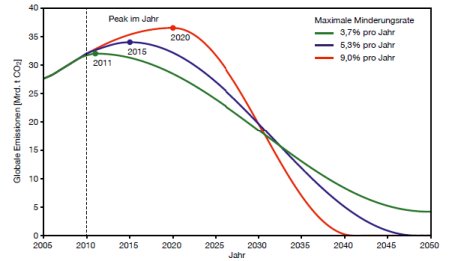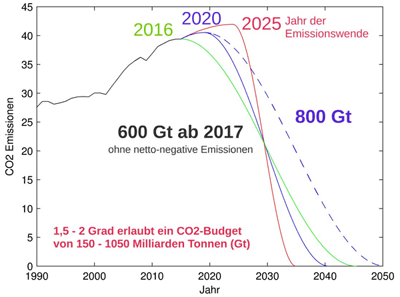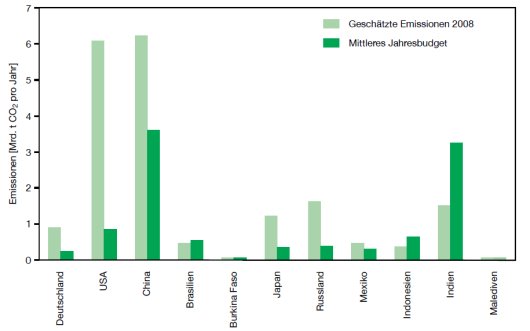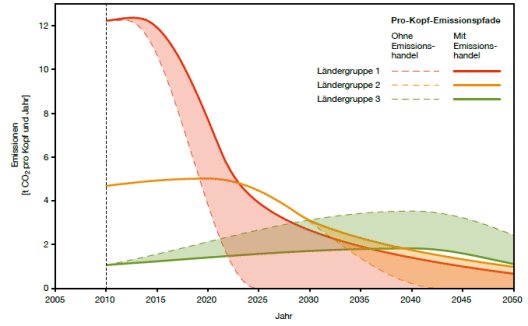Strategien für die Zukunft
Den Klimawandel begrenzen
Die Folgen des Klimawandels
sind heute schon spürbar; die möglichen Folgen eines weiteren
Klimawandels potenziell katastrophal. Daher haben fast alle Länder
der Welt mit dem Pariser
Übereinkommen von 2015 vereinbart, die Erwärmung der Erde auf
deutlich unter zwei Grad Celsius – wenn möglich auf 1,5 Grad Celsius
–, zu begrenzen. Warum diese Grenze gewählt wurde und was diese für
unsere Zukunft, vor allem für unsere zukünftigen
Treibhausgas-Emissionen, bedeutet, wird auf dieser Seite
dargestellt.
Warum deutlich unter zwei Grad?
Ausgangspunkt des Pariser Übereinkommens ist die UN-Klimarahmenkonvention
von 1992, in der vereinbart wurde, “die Stabilisierung der
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre auf einem Niveau zu
erreichen, auf dem eine gefährliche anthropogene [vom Menschen
verursachte, der Autor] Störung des Klimasystems verhindert wird.”
Basierend auf den Erkenntnissen der Klimaforscher – die regelmäßig
in den Berichten des
UN-Weltklimarates zusammengefasst werden – wurde über 20 Jahre
lang diskutiert (siehe die Seite Klimapolitik),
was diese Aussage konkret bedeutet. Früh wurde eine Begrenzung der
Erderwärmung auf höchstens zwei Grad Celsius vorgeschlagen – in
Deutschland etwa vom Wissenschaftlichen Beirat für Globale
Umweltveränderungen (WBGU, 802)
–, und dieses wurde auch zum ersten politischen Ziel. Auf der 16.
UN-Klimakonferenz 2010 wies aber vor allem die Allianz kleiner
Inselstaaten (AOSIS) darauf
hin, dass eine Erderwärmung um zwei Grad Celsius aufgrund des damit
verbundenen Anstiegs des Meeresspiegels das Ende vieler Inselstaaten
bedeuten würde. Neben den Befürchtungen der Inselstaaten spielten
dabei auch neuere Erkenntnis der Klimaforschung eine Rolle, wonach
eine Erwärmung um zwei Grad Celsius unter anderem bedeuten, dass 10
Millionen Menschen zusätzlich von Fluten an den Küsten betroffen
wären; dass zahlreiche Korallenriffe abstürben; im Mittelmeerraum
und im südlichen Afrika 20 bis 30 Prozent weniger Wasser verfügbar
wäre und die Ernten in tropischen Regionen um 10 bis 20 Prozent
zurückgehen würden (siehe: Womit wir
in Zukunft rechnen müssen und 5.
UN-Klimareport). Und: das Erreichen der befürchteten
"Kipppunkte" im Klimasystem, das zu abrupten
Klimaänderungen führen würde, wäre ebenfalls bei einer
Erwärmung um zwei Grad Celsius deutlich wahrscheinlicher wäre als
bei 1,5 Celsius (810).
Den aktuellen Stand unseres Wissens zu diesen Kippelementen fasst
die folgende Abbildung zusammen:
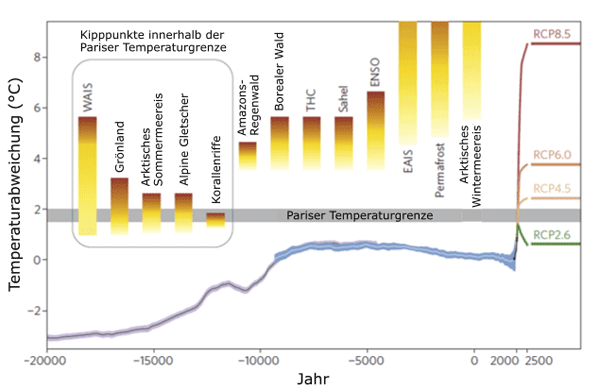
Kippelemente des Klimasystems
und ihr Zusammenhang mit der Erderwärmung. Der
Temperaturbereich, in dem der jeweilige Kipppunkt liegt, ist als
Säule dargestellt. Dabei steht WAIS für Westantarktisches Eisschild,
THC für thermohaline Zirkulation, ENSO für El Niño-Southern
Oscillation und EAIS für Ostantarktisches Eisschild. Lesebeispiel:
Das arktische Sommermeereis kann bei einer Erderwärmung von 1 bis 3
Grad Celsius abschmelzen. Die untere Kurve bildet den
Temperaturverlauf der letzten 22.000 Jahre ab und die Erderwärmung,
die aus vier verschiedenen Szenarien (RCP steht für Representative
Concentration Pathway), mit denen die Klimaforscher arbeiten,
ergibt. Mehr dazu im folgenden Text. Abb. nach Schellnhuber,
Rahmstorf, Winkelmann (504).
Die Abbildung oben zeigt zweierlei: Zum einen lässt sich für die
Kippelemente mit dem heutigen Wissen kein genauer "Kipppunkt"
angeben, sondern lediglich ein Temperaturbereich, in dem das
Eintreten zunehmend wahrscheinlicher wird (was mit der dunkler
werdenden Färbung dargestellt ist). Zum anderen kann selbst mit
Einhalten der Pariser Ziele nicht ausgeschlossen werden, dass einige
Kipppunkte erreicht werden (die "Kipppunkte innerhalb der Pariser
Temperaturgrenze" in der Abbildung); so warnt der IPCC in seinem Sonderbericht über den
Ozean und die Kryosphäre von 2019 davor, dass die tropischen
Korallenriffe bereits bei einer Erwärmung um 1,5 Grad Celsius schwer
geschädigt werden – bis hin zu ihrem Untergang. Bereits in seinem
Sonderbericht 2018 (siehe unten, deutsche
Übersetzung der Zusammenfassung) hatte der IPCC darauf
hingewiesen, dass auch der Anstieg des Meeresspiegels bei einer
Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius weiter andauern
würde (was u.a. auf die oben dargestellten Kippelemente Grönland-
sowie Westantarktisches Eisschild [genauer: deren Abtauen]
zurückzuführen ist) und auf Dauer auch bei einer Begrenzung zwischen
1,5 und 2 Grad Celsius mehrere Meter betragen könnte.
Warum wird dann nicht gefordert, den Klimawandel auf "sichere" ein
Grad Celsius zu begrenzen? Ganz einfach: Dafür haben wir zu lange
gewartet. Das ist schlicht nicht mehr möglich, denn die Erde hat
sich bereits um 1,1 Grad erwärmt und
eine weitere Erwärmung um 0,3-0,4 Grad Celsius ist schon in der
Pipeline (020):
aufgrund der Trägheit des Klimasystems haben die heutigen
Treibhausgase ihr "Potenzial" noch gar nicht realisiert, sondern
werden mittelfristig zu einer Temperaturerhöhung von 1,4 Grad
Celsius führen. Die Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu
begrenzen, ist – bei unverzüglichen und drastischen Maßnahmen – das
beste, was heute (vielleicht) noch möglich ist. Mit der Machbarkeit
des Zwei-Grad-Ziels hatte sich der IPCC bereits in seinem fünften
Klimareport beschäftigt und gefunden, dass die notwendigen
Maßnahmen dringend, aber wirtschaftlich gut verkraftbar seien. Auf
dem Pariser Klimagipfel wurde der IPCC nun beauftragt, auch die
Machbarkeit der Pariser Ziele – namentlich die Begrenzung der
Erderwärmung auf 1,5 °C – zu untersuchen, was er in einem 2018
vorgestellten Sonderbericht
tat. Zentrales Ergebnis: Bis 2030 müssen die globalen
Treibhausgasemissionen um etwa 45 Prozent zurückgehen, bis 2050
müssen sie auf netto null (d.h., es dürfen nicht mehr Treibhausgase
ausgestoßen werden, als von natürlichen Ökosystemen – und/oder ggf.
bis dahin entwickelten technischen Systemen – aufgenommen werden
können) reduziert werden. Dies erfordert schnelle und weitreichende,
in ihrem Ausmaß beispiellose Systemübergänge in Energie-,
Land-, Stadt- und Infrastruktur- (einschließlich Verkehr und
Gebäude) sowie in Industriesystemen. (Auch andere Treibhausgase,
sowie die Emissionen von Ruß, müssen ebenfalls einschneidend
vermindert werden; hier kommen auch noch andere Mitspieler wie die
Landwirtschaft [Methan- und Lachgasemissionen] ins Spiel.)
Vision 350 ppm
Die Ziele des Pariser Übereinkommens sind ein globaler Kompromiss –
wie oben auch zu lesen, verhindern sie nicht das Eintreten schwerer
Folgen des Klimawandels. Zwar dürfte kurzfristig mehr nicht möglich
sein, längerfristig aber schon: Die vom amerikanischen
Umweltjournalisten Bill McKibben initiierte Initiative 350.org setzt
sich dafür ein, durch aktive Maßnahmen der Kohlenstoffspeicherung
etwa in Böden und durch die Forstwirtschaft
die Kohlendioxid-Konzentration in der Atmosphäre wieder auf 350 ppm
zu senken. Mehr: >> www.350.org.
Ohnehin wäre bei einer Zielerreichung – also netto
null im Jahr 2050 – das Thema noch nicht vorbei: denn zu den
Ökosystemen, die etwa ein Viertel des freigesetzten Kohlendioxids
aufnehmen, gehören die Weltmeere. Dadurch werden diese saurer,
ihr pH-Wert sinkt. Um dieses zu beenden, muss der Ausstoß von
Kohlendioxid durch den Menschen komplett beendet werden.
Anstieg der mittleren
Erdoberflächentemperatur in Abhängigkeit von der Gesamtmenge an
Kohlendioxid, das durch menschliche Aktivitäten in die
Atmosphäre freigesetzt wurde/wird (Achtung: Zahlenangaben in
Kohlenstoff. Da 1 Tonne Kohlenstoff 3,667 Tonnen Kohlendioxid
ergeben, muss der Wert mit 3,667 multipliziert werden). Schwarz
dargestellt sind Messwerte, farbig dargestellt die Freisetzung, die
aus den vier Emissionsszenarien folgt. Die farbige Fläche gibt den
Unsicherheitsbereich an. Quelle der Abbildung: Abbildung 2.3 aus IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht.
Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn,
2016.
Da die Erderwärmung aufgrund der langen Verweildauer wesentlich –
aber nicht alleine (siehe Der
Klimawandel) – vom Kohlendioxid abhängt, stellt sich die
Frage, wieviele Emissionen denn noch erlaubt sind. Eine erste
Untersuchung haben im Jahr 2009 der Klimaforscher Malte Meinshausen
von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK) und Kollegen
veröffentlicht (830): Um
mit einer Wahrscheinlichkeit von 67 Prozent die Zwei-Grad-Obergrenze
einzuhalten, dürften ab dem Jahr 2010 bis zum Jahr 2050 nur noch
rund 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen werden. Diese
Überlegung nahm der WBGU in seinem Sondergutachten 2009 "Kassensturz
für den Weltklimavertrag – Der Budgetansatz" auf. Er wies
darauf hin, dass diese "Budget" (von 750 Milliarden Tonnen) bei dem
damaligen Emissionsraten in 25 Jahren aufgebraucht sein, bei
steigenden Emissionen sogar noch schneller. Daher sei es wichtig,
mit dem Zurückfahren der Emissionen so schnell wie möglich zu
beginnen, damit spätere Verringerungen nicht zu drastisch ausfallen
müssen. Diesen Zusammenhang zeigt die folgende Abbildung:
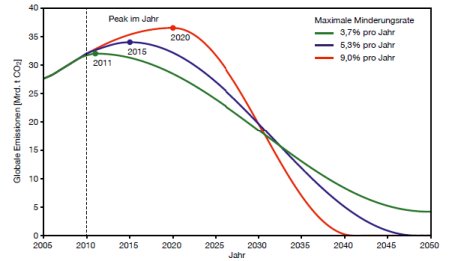
Möglicher Verlauf der
Kohlendioxid-Emissionen 2010 bis 2050, bei denen
weltweit insgesamt 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen
würden
und die Erderwärmung auf 2 Grad beschränkt bliebe. Je später die
Wende
beginnt, desto stärker muss später reduziert werden - und desto
unwahrscheinlicher
wird die Einhaltung der 2-Grad-Grenze. Abb. aus WBGU
Sondergutachten 2009.
Leider sind die Emissionen seither auf aktuell 42 Milliarden
Tonnen (834) angestiegen,
stärker als vom WBGU im schlimmsten Fall angenommen – und das Budget
ist bei einer Begrenzung der mittleren Erderwärmung auf deutlich
unter zwei Grad Celsius und möglichst zwei Grad Celsius daher
kleiner: der IPCC geht in seinem Sonderbericht 2018 von 580
Milliarden Tonnen Kohlendioxid aus, wenn die Erderwärmung mit
50-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf 1,5 Grad Celsius begrenzt
werden soll (und nur 420 Milliarden Tonnen, wenn das Ziel mit
66-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreicht werden soll, wobei beide
Werte mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind [838]).
Der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom PIK (der am WBGU
Sondergutachten 2009 beteiligt war), geht etwas großzügiger von 600
Milliarden Tonnen aus, aber selbst dann ist die daraus
folgende Emissionsminderungskurve (siehe Abbildung unten)
mittlerweile viel drastischer als die von 2009: das ist der Preis
dafür, dass wir bisher nicht so gehandelt haben, wie die Dimension
des Klimawandel es erfordert hätte.
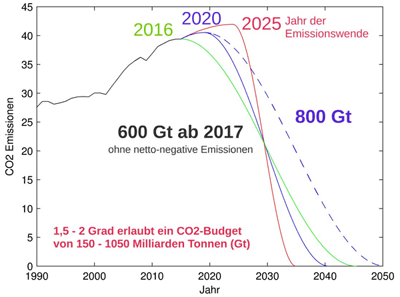
Emissionsverläufe, die mit dem Pariser
Übereinkommen vereinbar sind:
je länger wir ernsthafte Maßnahmen herauszögern, umso drastischer
wird der Handlungsbedarf. Abb.: Stefan Rahmstorf, cc
by-sa 4.0.
Vor allem zeigt die neue Kurve, dass der Übergang zu einer Netto-Null-Kohlendioxidemission
mittlerweile deutlich vor dem Jahr 2050 erfolgen muss. Eine
Alternative, wenn wir dieses nicht hinbekommen, sind sogenannte
"Überschuss-Szenarien" – dabei wird ein Überschreiten des
Emissionsbudgets und der des Pariser Ziels in Kauf genommen, die
dann später (bei diesem Wort graut es dann allerdings vielen, die
sich an die bisherige Einhaltung von für "später" versprochenen
Maßnahmen erinnern) durch Maßnahmen zur Entnahme von Kohlendioxid
aus der Luft (Aufforstung, noch zu entwickelnde technische Lösungen)
ausgeglichen werden sollen. Damit werden natürlich "übergangsweise"
auch die Folgen der zusätzlichen Erwärmung in Kauf genommen. Aber
grundsätzlich ist die Zielerreichung auch ohne solche
"Überschuss-Szenarien" immer noch möglich, wie der IPCC in seinem
Sonderbericht 2018 und andere Überlegungen zeigen; mit diesem Thema
beschäftigen wir uns auf der nächsten
Seite.
Vorher wollen wir uns an dieser Stelle aber noch mit zwei weiteren
Fragen beschäftigen, die für die Begrenzung des Klimawandels von
zentraler Bedeutung sind:
- Warum sind wir bisher eigentlich
einem Weg gefolgt, der uns überhaupt in die heutige Lage gebracht
hat? Was ist falsch gelaufen, und was können wir ändern, damit es
in Zukunft besser wird?
- Bisher haben wir immer nur von den
globalen Treibhausgas-Emissionen gesprochen, ohne deren Verteilung
zu betrachten. Aber historisch haben nicht alle Länder im gleichen
Ausmaß (oder entsprechend ihrem Anteil an der Weltbevölkerung) zu
der heutigen Situation beigetragen, und auch die Folgen des
Klimawandels werden sehr ungleich sein: manche Regionen der Welt
sind stärker betroffen als andere, und arme Länder haben weniger
Möglichkeiten, sich vor den Folgen des Klimawandels zu schützen
als reiche Länder. Was müssen wir unter dem Aspekt der (globalen)
Gerechtigkeit beachten (nicht nur aus moralischen Gründen, sondern
weil ohne eine gerechte Lösung wahrscheinlich nicht die ganze Welt
an einem Seil ziehen wird)?
Die
Preise sagen nicht die Wahrheit
Bereits im Jahr 2006 hat der Ökonom Sir Nicolas Stern, der im
Auftrag des britischen Schatzkanzlers die Kosten des Klimawandels untersucht hat (zentrales Ergebnis
damals: effektiver Klimaschutz würde ein Prozent der weltweiten
Wirtschaftsleistung kosten; weiter zu machen wie bisher fünf bis
zwanzig Mal so viel), den Klimawandel als "gigantisches
Marktversagen" bezeichnet: Die Kosten, die der Klimawandel
verursachen wird – und die, das ist die Schwäche eines rein
ökonomischen Ansatzes, auch Menschenleben umfassen, die nicht in
Geld umzurechnen sind – spiegeln sich nicht in den Preisen wieder.
In der Tat: diejenigen, die etwa mit fossilen Brennstoffen ihr Geld
verdient haben und immer noch verdienen, die Ölkonzerne und die
Stromkonzerne etwa, die mit Kohlekraftwerken ihr Geld verdienen,
mussten und müssen für die meisten Folgekosten nicht aufkommen,
sondern überlassen diese der (im Falle des Klimawandels: globalen)
Gesellschaft. Die muss mit den Folgen umgehen und bezahlen, und zwar
ganz unabhängig davon, wie sie am Verbrauch teilgenommen und damit
die Annehmlichkeiten genossen hat oder nicht. Würden die Kosten des
Klimawandels (und anderer Umweltverschmutzungen) von den
Verursachern zu tragen – und das wäre letztendlich immer der Kunde,
denn die Ölkonzerne und Stromkonzerne würden die Kosten natürlich
ihren Kunden weiterbelasten – wäre zumindest dem ansonsten im
Umweltschutz angestrebten Verursacherprinzip Folge getan: wer den
Nutzen hat, soll auch die Kosten tragen. Wie hoch die
"Klimaschadenkosten" für den Ausstoß von Treibhausgasen wären, hat
das Umweltbundesamt im Jahr 2019 ausgerechnet (842):
im Jahr 2016 haben sie für den Ausstoß von einer Tonne
Kohlendioxid-Äquivalent 180 Euro betragen, im Jahr 2030 205
Euro. So hoch müsste also ein "gerechter" Preis, der die Nutzer
belastet, sein; ein Preis von 180 Euro bedeutet zum Beispiel, dass
ein Liter Benzin um 52 Cent teurer würde (843).
Ein solcher Preis würde dazu führen, dass die Verbraucher am
Preisschild (auch) erkennen, welche Umweltbelastung mit einem Kauf –
um beim Beispiel zu bleiben: mit jedem Tanken – verbunden ist. Damit
würde er zum einen dazu führen, dass umwelt-/klimafreundlichere
Alternativen im Vergleich billiger würden; zum anderen würde die
Entwicklung klimafreundlicherer Technologien attraktiver (da diese
voraussichtlich mehr Käufer finden würden).
CO2-Preis: Emissionshandel oder Steuer?
Ein Versuch, die Preise wenigstens etwas aussagekräftiger zu
machen, stellt der Emissionshandel (siehe Beispiel europäischer
Emissionshandel) dar. Weltweit gibt es 38 Länder, in denen es
Emissionshandelssysteme gibt, dazu kommen 27 regionale Systeme (854).
Bei diesen steht nicht das Verursacherprinzip, also eine an den
Klimaschadenskosten orientierte Bepreisung, sondern die
Vermeidungskosten im Vordergrund: Aus den Klimazielen werden
"Emissionsrechte" abgeleitet, für die Emissionsberechtigungen
vergeben werden. Diese können gehandelt werden, wodurch der Markt
dafür sorgen wird, dass Maßnahmen dort durchgeführt werden, wo sie
am billigsten sind – das einzelne Unternehmen wird sich ja immer
fragen, ob es billiger ist, Emissionsberechtigungen zu kaufen oder
seine Emissionen zu verringern. Die Einhaltung der Ziele kann zudem
über die Menge der ausgegebenen Emissionsberechtigungen
sichergestellt werden. Viele Ökonomen (wie die Wirtschaftsweisen in
ihrem Sondergutachten 2019 "Aufbruch
zu einer neuen Klimapolitik") halten daher eine Ausweitung des
EU-Emissionshandels auf alle relevanten Sektoren wie Verkehr und
Wohnungsheizung für den besten – weil mit den insgesamt geringsten
Kosten verbundenen – Weg, die Erreichung der EU-Klimaziele
sicherzustellen (und sehen einen umfassenden globalen
Emissionshandel als den besten Weg an, die globalen Ziele zu
erreichen). Andere Wege, wie ein nationaler Emissionshandel (der zum
Beispiel dazu verführen könnte, Emissionen in das Ausland zu
verlegen; ein als "carbon leakage" bekanntes Problem, das
auch beim EU-Emissionshandel besteht und wogegen letztendlich nur
ein – zur Zeit aber wohl kaum umsetzbarer – globaler
Emissionshandel) oder eine Steuer auf Kohlendioxid sind für sie
allenfalls eine Übergangslösung.
Die Anhänger einer Kohlendioxid-Steuer sehen die bessere politische
Steuerbarkeit als Vorteil: so kann nur eine Steuer die
Klimaschadenskosten abbilden und damit konsequent das
Verursacherprinzip umsetzen, eine Steuer kann zudem für einzelne
Sektoren unterschiedlich hoch sein (etwa für Kraft- und
Brennstoffe). Konjunkturschwankungen, die zum Rückgang der
Zertifkatepreise und damit der Anreize für eine Verminderung der
Emissionen führen (ein Problem, unter dem der europäische
Emissionshandel lange litt), wirken sich auf eine Steuer weniger
direkt aus (aber natürlich kann im Fall einer Wirtschaftskrise auch
der politische Druck für eine Steuersenkung steigen). Die Auswirkung
einer Steuer auf die Emissionsminderung müsste aber im Vorfeld
bestimmt werden und ist daher unsicherer; eine Nachsteuerung ist
jedoch immer möglich. Die Höhe einer Steuer ist dafür vorhersehbarer
als ein Marktpreis für Emissionszertifikate, was Planungen und
etwaig notwendige Maßnahmen gegen soziale und wirtschaftliche Härten
leichter macht. Schließlich ist eine Steuer einfacher umzusetzen:
Börsen etc. für den Zertifikatehandel werden nicht benötigt. CO2-Steuern
sind ebenfalls weit verbreitet: es gibt sie in 25 Ländern und 4
regionale CO2-Steuern (854).
Welcher Weg auch immer gegangen wird: es besteht ein zunehmender
Konsens darüber, dass ein Preis für den Ausstoß von Treibhausgasen
ein zentrales Element bei der Begrenzung des Klimawandels ist.
Zuletzt haben mehr als 3.500 US-Ökonomen in einem Aufruf eine
Kohlendioxid-Steuer gefordert, darunter alle vier noch lebenden
Ex-Präsidenten der Federal Reserve und 27
Wirtschaftsnobelpreisträger (855).
Und mit dem Klimapaket
2019 ist auch die Bundesregierung (wenn auch aufgrund eines
niedrigen Steuersatzes sehr zögerlich) in die
Kohlendioxid-Besteuerung eingestiegen.
Die
globale Gerechtigkeit
Weder Ursachen noch Folgen des Klimawandels sind gleichmäßig über
die Welt verteilt: Für den Klimawandel zahlen diejenigen am meisten,
die am wenigsten dazu beigetragen haben (Die
Folgen des Klimawandels). Das tief liegende Bangladesh etwa
leidet besonders unter dem ansteigenden Meeresspiegel; aber ein
durchschnittlicher Bewohner von Bangladesh produziert eine Viertel
Tonne Kohlendioxid im Jahr, ein Deutscher rund 10 Tonnen. Die alten
Industrieländer sind ohne Frage die Verursacher
des heute stattfindenden Klimawandels – aber heute ist China
der weltgrößte Verursacher von Kohlendioxid-Emissionen. Lange haben
beide Seiten (alte Industrieländer und aufstrebende Schwellenländer)
diese Situation genutzt, um sich gegenseitig den schwarzen Peter
zuzuschieben – und nichts zu tun. Um den Stillstand zu überwinden,
musste eine Lösung gefunden werden, die sowohl die historische
Verantwortung der alten Industrieländer anerkennt (die besteht
darin, die ärmeren Länder bei der Bewältigung
der Folgen des Klimawandels zu unterstützen), als auch die
künftigen Emissionen gerecht zu verteilen. Was aber ist gerecht?
Mittlerweile besteht weitgehend Einigkeit: jeder Mensch auf der Erde
hat das gleiche Recht auf Kohlendioxid-Emissionen. Das heißt dann:
das verbleibende Kohlendioxid-Budget muss gleichmäßig auf jeden Kopf
der Weltbevölkerung verteilt werden. Jedes Land der Erde erhält also
einen Anteil, der so groß ist, wie es seiner Bevölkerung entspricht
(857). Die Frage nach der
gerechten Aufteilung des Kohlendioxid-Budgets ist nicht mehr so
relevant, da seit dem Pariser Übereinkommen ja ohnehin keine
verbindlichen nationalen Beiträge mehr vorgegeben werden, sondern
freiwillige Beiträge zu leisten sind. Aber sie ist nach wie der
Hintergrund für die Beantwortung der Frage, ob die nationalen
Beiträge der einzelnen Vertragsparteien dann ihrer Verantwortung
angemessen sind.
Daher wollen wir einmal einen Blick darauf werfen, welche
Kohlendioxid-Emissionen denn den einzelnen Ländern bis zum Erreichen
des "netto-null"-Zieles noch (moralisch) "erlaubt" wären. Dazu sehen
wir uns eine Abbildung aus dem Sondergutachten
2009 des WBGU an:
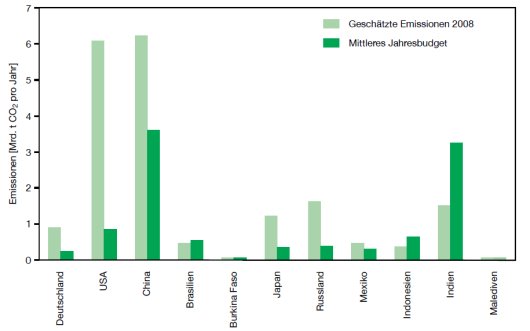
Geschätzte Emissionen an Kohlendioxid aus
fossilen Brennstoffen im Jahr 2008 und mittleres
"erlaubtes" Jahresbudget nach WBGU Option II (siehe Text).
Abb. 5.3-2 aus WBGU
Sondergutachten
2009.
In dem Gutachten sind
zwei Optionen für eine gerechte Verteilung der Emissionsrechte
untersucht werden, uns interessiert hier die Option II, die gleiche
Verteilung pro Kopf der Weltbevölkerung. Die Abbildung stammt – wie
gesagt – aus dem Jahr 2009, der WBGU ist damals noch davon
ausgegangen, dass Zeit bis zum Jahr 2050 ist, hat also das
Emissionsbudget 2010-2050 (750 Mrd. Tonnen Kohlendioxid) pro Kopf
der Weltbevölkerung verteilt. Die Abbildung zeigt das Ergebnis als
"mittleres Jahresbudget". Es zeigt sich, dass Länder, die heute pro
Kopf viel Kohlendioxid produzieren (Ländergruppe 1, Staaten wie die
USA, Deutschland oder Japan), ihre Emissionen sehr stark reduzieren
müssen. Auch die Schwellenländer mit mittlerem Pro-Kopf-Verbrauch
(Ländergruppe 2; besonders relevant: China, Staaten wie Argentinien,
Chile und Mexiko) würden ihre Politik ändern müssen. Die Länder mit
heute niedrigen Kohlendioxid-Emissionen (Ländergruppe 3, besonders
relevant: Indien) dürften sogar noch mehr Kohlendioxid emittieren
als heute. Das trägt den Entwicklungsinteressen solcher Länder, in
denen heute z.B. vielen Menschen noch immer keinen Stromanschluss
haben und mit Holzfeuern kochen, Rechnung. Als Konsequenz ergab
sich, dass die "gerechten" Emissionsreduzierungen sehr
unterschiedlich verlaufen würden:
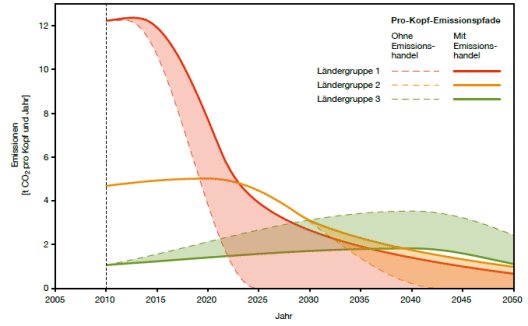
Emissionsverlauf von Ländern der
Ländergruppen 1, 2 und 3 (siehe Text) mit und ohne
Emissionshandel. Abb. 5.3-5 aus WBGU Sondergutachten
2009.
(Der WBGU hat auch untersucht, welche Auswirkungen ein globaler
Emissionshandel auf die Entwicklung hätte – durchgezogene Linie: Die
Länder der Ländergruppe 3 könnten Emissionsrechte an die Länder der
ersten beiden Gruppen verkaufen und damit sowie mit
Technologietransfers ihre Entwicklung auf einer klimaverträglichen
Grundlage beschleunigen und finanzieren. Der Charme dieser Lösung:
Die Industrie- und Schwellenländer hätten ein eigenes Interesse
daran, Ländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan oder Äthiopien
dabei zu helfen, denn nur so blieben ausreichend Emissionsrechte
über, mit denen der drastische Emissionsrückgang bei den heutigen
Klimasündern abgefedert werden könnte. Um den Ausgleich von
Emissionsrechten zu organisieren und die jeweiligen nationalen
“Fahrpläne” auf Plausibilität und Umsetzbarkeit prüfen zu können,
schlägt der WBGU eine “Weltklimabank” vor. Diese könnte auch einen
Fonds für Anpassungsmaßnahmen verwalten und Kredite für
Klimaschutzmaßnahmen vergeben. Ergänzend zu den Regelungen für
fossile Brennstoffe müssten nach den Vorstellungen des WBGU
Regelungen in Bezug auf Landnutzungsänderungen getroffen werden.)
Weiter mit:
Strategien
gegen den Klimawandel
Auf dieser Seite erfahren Sie, was getan werden muss, um den
Klimawandel wirksam zu begrenzen: Wir brauchen in erster Linie
effiziente Energiedienstleistungen – Energie muss also effizient
erzeugt, verteilt und genutzt werden –, erneuerbare Energiequellen
und den Schutz von Wäldern und Böden, damit diese Kohlendioxid
aufnehmen können.
Website zum Thema
Umweltbundesamt: Seiten Klima/Energie
Wissenschaftlicher Beirat der
Bundesregierung Globale Umweltveränderungen
The Climate Group –
Gemeinnützige Organisation, die Städte und Firmen zu
klimafreundlichem Verhalten anregt (englischsprachig).