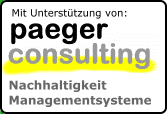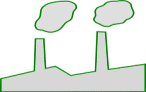Das Zeitalter der Industrie
Die Zerstörung der Böden
Böden sind die Grundlage für die Erzeugung
unserer Nahrungsmittel, und daher eines der kostbarsten Güter der
Menschheit. Und dennoch werden die Böden großräumig zerstört: Fast
ein Viertel der vom Menschen genutzten Landfläche ist heute durch
Erosion geschädigt, wertvolle Böden werden immer weiter überbaut
oder durch Eintrag von Giften geschädigt.

Acker in Oberbayern: Der
Einsatz von schweren Maschinen, Kunstdüngern und
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft kann den Boden
schädigen, indem die Bodenstruktur geschädigt, organische Substanz
abgebaut und Gifte eingetragen werden. Foto: Harald Bischoff,
>>
wikipedia commons, Lizenz: cc
3.0.
Mit der >> Erfindung
der Landwirtschaft begann eine Entwicklung, in deren Verlauf
die natürliche Pflanzendecke der Erde an geeigneten Standorten
allmählich durch vom Menschen gezüchtete Pflanzen ersetzt wurde -
heute sind etwa die Hälfte der Erdoberfläche in Acker- oder
Weideland umgewandelt (der Rest ist zum größten Teil für die
Landwirtschaft ungeeignet); ein Viertel davon werden intensiv als
Ackerland genutzt. Damit haben wir auch die Verantwortung für den
Erhalt der Böden übernommen, die die Fruchtbarkeit des Acker- oder
Weidelandes garantieren. Aber Übernutzung und/oder falsche
Bewirtschaftung sowie vom Menschen verursachte Umweltveränderungen
gefährden die Böden in großem Ausmaß, und damit auch die Sicherheit
unser Nahrungsmittelversorgung.
Vom Beginn der Landwirtschaft an hat der Mensch die Chemie der
Böden verändert: Mit den geernteten Pflanzen werden Nährstoffe
entfernt. Lange Zeit gelangten die Nährstoffe noch auf die Felder
zurück, aber seit dem Entstehen der Städte gelangen sie meist in
Abwasserkanäle, Flüsse und Meere - und waren damit für die
Landwirtschaft verloren. Im 19. Jahrhundert konnten mit sinkenden
Transportkosten fossile Düngemittel (Guano aus Peru oder Chile)
eingeführt werden; mit der Entdeckung von Verfahren zur technischen
Herstellung von Phosphaten und Stickstoff (>>
hier) wurden zunehmend Kunstdünger eingesetzt. Und die
>>
Industrielle Revolution führte dazu, dass auch die
Landwirtschaft mechanisiert werden konnte.
Mit der Grünen Revolution wurde diese Art der Landwirtschaft unter
Federführung der Weltbank auch in den armen Länder gebracht: Unter
stark steigendem Verbrauch von Agrochemikalien und stark
ausgeweiteter Bewässerung und der Züchtung von Sorten, die unter
diesen Bedingungen ertragreicher waren, konnte der Ertrag enorm
gesteigert werden (mehr >>
hier). Mechanisierung der Landwirtschaft bedeutete aber auch
schwere Maschinen, und schwere Maschinen bedeuten Bodenverdichtung:
weniger Luft und Wasser im Boden schädigen das Bodenleben.
Kunstdünger statt Kreislauf der Nährstoffe und Pestizideinsatz
führten dazu, dass der Boden immer weniger organische Bestandteile
enthält, Bewässerung führte in vielen trockenen Gebieten zur
Versalzung der Böden (siehe >>
unten).
Neben der großindustriellen Landwirtschaft leben aber eine
Milliarden Menschen, vor allem in den Tropen, von einer ganz anderen
Art Landwirtschaft: Auf kleinen Parzellen, oft abseits der besten
Lagen, bauen sie an, was sie zum Leben brauchen. Diese
Selbstversorger leiden ebenfalls unter Erosion ihrer Böden; für sie
bedeuten abnehmende Erträge meistens unmittelbar Hunger.
Verweht und weggespült - Erosion
Die Erosion, der Abtrag von Boden durch Wind und Wasser, ist ein
natürlicher Vorgang, der jedoch durch die Landwirtschaft stark
beschleunigt wurde - heute ist der Mensch für 60-80 Prozent der
Bodenerosion verantwortlich, die auf über 25 Milliarden Tonnen pro
Jahr geschätzt wird. Wo die Erosion besonders stark ist, kann sie
schließlich dazu führen, dass ganze Regionen für die Landwirtschaft
verloren gehen.
Hauptursachen der Erosion sind das Abholzen von Wäldern, dem Klima
nicht angepasste landwirtschaftliche Praktiken und die Nutzung
ungeeigneter Flächen für die Landwirtschaft. Kahlschläge in
gebirgigen Regionen führen oft dazu, dass beim nächsten Starkregen
der nun ungeschützte Boden abgetragen wird. Ungeeignete
landwirtschaftliche Praktiken, etwa die Übertragung der gewohnten
Anbaumethoden durch europäische Siedler in trockene Regionen oder in
den Mittelmeerraum und die Tropen führten oft zu großen
Bodenverlusten. So kam es in den nordamerikanischen Prärien, in der
kasachischen Steppe und zuletzt in China zu Staubstürmen, die
gewaltige Mengen Boden davontrugen.
Dust
Bowl
In den 1930er Jahren kam es in den nordamerikanischen
Prärien zu Staubstürmen, die in die Geschichte und in die Literatur
eingingen: Die Erschließung des Westens durch die Eisenbahn und die
Mechanisierung der Landwirtschaft ermöglichte die Bestellung
riesiger Felder. Durch eine Reihe regenreicher Jahre ging dies
zunächst auch gut, aber als in den 1930er Jahren trockene Jahre
begannen, begann eine Reihe von Staubstürmen, die die obersten
Bodenschichten von den Feldern bliesen: Im Mai 1934 erreichten
Tausende Tonnen Boden so Chicago, Boston, New York und Washington,
im Winter 1934/35 fiel in Neuengland roter Schnee, im April 1935
machten "schwarze Blizzards" den Tag zur Nacht. Teile der Great
Plains wurden regelrecht zugeweht und als Dust Bowl
("Staubschüssel") bezeichnet. Manche Regionen verloren drei Viertel
des Oberbodens; viele Farmer verloren ihre Existenzgrundlage und
mussten ihre Glück anderswo versuchen: den Staat Oklahoma
beispielsweise verließen damals 15 Prozent der Bevölkerung.
Im Mittelmeerraum und den Tropen waren es
neben dem Wind die ungewohnt heftigen Regenfälle, die die Böden
wegspülten. Kolonialismus zwang oftmals die einheimische Bevölkerung
zum Anbau auf Böden in den Bergen: auch hier ging der Boden oft bald
durch Erosion verloren. Besonders betroffen sind Asien und Afrika,
wo über die Hälfe des landwirtschaftlich genutzten Ackerlandes in
trockenen Regionen von Erosion betroffen sind.
Erosion betrifft nicht nur Acker-, sondern auch Weideland. Das
gesamte Weideland der Erde beträgt bis zu 46 Millionen
Quadratkilometer (die Schätzungen schwanken, da die Grenze zwischen
Weideland und unfruchtbarer Wüste oft nicht genau auszumachen ist),
davon ist auf 10 Millionen Quadratkilometern der Boden durch
Überweidung so geschädigt, dass die Produktivität eingeschränkt ist.
Für die gesamte Welt schätzte bereits 1992 ein Bericht des
UN-Umweltprogramms UNEP, dass seit dem Zweiten Weltkrieg 17 Prozent
der gesamten bewachsenen Fläche durch Erosion geschädigt wurde;
heute gelten 23 Prozent der Fläche als geschädigt.
Die Versalzung von Böden
In bewässerten Trockenländern ist Versalzung die Hauptursache von
Bodenzerstörung: Die im Wasser enthaltenen Salze verdunsten nicht
mit, und reichern sich - da sie in Trockenländern nicht durch
regelmäßige Regenfälle wieder ausgewaschen werden - im Boden an. Das
Problem ist so alt wie die Bewässerung in Trockenländern (>> mehr);
heute werden jedes Jahr etwa 15.000 Quadratkilometer Land durch
Versalzung unbrauchbar gemacht; auf weiteren 450.000
Quadratkilometern ist die Produktion durch Salzbelastung
eingeschränkt. Am schlimmsten ist der Irak betroffen: Hier sind etwa
70 Prozent der Ackerfläche von Versalzung betroffen.
Zubetoniert - Die Versiegelung der
Böden
Beispiel Ruhrgebiet
Vor der >> Industriellen
Revolution war das Ruhrgebiet eine
landwirtschaftlich geprägte Region; nur entlang der westfälischen
Hellwegs, der auf eine schon in germanischen Zeiten bestehende
Handelsroute zwischen Rhein und Elbe zurückging, gab es – ungefähr
eine Tagesreise auseinanderliegend – kleinere Städte wie Duisburg,
Essen, Bochum, Dortmund, die zum Teil der Hanse angehörten. Als hier
die Industrialisierung begann (>> Luftverschmutzung:
Beispiel Ruhrgebiet), kamen
Bergwerke hinzu, die wachsende Bevölkerung vergrößerte die
Hellwegstädte. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
explodierte der Bodenbedarf aber geradezu, wozu der mit der
Eröffnung der Strecke von Duisburg nach Hamm 1846 beginnende
Eisenbahnbau mit den zugehörigen Werksbahnen, aber auch der Bau von
Kanälen, Straßen, Werksiedlungen und Lager- und Abfallflächen der
Bergbauunternehmen (Halden, Schlackenberge) beitrugen. Von 1820 bis
1900 stieg der Anteil bebauter Fläche von 3,6 auf 11,6 Prozent (1330).
Erleichtert wurde diese Umwandlung, da seit 1865 das preußische
Berggesetz Enteignungen zugunsten von Bergwerken vorsah und diese
Möglichkeit 1874 mit dem preußischen Enteignungsgesetz noch
ausgeweitet wurde.
Mit dem Übergang zum Tiefbau kamen weiträumige Bodensenkungen
hinzu. Diese verhinderten, dass die Flüsse aufgrund des Gefälles
abfließen konnten, so dass großflächige Sümpfe und
Überschwemmungsgebiete entstanden, die landwirtschaftlich nicht mehr
nutzbar waren. An Gebäuden und Verkehrswegen kam es zu Schäden
infolge der Senkungen: der erste Risse an Häusern wurden in Essen
1866 festgestellt, im Juli 1868 waren bereits 132 Häuser beschädigt.
Auch wenn Schadenersatz schwierig war – die Geschädigten mussten
nachweisen, welche Zeche bzw. mit welchem Anteil die einzelnen
Zechen hieran beteiligt waren, was hohe Sachverständigenkosten
verursachte – kauften die Zechen, um Schadenersatzkosten zu
vermeiden, große Flächen auf (mögliche Bergschäden galten im
Enteignungsgesetz als "ankaufsförderndes Moment"), was die ohnehin
nicht sonderlich systematische Stadtplanung erschwerte (in Hamborn
etwa gehörten 1910 fast 60 Prozent des Stadtgebietes
Industriebetrieben). Auch wenn 1920 der
Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk (SVR) gegründet wurde, um die
Planung zu koordinieren und die verbleibenden Grün- und Freiflächen
von der Bebauung freizuhalten, änderte sich an dem auch vom SVR
anerkannten Vorrang der Industrieansiedlung nichts, zumal die
Industrie mit dem "Gesetz über ein vereinfachtes
Enteignungsverfahren" ab 1922 auch zur Abwendung von
Arbeitslosigkeit Flächen enteignen konnte. Das weitere Wachstum
(1927 waren bereits 21,2 Prozent der Fläche bebaut) führte zu einem
Mangel an in der Nähe liegenden Erholungsgebieten, die bestehenden
waren hoffnungslos überlaufen – den Hengsteysee bei Essen sollen bei
gutem Wetter an Sonn- und Feiertagen über 100.000 Menschen besucht
haben.
Die Nazis versuchten nach der Machtübernahme, diese
Entwicklung zu stoppen: zum einen liebten sie ohnehin keine
Großstädte, zum anderen war es während der Weltwirtschaftskrise im
Ruhrgebiet zu über 30 Prozent Arbeitslosigkeit und entsprechenden
sozialen Unruhen gekommen, die entschärft werden sollten: es sollte
eine planmäßige Aussiedlung als "Bauernsiedler" erfolgen. Mit wenig
Erfolg. Selbst wer wollte, hatte zumeist nach Arbeitslosigkeit und
Kurzarbeit das Geld hierfür nicht. Stattdessen sollte dann mit
Nebenerwerbssiedlungen für Industriearbeiter eine "größere
Krisenfestigkeit" erreicht werden und auch im Hinblick auf einen
möglichen Luftkrieg sollte die Bebauung aufgelockert werden, was den
Flächenverbrauch vergrößerte. Da im Zweiten Weltkrieg die >> Luftverschmutzung zielgenaue
Bombenangriffe erschwerte, lag 1945 das gesamte Ruhrgebiet in
Trümmern. Aber im Kalten Krieg brauchte Europa deutsche Kohle,
deutsches Eisen und deutschen Stahl; das Ruhrgebiet wurde schnell
als Industriegebiet wieder aufgebaut, die Inanspruchnahme an Fläche
stieg noch einmal deutlich – 1956 waren 34,3 Prozent der Fläche
bebaut. Von den verbliebenen Flächen gehörten viele immer noch den
Bergbauunternehmen. Das sollte ab den 1960er Jahren zum Problem
werden, als die Städte im Ruhrgebiet im Zeichen der Kohlekrise
versuchten, neue Industrien anzusiedeln. In der Regel erwies es sich
als leichter, die letzten noch freien Flächen zu erschließen, als
mit den Bergbauunternehmen über den Verkauf zu verhandeln.
Der Verbrauch an Fläche – mit dem auf Industrieflächen zudem eine
üblicherweise eine starke Bodenverschmutzung einherging, siehe unten
– wurde lange nicht als Beitrag zur Umweltzerstörung wahrgenommen.
Auch wenn das Ruhrgebiet und andere Industrieregionen extreme
Beispiele sind, in Deutschland insgesamt sind bereits über zehn
Prozent der Fläche versiegelt, also mit Asphalt, Beton,
Industrieanlagen oder Häusern bebaut – und tagtäglich kommen ca. 120
Hektar dazu. Auf diesen Flächen gehen die Bodenfunktionen verloren:
Wasserabfluss und Überflutungen werden verstärkt, Versickerungen und
Neubildung von Grundwasser gehen zurück, Landwirtschaft ist
auch nicht mehr möglich. In anderen Ländern ist die Versiegelung
landwirtschaftlicher Flächen heute schon ein Thema (z.B. in China),
obwohl dort die Motorisierung gerade erst beginnt: Ein Auto „kostet“
in Deutschland 0,2 Hektar an Fläche für Straßen und Parkplätze; wenn
die Chinesen unseren Motorisierungsgrad erreichen, bedeutete dies
die Versiegelung einer Fläche, die fast der Hälfte der gesamten
Reisanbaufläche entspricht.
Bei weiter wachsender Bevölkerung und gleich
bleibender Erosion und Überbauung wird die Ackerfläche pro Kopf
von 0,33 Hektar (1986) auf 0,15
Hektar im Jahr 2050 absinken.
Verschmutzung durch Schadstoffe
Beispiel
Ruhrgebiet
Dass mit den Abraum- und Kohlehalden aus dem Bergbau auch
Schwermetalle und andere Gifte abgelagert und von dort in den Boden
und ins Grundwasser gelangen konnten, war lange nicht bekannt. Das
hätte ihre Ablagerung aber wohl ohnehin nicht verhindert: es wurden
auch Gifte wie das in Kokereien bei der Gewinnung von Teer und
Nebenprodukten wie dem damals zur Stadtbeleuchtung genutztem
Leuchtgas anfallende Phenol auf Halden gepumpt, um dort zu
versickern, obwohl seine Giftigkeit bereits bekannt war (1340).
Aber nicht nur Bergbauunternehmen, auch Städte und Kommunen lagerten
die anfallenden Abfälle (und die darin zunehmend enthaltenen Gifte)
in Deponien ab, >> Abfallbeseitigung
wurde lange vor allem als hygienisches Problem und Teil der
Stadtreinigung gesehen; wie die Ablagerung aussah, blieb lange den
Städten und Kommunen selber überlassen.
Auch die >> in
die Atmosphäre abgegebenen Rauchpartikel und -gase blieben
dort nicht: sie sinken im Laufe der Zeit nieder oder werden durch
Regen ausgewaschen – so gelangen sie schließlich (mitunter in andere
Stoffe umgewandelt) ins >> Wasser
oder in den Boden. Durch die Bergsenkungen konnten bis zur
Regulierung der Emscher aber auch viele Flüsse im Ruhrgebiet nicht
abfließen, so dass diese die in ihnen enthaltenen Schadstoffe nicht
abtransportieren konnten: bei Hochwasser oder durch Wasserentnahmen
gelangten die Schadstoffen aus dem Wasser dann zum Teil auch noch in
den Boden. Als dann Kläranlagen gebaut wurden, wurden die z.T.
hochbelasteten Klärschlämme ebenfalls einfach abgelagert – die
Folgen waren die gleichen. Die ersten Opfer waren die Landwirte an
der Emscher, die ihre Wiesen und Felder im Winter mit Flusswasser
berieselten und Flussschlamm zur Düngung aufbrachten: auf den Wiesen
und Feldern löste sich die Grasnarbe, Bäume gingen ein und das Vieh
bekam Durchfall. Eine Entschädigung war nur auf dem Wege des
Schadensersatzes möglich (die Emscher war nach preußischem Recht, da
nicht schiffbar, ein privater Fluss [1345]),
vor allem die kleinen Bauern hatte aber nicht die hierfür nötigen
Mittel und gingen meist leer aus; Großgrundbesitzer konnten sich
oftmals mit den Einleitern über eine Entschädigung einigen.
Die Schadstoffbelastungen waren, da im Unterschied zu Luft- und
Wasserverschmutzung nicht sichtbar, lange kein Thema der
Umweltpolitik. Außerdem waren der belastete Grund und Boden in der
Regel in Privatbesitz, um mit dem durfte der Besitzer machen, was er
wollte. Erst mit dem Umweltprogramm der Bundesregierung von 1971
wurde der Schutz des Bodens als Aufgabe der Umweltpolitik benannt:
unter anderem sollten wilde Müllkippen stillgelegt, saniert und
rekultiviert werden. 1978 prägte der Rat der Sachverständigen für
Umweltfragen dann den Begriff der "Altlasten" für
die Gefahren, die aus alten Halden, Deponien und wilden Ablagerungen
ausgingen; er schätze, das es in Deutschland rund 50.000 solcher
Flächen gab. In den 1980er Jahren begann man, die Dimension dieses
Problems zu erahnen: in Bielefeld-Brake, Dortmund-Dorstfeld und
anderswo mussten Stadtteile, die auf solchen Altlasten errichtet
wurden, von den Bewohnern geräumt werden. In der Folge begann eine
systematische Erfassung von Altablagerungen und Altlasten, bis zum
Jahr 2000 wurden 360.000 altlastenverdächtige Flächen erfasst.
Unterdessen hatte, 14 Jahre nach dem ersten Umweltprogramm, im Jahr
1985 die Bundesregierung eine Bodenschutzkonzeption vorgelegt; 1991
Baden-Württemberg als erstes Bundesland ein Landes-Bodenschutzgesetz
erlassen, Sachsen und Berlin folgten. Erst 1998 folgte die
Bundesregierung mit einem Bundes-Bodenschutzgesetz, das im
Wesentlichen die Sanierung der Altlasten regelt (die Vermeidung
neuer Bodenbelastungen blieb im Wesentlichen weiterhin Aufgabe der
Gesetze zur Luftreinhaltung, zum Umgang mit Chemikalien und Abfällen
sowie zum Gewässerschutz).
Die Gefährdung der Böden ist damit aber selbst in Deutschland nicht
beendet. In Folge der >>
Industrialisierung der Landwirtschaft werden zunehmend Dünge-
und Pflanzenschutzmitteln gezielt in den Boden eingebracht, Abgase
aus Industriebetrieben und Verkehr gelangen nach wie vor in großen
Mengen über den "Luftpfad" in die Böden. Auch durch Unfälle gelangen
weiterhin Gifte in den Boden. In den Boden gelangende Schadstoffe
werden dort oft weitertransportiert und gefährden dann auch das
Grundwasser. Zu den gefährlichsten Schadstoffen gehören
Schwermetalle, Chemikalien und deren Abbauprodukte sowie
militärische Altlasten. Stick- und Schwefeloxide aus
Verbrennungsvorgängen werden in der Atmosphäre zu Säuren
umgewandelt, die als >> saurer
Regen die Böden versauern. In sauren Böden werden
Aluminium-Ionen freigesetzt, die für die meisten Kulturpflanzen
schädlich sind.
Schwer- und andere Metalle
Metalle spielen vor allem in der Umgebung von Bergwerken zum Abbau
von Metallen und Anlagen zur Verhüttung eine Rolle. Die Freisetzung
großer Mengen von Metallen stellt in gewisser Weise den Verlauf der
Evolution auf den Kopf, während der die Lebewesen mit immer weniger
Metallen auskommen mussten (>>
hier). So braucht der Körper einerseits Metalle, nimmt diese
in Folge der Anpassung an niedrige Metallgehalte aber so begierig
auf, dass oftmals gesundheitsschädliche Konzentrationen erreicht
werden. Viele Schwermetalle ähneln zudem anderen, benötigten
Metallen. So wird Kadmium an zinkbindende Eiweißen
gebunden und verdrängt Zink, dass für die Aufnahme von Eisen und
Kalzium benötigt wird - als Folge führt es zu Blutarmut und
Störungen im Knochenbau. Die Folgen von Schwermetallen in Böden
wurden zuerst im dichtbesiedelten Japan deutlich, wo Berg- und
Hüttenwerke oft direkt an Reisfelder angrenzen; und so wurde oftmals
mit Schwermetallen belastetes Wasser zur Bewässerung der Felder
verwendet. Das Schwermetall Kadmium wird von Reispflanzen
aufgenommen. Dadurch trat in den 1950er Jahren die Itai-Itai-Krankeit
auf: Schmerzhafte Skelettverformungen (Itai-Itai heißt lautmalerisch
„Aua-aua“) und Knochenbrüchen bei geringer Belastung. 1980 waren
etwa 10 Prozent der japanischen Reisfelder aufgrund der
Cadmiumbelastung nicht mehr für den Anbau von Nahrungsmittel
geeignet.
Ähnlich wie Kadmium wirkt Blei, das
Enzymstörungen auslöst und insbesondere das heranwachsende Gehirn
schädigt. Da Blei anstelle von Kalzium in die Knochen eingelagert
wird, gelangt es noch dazu während einer Schwangerschaft, wenn der
Körper auf Kalzium aus den Knochen zurückgreift, am leichtesten in
das Blut.
Erhöhte Schwermetallwerte wurden ab den 1970er
Jahren auf der ganzen Erde gemessen; gesundheitsschädliche Werte in
manchen Industriegebieten und Städten erreicht, die sich durch
besonders hohe Luftverschmutzung “auszeichneten”. Mit der Einführung
von Gesetzen zur Luftreinhaltung und dem Verbot von Blei in Benzin
ging der Anstieg zurück, allerdings bleiben Schwermetalle bis zu
3.000 Jahren im Erdreich. Problematisch sind aber nicht nur
Schwermetalle, sondern auch Leichtmetalle wie Lithium:
In geringen Dosen wird es in der Psychiatrie als Medikament
eingesetzt, eine etwas höhere Dosis ist giftig. Die zunehmende
Verwendung von Lithium für Akkus erfordert daher sorgfältiges
Recycling gebrauchter Akkus, wenn hier nicht ein neues Umweltproblem
geschaffen werden soll.
Chemikalien
Chemikalien wurden ab Mitte des 20. Jahrhunderts in so großen
Mengen hergestellt, dass sie in der Umwelt eine bedeutende Rolle
spielten. Eine wichtige Rolle spielte dabei der Einsatz von
chemischen Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft, eine andere
übernahm die Ablagerung gefährlicher Chemikalien in ungesicherten
Müllkippen.
Chemische Pflanzenschutzmittel
Mitten im Zweiten Weltkriegs begann die Menschheit,
gefährliche Chemikalien gezielt in großen Mengen in die Umwelt
auszubringen. 1939 hatte der Schweizer Chemiker Paul Hermann Müller
entdeckt, dass DDT Insekten tötete; 1942 wurde es
von der J.R. Geigy AG auf den Markt gebracht. DDT wurde zuerst gegen
den Kartoffelkäfer (und als Entlausungsmittel) eingesetzt und wurde
schnell zum am häufigsten verwendeten
Insektenvernichtungsmittel. DDT ist ein Chlorkohlenwasserstoff;
eine Stoffgruppe, die in der Umwelt sehr langsam abgebaut wird und
sich leicht in Fett löst; aus diesem Grund reichert sie sich im
Fettgewebe an. Schon vorher war eine zweite Gruppe von
Insektenvernichtungsmitteln entdeckt worden. Ähnlich wie bei der
>> Atomkraft standen hierbei die
Kriegsvorbereitungen Pate: Der deutsche Chemiker Gerhard Schrader,
der im Forschungslabor der BAYER AG in Leverkusen die Nervengifte
Tabun und Sarin entwickelte, fand heraus, dass diese Phosphorsäureester
mit kleinen Änderungen als Insektizide eingesetzt
werden konnten; Schraders Arbeitsgruppe entwickelte 1944 das als "E
605" verkaufte Parathion. Phosphorsäureester sind
viel giftiger als Chlorkohlenwasserstoffe, werden aber in der Umwelt
vergleichsweise schnell abgebaut. Nach dem Krieg eigneten sich die
Amerikaner Schraders Wissen über Phosphorsäureester an und begannen
einen "Krieg gegen die Natur" (so Tim Flannery): Insekten wurden von
Flugzeugen aus mit diesen Insektenvernichtungsmitteln besprüht, wo
immer sie auftraten. Selbst vor dem Einsatz in Städten schreckten
sie nicht zurück: So wurde das Insektizid Aldrin 1959 über Detroit
versprüht, um einen Rosenkäfer auszurotten. Auch die
Weltgesundheitsorganisation setzte auf Insektizide - vor allem auf
DDT -, um die Malaria auszurotten.
Die Folgen dieses massiven Gifteinsatzes
zeigte 1962 die amerikanische Biologin Rachel Carson
in ihrem Buch „Silent Spring“ (dt. „Der stumme
Frühling“): Sie wies auf die Gefahren insbesondere
von DDT auf die Vogelwelt, vor allem aber auf die menschliche
Gesundheit hin, da der Mensch am Ende der Nahrungskette der
Lebewesen stehe. DDT reichert sich im Fettgewebe von Tieren an und
führte schließlich dazu, dass bei Vögeln die Eierschalen dünner
wurden, wodurch sie beim Brüten zerbrachen. In den USA wurde dadurch
der Weißkopfseeadler (der Wappenvogel der USA) an den Rand des
Aussterbens gebracht. Carson, die selber an Krebs litt, beschrieb
aber auch die Krebsgefahren durch Pestizide. Da Krebsgefahren zu
dieser Zeit ein viel diskutiertes Thema waren, wurde das Buch in den
USA ein Riesenerfolg (in Deutschland löste das Buch trotzt eines
Vorabdrucks in der ZEIT und des gerade bekannt gewordenen
Contergan-Skandals damals kaum Diskussionen aus); vielen gilt es als
Geburtsstunde der Umweltbewegung.
Nach Carsons Buch war es mit dem großflächigen und hochdosierten
Einsatz von DDT bald vorbei; aber es sollte gegen heftigen
Widerstand der Chemieindustrie noch bis 1972 dauern, bis der Einsatz
von DDT in der Landwirtschaft in den USA (und in Deutschland)
verboten wurde. Seit Inkrafttreten der Stockholmer
Konvention im Mai 2004 ist DDT weltweit nur noch zur
Malariabekämpfung zugelassen, Hauptproduzenten sind Indien und
China. Aufgrund seiner Langlebigkeit ist DDT aber auch heute noch in
allen Menschen nachzuweisen. Mit der Stockholmer Konvention wurden
weitere acht Pflanzenschutzmittel wegen ähnlicher Folgen verboten
oder ihre Nutzung beschränkt; heute werden kurzlebigere, aber dafür
giftigere Substanzen bevorzugt, die sich nicht mehr in den Böden
anreichern.
Giftmüll und Altlasten
1970 produzierten die USA 9 Millionen Tonnen gefährlicher Abfälle,
im Jahr 2000 waren es bereits 400 Millionen Tonnen. Bis in die
1970er Jahre waren diese Abfälle auch dort kaum ein Thema, oft
wurden sie einfach mit Hausmüll gemischt (um sie zu “verdünnen”) und
auf den damals völlig ungesicherten Müllkippen abgelagert. Das böse
Erwachen kam später: 1978 kam in Love Canal der
erste Giftmüllskandal in die Schlagzeilen. Love Canal war ein
Stadtviertel der Stadt Niagara Falls (an den Niagarafällen),
das auf einem Gelände errichtet worden war, auf dem eine Chemiefirma
20.000 Tonnen Abfälle entsorgt hatte. Als sich hier Beschwerden über
Gestank, Krebsfälle und Missgeburten häuften, wurde der Abfall
untersucht: Über 300 Giftstoffe wurden in dem Gemisch gefunden, Love
Canal wurde zum Katastrophengebiet erklärt, die Haushalte
umgesiedelt.
Damit war ein Fass aufgemacht: Zusammenhänge zwischen
Gesundheitsproblemen und Giftmüll wurden in Hunderten von Gemeinden
entdeckt. In den USA sind etwa 50.000 alte Giftmülldeponien
(“Altlasten”) bekannt – und noch immer werden z.B. bei Bauarbeiten
neue, bisher unbekannte Ablagerungen entdeckt. (In Deutschland gibt
es, siehe oben, sogar 360.000 Verdachtsflächen, wobei sich davon
nicht jede tatsächlich als Altlast herausstellen muss. Eine
Beseitigung wurde zwar in Angriff genommen, aufgrund der gewaltigen
Kosten wurde bisher aber nur ein Bruchteil dieser Altlasten saniert.
Weitere Seiten zum Industriezeitalter:
>>
Hintergrund: Die industrielle Revolution
>> Rohstoffe
>> Energie
>>
Wassernutzung
>>
Wasserverschmutzung
>>
Luftverschmutzung
>> Klimawandel
>>
Gefährdung der biologischen Vielfalt
Zur >> Übersicht