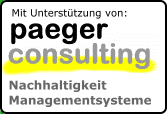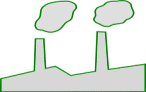Das Zeitalter der Industrie
Vom Bauern zur
industriellen Landwirtschaft
Über Jahrtausende stellte die wachsende
Menschheit ihre Nahrungsmittelversorgung vor allem durch eine
Ausweitung des Acker- und Weidelands sicher. Mit der
wissenschaftlich-technischen Basis der Industriellen Revolution
änderte sich dies: Kunstdünger, Maschinen und Züchtungserfolge
führten zu einer hoch technisierten, industriellen Landwirtschaft
mit enormen Erträgen.

Mähdrescher: Die
Mechanisierung der Landwirtschaft begann in Deutschland erst nach
dem Zweiten Weltkrieg. Foto: Benno Bartocha, Deutsches Bundesarchiv.
Aus wikipedia, >> Agrargeschichte
(abgerufen 10.5.2010), Lizenz: >> c.c
3.0
Während die wissenschaftlich-technische Revolution in der Industrie
zur >>
Industriellen Revolution führte, änderte sich in der
Landwirtschaft zunächst wenig. 1798 hatte der englische Pfarrer und
Ökonom Thomas Robert Malthus in seinem “Essay on
the Principle of Population” einen Zusammenhang zwischen Bevölkerung
und Nahrungsmittelproduktion erkannt. Da die Bevölkerungszahl
exponentiell wachse und daher schneller steigen könne als die
Erzeugung von Nahrungsmitteln, sah er weitere Hungersnöte voraus,
wenn die Menschheit diesen nicht vorbeuge, etwa durch spätere Heirat
und Geburtenkontrolle. Malthus’ Voraussage sollte sich nicht
bewahrheiten: Der landwirtschaftliche Ertrag stieg durch die weitere
Ausdehnung der landwirtschaftlichen Fläche, sei es durch Umwandlung
weiterer Wälder (wie in England), das Trockenlegen von
Feuchtgebieten (wie in Italien) oder den verstärkten Anbau von
Nahrungsmitteln in den Kolonien und ehemaligen Kolonien: Dort gab es
viel Land, aber wenige Menschen. Als in der Folge der Hungersnot in
Irland Mitte des 19. Jahrhunderts (>>
mehr) eine Millionen Menschen auswanderten, trugen sie zu
einer Massenbewegung bei, die ab 1840 insgesamt 50 bis 60 Millionen
Europäer in die neue Welt (Amerika, Australien, Neuseeland) und nach
Russland brachte. Dort fanden sie unter anderem beim Bau der
Eisenbahnen Arbeit, die die Grasländer erschlossen. So konnte etwa
in den Prärien des Mittleren Westen der USA, in Argentinien und
Australien Getreide angebaut werden, das mittels Eisenbahnen an die
Küste transportiert und von dort mit Dampfschiffen nach England
gebracht wurde. Die industrielle Revolution nutzte der
Landwirtschaft also zuerst indirekt: Sie profitierte von den
Transportmöglichkeiten durch Eisenbahn und Dampfschiff. Um 1700
waren weniger als drei Prozent der Landfläche Ackerland, bis 1850
hatte sich dieser Anteil verdoppelt, und bis 1940 verdoppelte er
sich noch einmal. (Das letzte große Projekt zur Ausweitung des
Ackerlands in den gemäßigten Klimazonen war Chruschtschows
Neulandprojekt von 1954 bis 1960, mit dem er Teile der russischen
und kasachischen Steppe unter den Pflug nehmen ließ – die Gebiete
erwiesen sich als untauglich für den Weizenanbau, heute liegen sie
zum größten Teil brach.)
Mit der Verbesserung der
Transportmöglichkeiten wurden “Kolonialwaren” vom Luxus- zum
Massengut; Zucker, Kaffee, Tee und Kakao wurden in immer größerem
Maßstab angebaut und verbraucht. Von den Kolonialmächten wurden
diese gefördert, nach der Theorie der “komparativen Kostenvorteile”
(>>
hier) hätten auch die Exportländer von einer Teilnahme am
Welthandel profitieren sollen; tatsächlich sollten viele
Volkswirtschaften später unter der Spezialisierung auf wenige
Exportprodukte leiden (>>
mehr). Mit der Entwicklung der Kühl- und Gefriertechnik
vervielfachten sich die Möglichkeiten noch einmal: Jetzt konnten
auch Fleisch und Milchprodukte und empfindliche Obstsorten um die
Welt transportiert werden. Der erste gekühlte Fleischtransport fand
1875 (von New York nach London) statt, in den 1890er Jahren wurden
Butter und Käse aus Neuseeland nach England gebracht. Im Jahr 1901
fand der erste Bananentransport von Jamaica nach England statt. Vor
allem England importierte immer mehr Nahrungsmittel, um seine mit
der Industrialisierung wachsende Bevölkerung (>>
mehr) zu ernähren: Anfang des 19. Jahrhunderts importierte
England 80 Prozent seines Getreides, 65 Prozent seiner Früchte und
40 Prozent seines Fleisches.
Zusätzlich zur Erzeugung von Nahrungsmitteln wurden auch zunehmend
Rohmaterialien für die Industrien angebaut: In den USA breitete sich
zum Beispiel in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der
Baumwollanbau aus; Sisalagave (Fasern für Seile etc.),
Kautschukbäume (zur Gummiherstellung) und Ölpalmen (Palmöl als
Schmiermittel und zur Margarineherstellung) wurden weitere wichtige
Kulturen. Der Anbau sowohl von Nahrungsmitteln als auch von
Rohstoffpflanzen führte zu einer erneuten Zunahme der Sklaverei,
etwa für den Baumwollanbau in den USA, als auch zur Abhängigkeit
ganzer Staaten von Lebensmittelkonzernen – die Abhängigkeit
mittelamerikanischer Staaten von der amerikanischen United Fruit
Company führte zur Wortschöpfung “Bananenrepubliken”. Aber auch
anderswo orientierten die Kolonialstaaten den Anbau an ihren
Bedürfnissen: Zucker in der Karibik, Tee in Indien und Sri Lanka
(“Ceylon”), Kautschuk in Malaysia, Reis in Burma und Vietnam, Kaffee
in Indonesien und später Brasilien, Kakao in Brasilien und Ghana,
Palmöl in Westafrika und Südostasien. Die einheimische
Landwirtschaft, die zur Eigenversorgung mit Lebensmitteln diente,
wurde dabei oftmals zerstört; Bauern – wo sie nicht gleich versklavt
wurden – oft mit Kopfsteuern dazu gezwungen, als Lohnarbeiter auf
den Plantagen zu arbeiten.
Auf Kosten natürlicher
Ökosysteme
Die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche im Laufe der
menschlichen Geschichte ging zu Lasten natürlicher Ökosysteme.
Acker- und Weideland entstand auf Flächen, auf denen zuvor
artenreiches Wald-, Busch- oder Savannenland zu finden war. Genaue
historische Daten hierzu sind kaum zu finden; nicht einmal heute
kann die Waldvernichtung genau gemessen werden (>>
hier). Aber das Ergebnis ist bekannt: Mehr als 48 Millionen
Quadratkilometer, mehr als ein Drittel der überhaupt bewachsenen
Erdoberfläche, werden heute landwirtschaftlich genutzt: 15 Millionen
Quadratkilometer als Ackerland, der Rest als Weideland. Diese 15
Millionen Quadratkilometer Ackerland waren zuvor meist Wälder
(>>
mehr), auf diesen Flächen stehen heute nur noch wenige
domestizierte Arten. Der Mensch nutzt inzwischen über 40 Prozent der
biologischen Produktion der Erde für sich (siehe >>
unten). Diese Flächennutzung und diese Aneignung der
biologischen Produktion sind wesentliche Ursachen des >>
Rückgangs der Artenvielfalt. Außerdem gehen mit den
natürlichen Landschaften die Dienstleistungen der Ökosysteme
verloren, etwa die Funktion der Wälder für den Wasserhaushalt.
Auf der anderen Seite leidet die landwirtschaftliche
Nutzfläche heute selber unter einem neuen, mächtigen Konkurrenten
bei der Landnutzung – der Industriegesellschaft: Neue Bau- und
Industriegebiete sowie Verkehrswege werden oft auf
landwirtschaftlichen Flächen angelegt – 25 Millionen Autos in China
bedeuten 500.000 Hektar Straßen und Parkplätze (siehe auch >>
unten auf dieser Seite).
Die Industrialisierung der Landwirtschaft
Ende des 19. Jahrhunderts löste ein Ende der Ertragssteigerungen in
den USA eine Panik aus: Ohne reichliche, preiswerte Nahrungsmittel
fürchtete die Regierung ein Ende der Industrialisierung. Es wurde
ein Landwirtschaftsministerium geschaffen, dass die Versorgung
sicherstellen sollte; und dieses begann unter anderem mit dem Bau
von Staudämmen und Bewässerungskanälen (>> hier),
baute das Eisenbahnnetz weiter auf, um die “Salatschüssel”
Kalifornien, die Getreideanbaugebiete und die Rinderweiden des
Westens mit den Verbrauchern zu verbinden. An Forschungsinstituten
und Universitäten begann die wissenschaftliche Pflanzenzüchtung, im
Jahr 1918 wurden die ersten
Maishybride entwickelt. Aber noch im Jahr 1920 unterschied
sich die Landwirtschaft nicht grundsätzlich von der seit Tausenden
von Jahren praktizierten Landwirtschaft. Nährstoffe wurden durch
Einbringen von Dung aus der Viehhaltung, Humus und Streu aus den
Wäldern (nur unzureichend) ersetzt, Unkräuter von Hand oder
mechanisch durch Jäten, Hacken oder Eggen entfernt. Erst danach
erfasste die Industrielle Revolution die Landwirtschaft auch direkt:
Kunstdünger und chemische Schädlingsbekämpfungsmittel, Maschinen und
wissenschaftliche Züchtungsmethoden führten zu einer
Agrarrevolution. Henry Wallace, der als erster mit Hybridmais
kommerziellen Erfolg hatte und unter Roosevelt
Landwirtschaftsminister wurde, sah sich selber als “Vater der
industrialisierten Landwirtschaft”.
"Brot aus der Luft" – Industrielle
Kunstdünger
Herausragende Bedeutung hierfür hatten die Arbeiten der englischen
Agrochemikers John Bennet Lawes und des deutschen
Chemikers Justus Liebig. Lawes erforschte die Wachstumsbedingungen
der Pflanzen auf seinem eigenen Gut in Rothamsted und stellte 1842
aus einem Gemisch aus Knochenmehl und Schwefelsäure “Superphosphat”
her, den ersten künstlichen Mineraldünger, und gründete die erste
Düngemittelfabrik der Welt. Er erkannte auch als erster die
Bedeutung des Nährelements Stickstoff. Allerdings musste Stickstoff,
etwa in Form eines Reaktionsproduktes flüssiger Seevogelexkremente
mit Kalkstein, dem Guano, aus Lateinamerika
eingeschifft werden. 1840 hatte Justus Liebig,
Professor an der Universität Gießen, sein Werk “Die organische
Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie”
veröffentlicht, mit dem er die wissenschaftlichen Grundlagen der
Pflanzenernährung aufzeigte: Pflanzen nehmen die Grundstoffe zu
ihrem Aufbau in mineralischer (anorganischer) Form aus dem Boden auf
– zuvor glaubte man, sie nähmen Nahrung in organischer Form aus dem
Boden auf. Liebigs Erkenntnisse eröffneten die Möglichkeiten des
Einsatzes von Mineraldüngern. Mit Lawes Düngemittelfabrik gab es
bereits Superphosphat. Kritischer war aber die Versorgung der Böden
mit Stickstoff. 1909 entdeckte der deutsche Chemiker Fritz
Haber, wie man Stickstoffdünger in Form von
Ammoniaksalzen herstellen konnte. Das vom BASF-Chemiker Karl
Bosch weiterentwickelte Haber-Bosch-Verfahren erlaubte ab
1913 die Massenproduktion von Ammoniak (100)
aus Luftstickstoff und Wasserstoff – von “Brot aus Luft”, wie es in
der Laudatio zum Chemie-Nobelpreis hieß, den Haber 1918 erhielt.
Das Haber-Bosch-Verfahren brauchte etwa einen
Liter Erdöl oder eine entsprechende Menge Erdgas, um ein Kilogramm
Stickstoff zu fixieren. Aber dies war die Zeit, in der Erdöl immer
billiger wurde (>> hier);
und so konnte die Produktion ständig ausgebaut werden: Der
Kunstdüngereinsatz stieg von 4 Millionen Tonnen im Jahr 1940 über 40
Millionen Tonnen im Jahr 1965 auf fast 150 Millionen Tonnen im Jahr
1990. Damit konnten die Böden wieder mit Nährstoffen aufgefüllt
werden – allerdings gelangte mehr als die Hälfe des Kunstdüngers gar
nicht auf die Felder, sondern in Gewässer und führte dort zur
Überdüngung (>>
hier). Der Einsatz von Kunstdünger war an seine Grenzen
gekommen, seit 1990 fällt er sogar leicht (2000: 137 Millionen
Tonnen). Der Einsatz von Düngern ist heute etwa beim Maisanbau in
den USA der Haupt-Energieverbraucher, und hat noch mehr als die
Mechanisierung dazu beigetragen, dass die Landwirtschaft mehr
Energie verbraucht als sie in Form von Lebensmitteln erzeugt.
Die Mechanisierung der Landwirtschaft
Die Mechanisierung der Landwirtschaft begann zuerst in den USA, wo
große Farmen mit wenigen Arbeitskräften bewirtschaftet werden
mussten. Sie begann mit Dresch- und Erntemaschinen, die von Pferden
angetrieben wurden – Dampfmaschinen waren für die Felder zu groß und
schwer. Endgültig setzten sich diese Maschinen durch, als während
des amerikanischen Bürgerkriegs die Arbeitskräfte noch knapper
wurden: Zwischen 1837 und 1890 vervierfachte sich dadurch die
Produktivität des Landes in den USA; und die USA wurden zum
bedeutendsten Nahrungsmittelexporteur. Der erste Traktor mit
Benzinmotor wurde 1892 entwickelt; ab 1920 setzten sich die
Traktoren in den USA, ab 1930 in der Sowjetunion und ab 1950 in
Europa durch. In den USA wurden in den 1930er Jahren auch
selbstfahrende Mähdrescher entwickelt, die die nächste Stufe der
Mechanisierung darstellten. Seit den 1960er Jahren begann die
Mechanisierung auch in den Entwicklungsländern, wo sie sich
allerdings wegen des geringen Lohns für Arbeitskräfte nicht immer
rechnet.
Die Mechanisierung veränderte die Landwirtschaft: Große Felder
eignen sich besser für Maschinen, also wurden kleine Felder
zusammengelegt. Große Betriebe konnten sich die Maschinen eher
leisten, kleine Betriebe verschwanden: In den USA verdreifachte sich
die Durchschnittsgröße der Farmen von 1935 bis 1985. (Dazu kam, dass
steigende Erträge zu sinkenden Preisen führten – wer nicht
mitmachte, war zu teuer und wurde vom Markt gedrängt.) Für die
maschinelle Ernte waren Mischkulturen nicht geeignet, daher setzten
sich Monokulturen durch. Diese brauchten Nährstoffe schneller auf
und waren gegenüber Schädlingen anfälliger. Gegen den
Nährstoffmangel halfen die neuen Kunstdünger, die aber wiederum die
Anfälligkeit der Pflanzen gegenüber Schädlingen erhöhten: zum einen
wuchsen auf gut gedüngten Feldern auch die Unkräuter besser; zum
anderen konnten in den dichteren Beständen Pilze sich besser
ausbreiten, die zudem aufgrund der durch Düngereinsatz weicheren
Zellwände größeren Schaden anrichten konnten. Erst als es der
Agrarchemie gelang, ebenfalls auf petrochemischer Basis gegen
Unkräuter und Schädlinge chemische Unkrautbekämpfungs- und
Schädlingsbekämpfungsmittel (Herbizide und Pestizide) zu entwickeln,
führte die Düngung zu einer deutlichen Ertragssteigung, der
Düngemittel (und der Herbizid- und Pestizidverbrauch) stiegen
kontinuierlich an. Die Erträge stiegen aber auch, da durch die
Nutzung von Motoren nun kein Weideland mehr für Arbeitstiere
gebraucht wurde. Die Zahl der Beschäftigten in der Landwirtschaft
dagegen sank: In den USA von der Hälfte der Bevölkerung im Jahr 1920
auf heute gut ein Prozent. Deutschland holte diese Entwicklung mit
der “Flurbereinigung” nach dem Zweiten Weltkrieg nach, heute
arbeiten 2,3 Prozent der Beschäftigten in der Landwirtschaft (101)
(siehe >>
hier).
Fortschritte in der Pflanzenzucht
Eng im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit von Mineraldüngern und
der Mechanisierung standen die Fortschritte in der Pflanzenzucht.
Gezüchtet wurden Pflanzen, die besser auf Kunstdünger und
Bewässerung ansprachen und für die Mechanisierung geeignet waren.
Hintergrund war die Wiederentdeckung der Vererbungslehre des
österreichischen Mönches Gregor Mendel im Jahr 1900. Auf
dieser Basis begannen die Züchtungen, die zum ersten Hybridmais
(siehe oben) und dann den hochertragsreichen Sorten führten:
besseren Hybridmais in den USA, Kurzstrohweizen in Mexiko und
hochertragreicher Reis auf den Philippinen – diese Entwicklung wurde
als Grüne Revolution bekannt. Die
Hochertragssorten setzten sich durch: 1930 stand Hybridmais auf
einem Prozent der Maisanbaufläche der USA, 1970 machte er über 99
Prozent aus. In den Entwicklungsländern stiegen die Hektarerträge
zwischen 1960 und 1990 auf mehr als das Doppelte. Der amerikanische
Agrarwissenschaftler Norman Borlaug, der erst im
Auftrag der Rockefeller-Stiftung neue Mais- und Weizensorten in
Mexiko entwickelte und 1963 dann von der Stiftung nach Indien und
Pakistan entsandt wurde, erhielt für seinen Beitrag im Jahr 1970 den
Friedensnobelpreis, weil er “mehr als jede andere Person dieser Zeit
geholfen hat, eine hungrige Welt mit Brot zu versorgen” (aus der
Rede zur Preisverleihung).
Industrielle Tierhaltung
Mit Überschüssen aus dem Ackerbau stand auch Futter für die
Massentierhaltung zur Verfügung: Konnte früher ein Bauer nur so
viele Tiere halten, wie er von seinem Land ernähren konnte, wurden
Rinder, Schweine und Hühner jetzt in riesigen Mastanlagen mit
Kraftfutter schneller und billiger gemästet. Der Übergang begann in
der Weltwirtschaftskrise (>>
mehr), als viele Menschen sich kein Fleisch mehr leisten
konnte, und der amerikanische Agrarprofessor Jay Laurence Lush
schlug vor, die Züchtung von Tieren nicht mehr anhand äußerer
Merkmale zu betreiben, sondern anhand ihrer Produktivität. Heute
werden weltweit zwei Drittel des Geflügel- und die Hälfe des
Schweinfleisches (und in Deutschland weit über 90 Prozent) in
Massentierhaltung erzeugt; diese setzt 140 Milliarden Dollar im Jahr
um – Tendenz steigend. Seit den 1960er Jahren begann auch die
Züchtung von Fischen in Aquakulturen (>>
mehr). Die Tierhaltung in voll- oder teilautomatisierten
Großhallen hat ihren Preis: Hühner, denen Platz und Protein in der
Getreidenahrung fehlte, wurden zu Kannibalen – um dies zu beenden,
wurden ihnen proteinreiche Sojabohnen, Schlachthausabfälle und
Tiermehl verfüttern. Letztere sind heute verboten, Fischmehl immer
noch erlaubt. Die Bedingungen der industriellen Massentierhaltung
könnten einem auch sonst eigentlich den Appetit verderben: Schweine
etwa stehen oft ohne Einstreu und Spielmöglichkeiten auf
Spaltenböden, einem 90-Kilo-Tier stehen ein drei Viertel
Quadratmeter Fläche zu. Hähnchen werden derart schnell gemästet,
dass Gelenkerkrankungen, Knochenbrüche und Herzerkrankungen fast
schon normal sind. Besonders eindrucksvoll ist der “Erfolg” der
Rinder, die weltweit mehr Land als die Menschen nutzen (wenn man
einmal davon absieht, dass diese Rinder natürlich auch ein “Produkt”
des Menschen sind) – alleine die 1,5 Milliarden Rinder auf dieser
Welt wiegen doppelt so viel wie die Menschheit!
War früher ein Weiderind nach zwei Jahren schlachtreif, wird ein
sechs Monate altes Kalb heute in vier Monaten schlachtreif gemästet;
eine Kuh, die früher 1.700 Liter Milch im Jahr gab, muss heute 10
bis 15.000 Liter/Jahr liefern. Ein Drittel der Ackerfläche dient
heute dem Anbau von Weizen, Mais und Soja als Kraftfutter; ein
Viertel des Landes ist Weideland. Die Rinderhaltung ist durch die
Abholzung von Regenwäldern – im Amazonasgebiet wurden seit 1970 neun
von zehn Hektar Regenwald für Weideland abgeholzt – und die
Methanrülpser der Tiere einer der wesentlichen Beiträge der
Landwirtschaft zum >> Klimawandel;
er beträgt, auf die Landwirtschaft entfallende Entwaldung und
Verkehr eingerechnet, rund 20 Prozent. Die Massentierhaltung schafft
zudem ideale Vermehrungsbedingungen für Krankheitserreger: Oft
werden die Tiere daher schon vorbeugend mit Antibiotika behandelt,
die zugleich das Wachstum fördern. Aber die industrielle Tierhaltung
hat dazu geführt, dass wir immer mehr Fleisch essen können, obwohl
wir immer weniger für unsere Nahrung bezahlen (mehr >>
unten).
Die Industrialisierung der
Wälder
11 Millionen Quadratkilometer ehemaliges Waldland wurden in Acker-,
weitere 3 Millionen in Weideland umgewandelt (>>
mehr). Die übrigen Wälder sind aber keineswegs immer
unberührte Naturlandschaft: Nur etwa ein Drittel ist mehr oder
weniger unberührter “Urwald”, die übrigen zwei Drittel werden mehr
oder weniger intensiv forstlich genutzt. Diese Umwandlung betraf
zuerst die sommergrünen Wälder Europas und der östlichen USA; später
dann – und bis heute anhaltend – die Nadelwälder im Nordwesten der
USA und die borealen Nadelwälder. Die Folge: In Europa gibt es nur
kleine Reste unberührter Urwälder; in den USA kämpfen heute
Naturschützer gegen die Abholzung der letzten “old growth
forests”. Auch die 6 Millionen Quadratkilometer der
sibirischen Urwälder sind ins Visier der Holzindustrie geraten
(angeblich werden “nur” 40.000 Quadratkilometer im Jahr gefällt,
aber zuverlässige Zahlen über das Ausmaß der Abholzung sind auch
heute noch kaum zu bekommen).
Die ursprünglich abgeholzte Fläche war noch größer,
aber ein Teil des Landes wurde wieder aufgegeben und konnte vom Wald
zurückerobert werden, anderswo wurde wieder aufgeforstet. So wurden
in den USA mit dem Beackern der Prärien die weniger fruchtbaren
Länder im Osten wieder aufgeforstet, auch in Europa nahm der
Waldanteil wieder zu. Diese Forsten können je nach Art der
Bewirtschaftung reine Holzplantagen sein (manche Eukalyptusplantagen
werden alle 7 Jahre wie ein Getreidefeld geernet), oder mehr oder
weniger natürlichen Wäldern ähneln (naturnahe Forstwirtschaft).
Die Erfolge der industriellen Landwirtschaft
In Teilen der Welt verknüpften sich Düngemittel, Mechanisierung und
Grüne Revolution Düngemittel zu der hochertragsreichen
Landwirtschaft, die wir heute kennen, und die es ermöglicht, dass
heute auf der Erde rund 7 Milliarden Menschen leben (>> Die
Bevölkerung der Erde). Dabei ist die Erzeugung an
Nahrungsmitteln pro Kopf in den letzten Jahrzehnten so weit
gestiegen, dass niemand Hunger leiden müsste: Im Jahr 2007
Ein Traum der Menschheit wurde wahr: Lebensmittel
sind im Überfluss vorhanden und billig
wie nie. Aber die Industrielle Landwirtschaft hatte einen
Preis
wurden weltweit schätzungsweise 700 Millionen Tonnen Mais, je 600
Millionen Tonnen Reis und Weizen, 300 Millionen Tonnen Kartoffeln
und 214 Millionen Tonnen Soja erzeugt; ein Teil dieser Ernte geht in
die Produktion von 220 Millionen Tonnen Fleisch (etwa die Hälfte
Schweinefleisch und je ein Viertel Rind und Geflügel). Dazu kommen
142 Millionen Tonnen Fisch aus Wildfängen und Aquakultur (mehr dazu
>> hier).
Alleine an Getreide werden im Jahr über 300 Kilogramm pro Kopf der
Weltbevölkerung erzeugt. Ein Traum der Menschheit ist – zumindest in
den reichen Industrieländern – wahr geworden: Hier sind
Nahrungsmittel im Überfluss vorhanden und so billig wie nie zuvor in
der Geschichte der Menschheit. In Deutschland gibt ein Haushalt im
Durchschnitt nur noch 14,5 Prozent seines Einkommens für
Nahrungsmittel (einschließlich Genussmittel) aus – 1970 waren es
noch fast 30 Prozent. Besonders drastisch sind die Auswirkungen beim
Fleisch: War dies früher für viele ein Luxusprodukt (der klassische
“Sonntagsbraten”), ist Fleisch so billig geworden, dass es
alltäglich wurde – und wir heute so viel davon essen, dass es schon
wieder ungesund ist: Ein Bundesbürger isst heute im Durchschnitt 60
Kilogramm Fleisch im Jahr, die Empfehlungen der Ernährungsforscher
liegen bei 20 Kilogramm, einem Drittel.
Das industrialisierte Essen – Fertiggerichte
Mit dem Aufstieg der industriellen Landwirtschaft stieg auch die
Ernährungsindustrie auf, die heute in Deutschland zu den
wichtigsten Industriebranchen gehört. Die Menschen, die in der
Industrie arbeiteten, fanden nicht mehr die Zeit, ihr Essen selber
zuzubereiten, und damit entstand ein Markt für Fertiggerichte,
die industriell in großen Mengen hergestellt wurden. Zu den
Pionieren dieser Entwicklung gehörte der im schweizerischen Vevey
lebende deutschstämmige Apotheker und Düngemittelfabrikant Henry
Nestlé, der 1867 eine auf einem Rezept Justus Liebigs
basierende Säuglingsnahrung auf den Markt brachte: Henry Nestlé’s
Kindermehl. Die Nestlé S.A. ist heute das größte
Nahrungsmittelunternehmen der Welt. Andere große Unternehmen
entstanden in den USA, etwa Heinz, General Foods, Kraft und Kellogg.
Sie alle brachten Tausende von Produkten auf den Markt – und konnten
so einen Teil des in der industrialisierten Landwirtschaft
eingesparten Geldes in die eigenen Taschen leiten. Der Erfolg lockte
weitere Mitspieler an, die ihren Anteil an dem Markt haben wollten:
Fastfood-Restaurants wie McDonald’s, Burger King
oder Wendy’s für die Kunden, die gar nicht mehr selber kochen
wollten, und immer größere Handelskonzerne.
Konnten die Fastfood-Restaurants wenigstens noch von den Herstellern
beliefert werden, fand im Handel eine schnelle Konzentration statt,
die globale Handelskonzerne bald so mächtig machte, dass sie den
Herstellern oftmals die Preise diktieren konnten. Die größten dieser
Konzerne sind heute Wal-Mart (USA), Carrefour (Frankreich), Ahold
(Niederlande), Kroger (USA), Metro (Deutschland) und Tesco
(Großbritannien), in Deutschland neben Metro auch Edeka und Rewe.
Fertiggerichte müssen nicht schlechter sein
als frische Gerichte – tiefgekühltes Gemüse etwa ist oft
vitaminreicher als im Laden “frisch” gekauftes; die hygienischen
Bedingungen bei der Lebensmittelherstellung sind besser als in so
mancher Küche. Oft sind sie es aber doch, vor allem die weiter
verarbeiteten Fertiggerichte: Die von Handel und Verbraucher
gewünschte lange Haltbarkeit und der Preisdruck führen dazu, dass
die “eigentlichen” Zutaten oft durch billiges Fett und Zucker
ersetzt werden, die mit Aroma- oder andere Zusatzstoffe
verkaufsfähig und haltbar gemacht werden. Die Anpassung an den
Massengeschmack mit viel Zucker oder Vanillin führt dazu, dass die
Esser sich an den künstlichen Geschmack gewöhnen –
Restaurantbesitzer berichten von Kindern, die nichts mehr ohne
Ketchup essen. In manchen Fertiggerichten werden auch minderwertige
Zutaten wie Garnelenimitate aus Fleischeiweiß, Schinkenimitat aus
Stärkegel und Fleischresten und Analogkäse aus Fett und Milcheiweiß
verwendet (nach Aussage der Verbraucherzentralen sind hier besonders
solche Hersteller verdächtig, die ihre Zutaten nicht angeben müssen,
etwa Backshops). Ebenso kritisieren die Gegner der
Fertiggericht-Kultur, dass Fertiggerichte zu einer Entfremdung von
den Grundlagen unserer Ernährung führen: Man vergisst, dass am
Anfang der Salami auf der Tiefkühlpizza ein Tier steht; man hat kein
Gefühl mehr für die Zutaten und ihre Menge (und wundert sich dann,
dass man dick wird...); man bringt sich um den Spaß, beim
Gemüseschneiden schon einmal zu naschen.
In den industrialisierten reichen Ländern führte das reichliche
Angebot an jederzeit verfügbaren, kalorienreichen und billigen
Nahrungsmitteln bei gleichzeitigem Rückgang der körperlichen Arbeit
zu einer neuen Epidemie: Übergewicht. In
Deutschland sind fast 60 Prozent der Erwachsenen übergewichtig, und
davon ein Drittel stark übergewichtig (fettleibig); bei den Kindern
und Jugendlichen sind es 15 Prozent. In den USA ist der Anteil noch
höher, bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch. Die höchsten
Zuwachsraten gibt es heute jedoch in wirtschaftlich schnell
wachsenden Schwellenländern. Starkes Übergewicht ist Wegbereiter
einer Reihe von Krankheiten (Gelenkschäden, frühzeitiger Verschleiß
der Wirbelsäule, Diabetes, Bluthochdruck, Herzleiden, psycho-soziale
Folgeerkrankungen durch Ausgrenzung) und gilt daher als
Kostentreiber im Gesundheitswesen. Da die Biochemie unseres Körpers
darauf ausgerichtet ist, mit Hungersignalen Gewichtsverluste zu
verhindern, ist es für Betroffene nicht leicht, ihr Gewicht
dauerhaft zu verringern – in den Industriestaaten richten sich daher
Programme für gesunde Ernährung und ausreichende Bewegung
insbesondere an Kinder und Jugendliche, etwa in der Schule. Und aus
diesem Grund wird auch den Nahrungsmittelkonzernen immer wieder ihre
Werbung für hochverarbeitete, kalorienreiche Snacks für Kinder und
Jugendliche vorgeworfen.
Die sinkenden Kosten für Nahrungsmittel waren auch die
Voraussetzung für den Erfolg der anderen Industrien: Geld, das nicht
für Essen gebraucht wurde, konnte für Autos, Elektrogeräte, Reisen
und andere Wohlstandsartikel ausgegeben werden – für all das, was
die industrielle Überflussgesellschaft erst ausmacht.
Immer noch nicht besiegt: Der Hunger
Wenn es in Europa nach dem Aufkommen der Industriellen
Landwirtschaft noch Hunger gab, dann – wie im ersten und zweiten
Weltkrieg – vor dem Hintergrund von Kriegen. Auch in anderen Ländern
gab es Hunger in der Folge von politischen Fehlentscheidungen: In
der Sowjetunion wurde in den frühen 1930er Jahren die Ernte
enteignet, um die Städte zu ernähren und über Exporte Geld für die
Industrialisierung einzunehmen – Millionen Tote waren die Folge; die
wohl größte Hungersnot der Weltgeschichte fand 1959 bis 1961 in
China statt, als in der Folge von Maos “Großen Sprung nach Vorne” 30
bis 45 Millionen Menschen verhungerten. In Kriegen wird Hunger auch
immer noch ganz gezielt als Waffe eingesetzt – als Waffe, die
insbesondere und gezielt die Wehrlosesten – Frauen, Kinder und alte
Menschen – angreift. Aber die meisten Menschen verhungern, weil
ihnen der Zugang zu Land verwehrt wird und sie sich Lebensmittel auf
dem Markt einfach nicht leisten können: die ärmsten Menschen auf der
Erde müssen über 70 Prozent ihres Einkommens für Nahrungsmittel
ausgeben, und Preissteigerungen bedeuten für sie meist Hunger oder
Verhungern. Dort, wo billigere Nahrungsmittel am nötigsten wären,
sind die Segnungen moderner Landwirtschaft nicht angekommen – und
dies liegt unter anderem an ungerechten Handelsbedingungen (>>
mehr).
Weiter mit:
>>
Die Folgen der Industriellen Landwirtschaft
Die Folgen der Industrialisierung für das Ökosystem Erde
>> Die
Bevölkerung der Erde
>> Rohstoffe
>> Böden
>>
Wassernutzung
>>
Wasserverschmutzung
>>
Luftverschmutzung
>> Klimawandel
>>
Gefährdung der Biodiversität
Zurück zur:
>>
Übersicht Das Zeitalter der Industrie