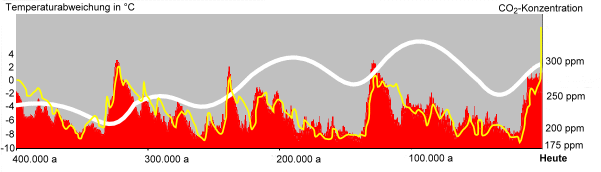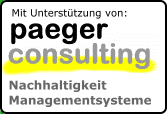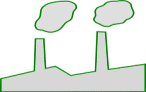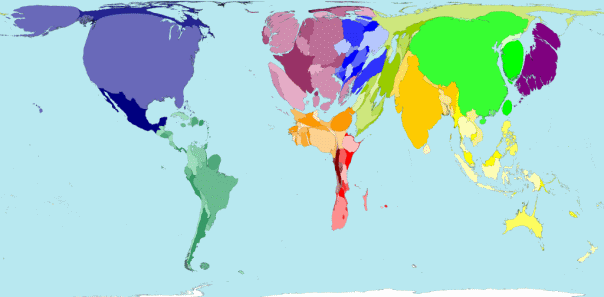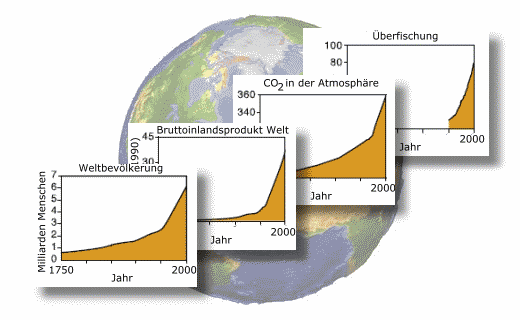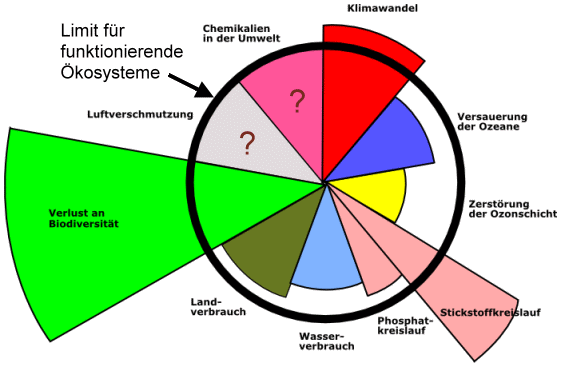Das Zeitalter der Industrie
Globale Umweltveränderungen
Eine Art Zusammenfassung - und die Suche
nach den Ursachen
Im Industriezeitalter hat der Mensch die
Fähigkeit erlangt, das Ökosystem Erde insgesamt zu verändern. Die
menschliche Bevölkerung, die technischen Möglichkeiten und die
materiellen Ansprüche der reichen Menschen bewirken
Umweltveränderungen, die auf die natürlichen Regelkreise einwirken,
die das Ökosystem Erde steuern. So entstehen globale Veränderungen
der Umwelt; ein Beispiel ist der Klimawandel. Um solche Folgen
unseres Handels zu vermeiden, müssen wir lernen, komplexe
Wechselwirkungen zu erkennen und zu berücksichtigen.
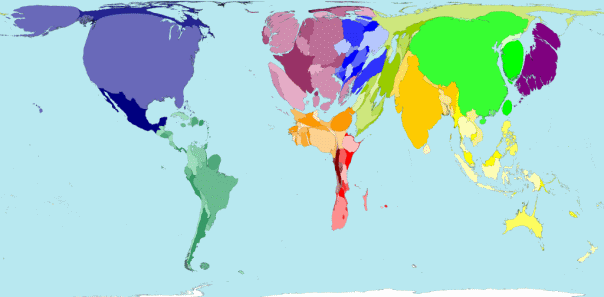
Die Karte zeigt die Länder der
Welt einmal entsprechend ihrem Einfluss auf die Umwelt:
Die Fläche eines jeden Staates entspricht dem >>
Ökologischen Fußabdruck seiner Bewohner. Deutlich zu erkennen
ist, dass a) die Länder des Nordens einen unverhältnismäßig großen
Anteil am Umweltverbrauch haben, und dass b) reiche Länder im
Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl mehr verbrauchen als arme
Länder. Abbildung: © Copyright 2006 SASI Group (University of
Sheffield) and Mark Newman (University of Michigan), >> www.worldmapper.org,
mit freundlicher Genehmigung.
Im Jahr 1979 wurde erstmals die Erde als ein >>
einziges Ökosystem beschrieben; heute wissen wir, dass
tatsächlich Ozeane, Luft und Festland und das Leben durch eine
Vielzahl von Verbindungen und Rückkoppelungen miteinander verbunden
sind und sich gegenseitig beeinflussen (>> Die
Erde als Ökosystem). Zur gleichen Zeit hatten wir es auch
erstmals mit globalen Umweltveränderungen zu tun: 1985 erschienen
die ersten Berichte über das >>
Ozonloch, zur gleichen Zeit wurden auch die ersten Anzeichen
für einen >>
Klimawandel unübersehbar. Die dadurch ausgelöste intensive
Erforschung globaler Aspekte hat gezeigt, wie die Folgen
menschlicher Aktivitäten in natürliche Regelkreise eingreifen und
das Ökosystem Erde insgesamt verändern können - und zwar in einem
Ausmaß, das bei unverändertem Fortschreiten den Fortbestand der
menschlichen Zivilisation selbst gefährden könnte.
So sind von den 130 Millionen Quadratkilometern eisfreier
Festlandsfläche auch der Erde bereits über 100 Millionen
Quadratkilometer vom Menschen weitgehend umgestaltet worden (1090),
weitgehend unbewohnte Wildnis findet sich nur noch in Teilen des
Amazonasgebietes, in Sibirien und Nordkanada und den großen Wüsten
dieser Erde (Sahara, Gobi, Victoria-Wüste). Den Einfluss des
Menschen zeigt aber auch die Auswertung des Wostok-Eisbohrkerns, mit
dem Klimadaten aus der Vergangenheit (>>
Die Methoden der Paläoklimatologen) ermittelt wurden:
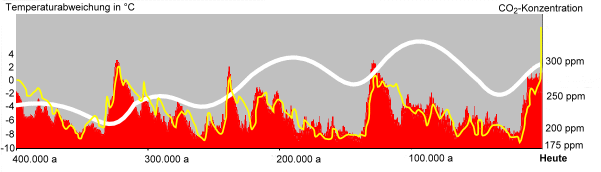
Klimadaten aus dem
Wostok-Eisbohrkern: Temperaturverlauf (rot) und
Kohlendioxid-Gehalt (gelb) der Atmosphäre in den letzen 400.000
Jahren. Weiß dargestellt: Veränderungen der Exzentrizität der
Erdumlaufbahn. Quelle der Wostok-Daten:
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/icecore/antarctica/vostok/vostok.html
Der Wostok-Eisbohrkern erlaubte, Temperaturverlauf und
Kohlendioxid-Konzentration in der Antarktis über die letzten 400.000
Jahre darzustellen. Der Temperaturverlauf umfasst vier Eiszeiten,
und die weiße Darstellung der Änderungen der Sonneneinstrahlung
infolge der >>
Exzentrizität der Erdumlaufbahn zeigt, dass diese die
Eiszeiten auslöste. Erkennbar ist auch, dass der Verlauf der
Temperatur und der Kohlendioxid-Konzentration sehr ähnlich sind,
wobei die Kohlendioxid-Konzentration immer zwischen 180 und 300 ppm
blieb - nur in der Gegenwart stieg sie auf inzwischen 400 ppm.
Verantwortlich für diese Änderung ist der Mensch, der in Folge der
>>
Industriellen Revolution in kürzester Zeit die Vorräte an
fossilen Brennstoffen, die sich über Hunderttausende von Jahren
angesammelt haben, verbrennt (>> mehr).
Damit verursachen wir Kohlendioxid-Konzentrationen, wie es sie in
den letzten 400.000 Jahren nicht gegeben hat. Dieser >>
Klimawandel hat also eine erdgeschichtlich vollkommen neue
Ursache - den Menschen.
Das
Anthropozän
Der niederländische Meteorologe Paul Crutzen, der im Jahr 1995 für
seinen Beitrag zur >>
Erforschung des Ozonlochs den Chemie-Nobelpreis erhielt,
schlug aufgrund des dominierenden Einflusses der Menschheit auf die
gesamte Erde vor, das gegenwärtige Zeitalter “Anthropozän” zu nennen
- die Epoche des Menschen:
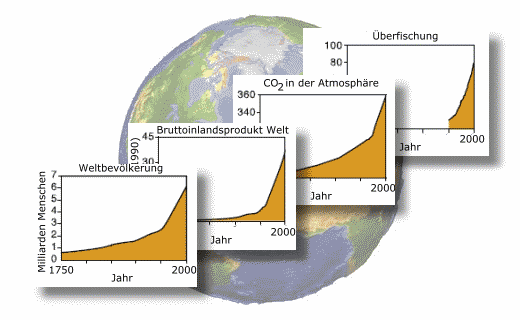
Globale Umweltveränderungen des
Industriezeitalters wie Klimawandel und Überfischung der
Weltmeere gehen auf eine wachsende Weltbevölkerung und den Wohlstand
eines Teils dieser Bevölkerung zurück. Grafiken aus Will Steffen und
Susannah Elliot: Global Change and the Earth System. Executive
Summary. Stockholm: IGBP Secretariat 2004.
Diese Epoche beginnt mit der Industriellen Revolution, und seither
hinterlässt die Menschheit ihre Spuren in einem Ausmaß, das in den
Grafiken oben angedeutet ist. Kennzeichen des Anthropozäns
sind der in Eisbohrkernen (siehe oben)
feststellbare Anstieg der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan,
gewissermaßen chemische Kennzeichen der menschlichen (industriellen)
Aktivitäten.
Das Anthropozän ist dadurch gekennzeichnet, dass die
Weltbevölkerung auf über sieben Milliarden Menschen anwuchs, die die
Erde nach ihren Vorstellungen umgestalteten: Etwa die
Hälfte der Erdoberfläche besteht aus Siedlungen, Acker- und
Weideland; der Mensch nutzt etwa >>
40 Prozent der biologischen Produktion der Erde. Dies ging auf
Kosten der natürlichen Ökosysteme und der in ihnen lebenden Arten:
Unter anderem wurden die Hälfte aller Feuchtgebiete und die Hälfte
aller Mangroven vernichtet, das Artensterben ist heute mindestens
>>
einhundert Mal stärke als es ohne Menschen wäre. Die
technische Stickstofffixierung - vor allem zur Herstellung von
Kunstdünger - übertrifft die biologische. Auch die Weltmeere
haben wir Menschen erobert: Dort werden >> 90 Prozent aller Fischbestände bis
an die Grenze oder darüber hinaus genutzt.
Der neben der Aneignung des Landes und des Ozeans
andere große Einfluss ist die Nutzung fossiler
Energiequellen: Sie sind verantwortlich für die meisten
Treibhausgase, deren >>
energetische Wirkung unsere technische Energienutzung um ein
-zigfaches übertrifft, und die Menge des aus fossilen Brennstoffen
freigesetzten Schwefels übertrifft ebenfalls die im natürlichen
Schwefelkreislauf zirkulierenden Mengen.
Die Gefährdung der Ökosysteme
Im Jahr 2009 hat eine Gruppe um den Schweden Johan Rockström
abzuschätzen versucht, inwieweit die Veränderung der natürlichen
Ökosysteme bereits deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigt. Dazu
haben sie neun grundlegende ökologische Prozesse untersucht und
Grenzen festgelegt, bei deren Überschreitung mit negativen Folgen
gerechnet werden muss. Dies ist bei drei Prozessen bereits heute der
Fall (siehe Abbildung):
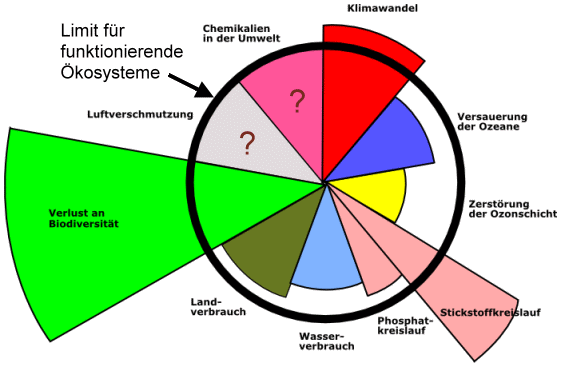
Gefährdung der Funktionsfähigkeit
von natürlichen Ökosystemen durch Umweltbelastungen. Die
“Tortenstücke” zeigen das Ausmaß der Umweltbelastung an, der Kreis
zeigt die Grenzwerte, ab denen Ökosysteme unwiderruflich geschädigt
werden. Weisen die Tortenstücke über den Kreis hinaus, sind diese
Grenzwerte bereits überschritten. Für Luftverschmutzung und
Chemikalien in der Umwelt sind noch keine Grenzwerte festlegbar.
Eigene Abbildung nach Jonathan Foley: Boundaries for a Healthy
Planet. Scientific American April 2010, Seite 39.
Danach sind beim Klimawandel, bei der Veränderung des
Stickstoffkreislaufs und beim Verlust an Artenvielfalt die Grenzen
bereits überschritten. Die Autoren weisen ausdrücklich darauf hin,
dass auch bei den anderen Umweltbelastungen Handeln notwendig sei,
da diese Veränderungen ebenfalls bereits schwere Folgen hätten.
Welche, kann an vielen Orten der Erde besichtigt werden, wie der
folgende Kasten zeigt.
Die 10 größten Umweltprobleme der Welt
Im Jahr 2008 haben das Blacksmith Institute und Green Cross
International eine Liste der 10 größten Umweltprobleme der Welt (aus
der Sicht des Menschen - für Ökosysteme siehe oben) erstellt. Danach
sind dies:
- Nichtindustrieller Goldabbau: 10 bis 15
Millionen Schürfer fördern mit “handwerklichen” Methoden etwa ein
Viertel des Goldes; oft benutzen sie Quecksilber, um das Gold aus
dem Erz zu lösen. Damit schädigen sie ihre eigene Gesundheit, und
Quecksilber gelangt über Luft und Abwasser in die Umwelt, wo es
sich in der Nahrungskette anreichert. Zu den Folgen von
Quecksilber siehe auch >>
hier.
Weitere Informationen: National Geographic >> The
Real Price of Gold (englischsprachig)
- Verschmutzte Oberflächengewässer:
Verschmutztes Wasser verursacht nach Angaben der
Weltgesundheitsorganisation fünf Millionen Tote im Jahr; vor allem
durch Bakterien und Viren, die durch Fäkalien ins Wasser gelangen,
durch Schwermetalle oder durch organische Verbindungen aus der
Industrie. >>
mehr
- Verschmutztes Grundwasser: Grundwasser ist die
größte Süßwasserquelle auf der Erde (>> mehr),
es wird durch undichte Abfalldeponien, durch Pestizide und Dünger
aus der Landwirtschaft und weggekipptes Altöl verschmutzt; oft
wird die Belastung erst nach Jahren oder Jahrzehnten bemerkt.
>>
mehr
- Luftschadstoffe in Innenräumen: Die
Verbrennung von Kohle, Holz, Holzkohle und Dung in behelfsmäßigen
(“Drei-Steine”)-Öfen in schlecht gelüfteten Räumen führt zu
Lungen- und Augenerkrankungen und kostet nach Schätzungen jedes
Jahr bis zu drei Millionen Menschen das Leben. >>
mehr
- Industrieller Bergbau: Beim Bergbau fallen
mineralische Abfälle (Gesteine) und feinkörnige Schlämme an.
Metallsulfid-Verbindungen in den Gesteinen können Säuren
produzieren; und wenn zum Abtrennen des Erzes vom Gestein giftige
Chemikalien verwendet werden, finden auch diese sich in den
Schlämmen. Die Gesteine beeinträchtigen auch durch ihre große
Menge Landschaft und Landwirtschaft in der Umgebung. >> mehr
- Metallschmelzen und -verarbeitung: In Schmelzen
wird das Metall unter Zugabe von Reduktionmitteln wie Koks oder
Holzkohle aus den Erzen gewonnen; dabei können große Mengen an
Schwermetallen, Schwefel- und Stickoxiden anfallen, die die Luft
und die umgebenden Böden verschmutzen. Bei der Verarbeitung werden
oft große Mengen Schwefelsäure benutzt, die ebenfalls oft
freigesetzt wird; und als Abfall entstehen giftige Schlacken.
>> mehr
(Von den 10 dreckigsten Orten auf der Welt, die das Blacksmith
Institute im Jahr 2007 ermittelte, gingen 5 auf Bergbau und
Metallschmelzen und -verarbeitung zurück: Tianying in China,
Sukinda in Indien, La Oroya in Peru, Norilsk in Russland und Kabwe
in Sambia, >>
mehr)
- Radioaktive Abfälle und Abfälle aus dem Uranbergbau:
Uranerz kommt oft in niedriger Konzentration vor, daher ist die
Menge an Abfällen und Schlämmen sehr groß, sie enthalten zudem
noch viel Radioaktivität. Radioaktive Abfälle fallen vor allem in
Atomkraftwerken, beim Militär und in Krankenhäusern. Vor allem
arme Länder halten oft die üblichen industriellen
Sicherheitsstandards beim Umgang mit diesen Materialien nicht ein.
>> mehr
- Ungeklärtes Abwasser: Abwasser aus Haushalten
enthält Fäkalien und Reinigungschemikalien und trägt damit zur
Verschmutzung von Gewässern (siehe oben) bei. Auf der Erde haben
2,6 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen,
die den Kontakt von Menschen mit Fäkalien vermeiden könnten. Die
Folge sind die Verbreitung von Krankheiten wie Cholera, Typhus,
Amöbenruhr und Wurminfektionen. >>
mehr
- Luftverschmutzung in Städten: In Städten
konzentrieren sich die Quellen der Luftverschmutzung: Feinstaub,
Ruß, Stick- und Schwefeloxide aus Kraftwerken, Autos und Industrie
sind nach Angaben der WHO jedes Jahr für 865.000 Tote
verantwortlich. Nach Angaben der Weltbank sind die 5 Städte mit
der schmutzigsten Luft auf der Erde Kairo (Ägypten, Delhi und
Kolkata (Kalkutta) in Indien sowie Tianjin und Chongqing (China).
>> mehr
- Recycling von Batterien: Jedes Jahr werden
über 8 Millionen Tonnen Blei produziert, davon gehen über 85
Prozent in die Herstellung von Autobatterien. Die Wiedergewinnung
von Blei aus alten Batterien ist ein lohnendes Geschäft - und wird
in vielen Ländern mit unglaublichen Methoden praktiziert: Das
Gehäuse wird mit einer Axt geöffnet, die Batteriesäure läuft in
den Boden und Blei wird mitunter in Küchen geschmolzen.
Mehr: >>
www.worstpolluted.org. Siehe auch die Karte mit den zehn meist
verschmutzten Orten, die das Blacksmith Institute im Jahr 2007
ermittelt hat >> hier.
Die Triebkräfte der globalen Umweltveränderung
Hinter dieser Entwicklung stehen zwei grundlegende Entwicklungen:
Der >>
Anstieg der menschlichen Bevölkerung und der wirtschaftliche
Wohlstand des reichen Anteils der Bevölkerung. Alle
Menschen haben Grundbedürfnisse: Wasser, Nahrung, ein Dach über dem
Kopf, Kleidung. Um die Ernährung von über sieben Milliarden Menschen
zu sichern, wurden etwa 40 Prozent der Oberfläche des Festlandes in
Acker- und Weideland >> umgewandelt
und im Laufe der Zeit immer >>
intensiver bewirtschaftet; werden 40 Prozent der biologischen
Produktion der Erde alleine vom >>
Menschen genutzt); wurde die Landwirtschaft zum größten
>>
Wasserverbraucher der Erde und trägt ihren Teil zu >>
Wasserverschmutzung und Klimawandel bei.
Nicht alle diese Ressourcen dienen freilich dazu, die
Grundbedürfnisse nach Ernährung, Wohnen oder Kleidung abzudecken.
Noch wesentlich deutlicher sind die Auswirkungen des
wirtschaftlichen Wohlstands des reichen Teils der Weltbevölkerung
auf das Ökosystem Erde. Der größte Teil des menschlichen Ressourcen-
und Energieverbrauchs deckt die Nachfrage nach Gütern, die den
Lebensstil der reichen Industrieländer ermöglichen, in denen eine
Vielzahl elektrischer Geräte, Autos und Urlaubsreisen längst
selbstverständlich geworden sind. Mittlerweile kommen diese beiden
Entwicklungen zusammen: Die beiden bevölkerungsreichsten Länder der
Erde, Indien und China, befinden sich auf dem Weg der
Industrialisierung (>>
mehr) und zu einem Ressourcenverbrauch, der dem der reichen
Länder entspricht.
Das alles wäre nicht weiter schlimm, würden nicht die Folgen dieser
Ressourcennutzung und der damit verbundenen Verschmutzung von Luft
und Wasser inzwischen die Ernährung der Weltbevölkerung und
diesen Wohlstand gefährden. Dies geschieht auf lokaler
wie globaler Ebene. Wenn kanadische Fischer nicht mehr fischen
können, weil die Kabeljaubestände vor Neufundland zusammenbrechen
(>>
mehr), werden zwar die finanziellen Folgen durch Zahlungen des
Staates abgemildert, aber die Frage stellt sich, wie es geschehen
kann, dass ein hochentwickeltes Industrieland mit
hochspezialisierten Fischereibiologen das Problem nicht so
rechtzeitig angeht, um das Schlimmste zu vermeiden. Und: Wenn es
dort schon nicht klappt, wie sollen globale Probleme wie die
Abholzung von Tropenwäldern, der Klimawandel oder das Artensterben
gelöst werden?
Wie man mit Fisch reich werden kann
Eine der Triebkräfte sind die ökonomischen Gesetze,
die so erfolgreich bei der Schaffung materiellen Wohlstands waren.
Sie belohnen die Zerstörung der Natur. Ein
Beispiel (in Anlehnung an den kanadischen Ökologen Colin Clark):
Stellen Sie sich einmal vor, Ihnen gehört ein Fischgrund, in dem
Fische mit einem Marktwert von 10 Millionen Dollar leben. Wir nehmen
weiter einmal an, dass sie gelernter Biologe sind und wissen, dass
Sie nachhaltig fünf Prozent davon fischen könnten - der
Fischbestand bliebe gleich, sie hätten 500.000 Dollar Einnahmen im
Jahr. Genug, um davon ihre Ausgaben und Mitarbeiter zu bezahlen und
ordentlich zu leben; und stolz auf nachhaltige Naturnutzung könnten
Sie auch noch sein. Eines Tages treffen Sie dann einen alten Freund,
der Betriebswirtschaft studiert hat. Auch er ist in die Fischerei
eingestiegen - und dabei reich geworden. Er hat im Unterschied zu
Ihnen seine Fische so rasch wie möglich gefangen - sein Einkommen
war viel höher als Ihres, und einen Teil hat er investiert, und zwar
dort, wo er mehr als fünf Prozent Kapitalrendite erhalten hat. Nach
ein paar Jahren war sein Fischgrund zwar zerstört - kein Problem,
mit dem erwirtschafteten Geld konnte er sich einen neuen kaufen, und
hatte sogar noch Geld über.
In Wirklichkeit ist es bei Fischen noch viel schlimmer: Wer seine
Fischgründe schützt, wird dem hemmungslos ausbeutenden Nachbarn
sogar noch Fische liefern, denn Fische sind ja beweglich. Dieses
Problem wurde schon 1968 von Garrett Hardin als “Tragedy of the
Commons” beschrieben. Hardins Beispiel: Ein Hirte, der ein
zusätzliches Rind auf eine Weide stellt, profitiert vom zusätzlichen
Ertrag des Rindes. Mögliche Schäden durch Überweidung werden aber
von allen Nutzern geteilt - es bleibt ein unter dem Strich ein
Nutzen für den Hirten. Da dies aber für alle andern Hirten auch
gilt, käme es bei “logischem” Verhalten immer zu Überweidung (oder
Überfischung oder jeder anderen Art von Übernutzung). In der
Geschichte war daher die Nutzung der “Allmende” (wie die
mittelalterlichen Gemeingüter genannt wurden) immer genau geregelt.
(Siehe auch >> hier.)
In vielen schweizerischen Dörfern dürfen noch heute nur so viele
Tiere auf die gemeinschaftliche Weide, wie die Besitzer auf ihrem
eigenen Land durch den Winter bringen können.
Warum es so schwer ist, Regeln festzulegen
Heute werden die Gemeinschaftsgüter (wie Luft, Wasser, Ressourcen,
...) aber global genutzt, und da sind Regeln nicht so einfach zu
finden. Beispiel kanadischer Kabeljau: Kabeljaubestände haben - wie
fast alle Arten in der Natur - mal gute und mal schlechte Jahre, und
diese sind auch heute noch für die Fischereibiologen nicht
vorherzusehen. Legen sie hohe Fangquoten fest und wird das Jahr
schlecht, müssen die Fangquoten im Folgejahr sehr niedrig werden:
Proteste der Fischer, die ja weiter die Kredite für ihre Boote
abzahlen müssen, sind sicher. Legen sie die Fangquoten niedrig fest,
protestieren die Fischer gleich - niedrige Fangquoten verhindern ein
höheres Einkommen. Aus den Vorschlägen der Fischereibiologen und den
Forderungen der Fischer wurde daher von den zuständigen Politikern
ein Kompromiss gemacht - tendenziell eher in Richtung der Fischer,
denn der Verlauf der Wirtschaftsentwicklung bleibt ja nicht ohne
Auswirkungen auf die Wahlstimmen. Jeder Einzelne hat aus seiner
Sicht richtig gehandelt - aber das Ergebnis war der Zusammenbruch
der Kabeljaubestände.
"The
environmentalist's paradox"
Die mangelnde Bereitschaft, auf die Warnungen von Wissenschaftlern
zu hören, hat auch damit zu tun, dass die Warnungen mit dem
tatsächlichen Leben der meisten Menschen in den reichen Ländern
wenig zu tun haben: Wer soll denn glauben, dass die Zerstörung der
Leistungsfähigkeit der Ökosysteme unseren Wohlstand gefährdet, wenn
wir davon im täglichen Leben nichts spüren? Uns geht es doch gut -
und Daten über die durchschnittliche Lebenserwartung oder die
Kindersterblichkeit zeigen, dass es auch der Menschheit insgesamt
wahrscheinlich noch nie so gut ging wie heute. Die
Nahrungsmittelproduktion ist wahrscheinlich der Wirtschaftssektor,
der am wichtigsten für den Menschen und zugleich auch am
abhängigsten von den Dienstleistungen natürlicher Ökosysteme ist -
aber bisher konnte die Nahrungsproduktion schneller wachsen als die
Menschheit.
Dieser - scheinbare oder echte? - Widerspruch ist als
"environmentalist's paradox" (Paradox der Umweltschützer)
bezeichnet und untersucht worden (940).
Eine oft gehörte Vermutung ist ja, dass technische und soziale
Innovationen den Menschen von natürlichen Ökosystemen abgekoppelt
haben. Tatsächlich zeigt sich aber, dass diese zwar dafür sorgen,
dass Ökosysteme effizienter genutzt werden - ein Beispiel ist die
Steigerung der Nahrungsmittelproduktion durch Kunstdünger, die
bisher den Verlust an Bodenfruchtbarkeit mehr als ausgleichen konnte
-, aber die Abhängigkeit von diesen Ökosystemen nicht beseitigt
haben. Stickstoffdünger etwa wird aus fossilen Brennstoffen
hergestellt, und die sind endlich. Tatsächlich nutzen wir - das
zeigt der >> ökologische
Fußabdruck - bereits unser Kapital - aber davon ist noch genug
da, so dass wir die Folgen noch nicht direkt spüren. Der wesentliche
Grund für das "environmentalist's paradox" ist also eine
Zeitverzögerung zwischen der Schädigung von Ökosystemen und den
Auswirkungen auf unser Leben. Der britische Meeresbiologe >> Callum Roberts vergleicht
unser Verhalten denn auch mit dem von Schuldnern, die noch in Saus
und Braus leben - noch haben wir den wirklichen Preis für unser
Handeln nicht zu spüren bekommen, aber die Rechnung ist schon
unterwegs.
Unser Umgang mit komplexen
Wechselwirkungen
Das Beispiel des Kabeljaus macht deutlich, dass komplexe
ökonomische, soziale, kulturelle und technische Entwicklungen der
Menschheit einen Einfluss auf die schon alleine nicht einfach
verständlichen Regelungssysteme des Ökosystems Erde haben. Die
vielfältigen Wechselbeziehungen sind längst nicht mehr intuitiv
erfassbar - siehe "the environmentalist's paradox", sondern
wir sind auf mathematische Modelle angewiesen, um die möglichen
Auswirkungen unseres Handelns zu verstehen. Beim gegenwärtigen Stand
unseres Wissens sind die Modelle und ihre Ergebnisse mit
Unsicherheiten behaftet: Zum einen sind die Annahmen über mögliche
Entwicklungen der Menschheit mit Unsicherheit behaftet, zum anderen
die Wechselbeziehungen in den Regelungssystemen längst nicht
alle ausreichend genau bekannt. Und dieses wird auch noch lange so
bleiben. Wir werden also damit leben müssen, Entscheidungen auf der
Basis noch bestehender Unsicherheiten treffen zu müssen; noch dazu
auf Grundlage mathematischer Modell, da unsere Sinne nicht
geschaffen wurden, globale Zusammenhänge zu erfassen. Ob der Mensch
hierzu in der Lage ist, muss sich erst noch zeigen.
Wo wir stehen, kann man am Beispiel des Klimawandels beobachten:
Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden von einem
Expertengremium, dem Intergovernmental Panel on Climate Change
(>> IPCC)
gesichtet und für Entscheidungsträger zusammengefasst, die auf
dieser Basis politische Entscheidungen treffen können. Dabei zeigt
die politische Diskussion, dass bestehende Unsicherheiten auch ein
Grund sein können, nicht zu handeln: Es besteht ja eine kleine
Chance, dass doch noch alles ganz anders kommt, während etwa tief
greifende Maßnahmen sofort und für alle spürbar wären. Wenn die
Wissenschaftler nicht irren, werden sich die Folgen aber summieren:
Aufgrund der Trägheit der riesigen Wassermassen der Ozeane wird die
Temperaturerhöhung selbst dann noch über Jahrzehnte weitergehen,
wenn ab sofort die Konzentration an Treibhausgasen nicht weiter
ansteigen würde. Callum Roberts hat wohl recht: Die Rechnung ist
noch unterwegs.
Was wir sicher wissen, ist: Der Einfluss des Menschen reicht heute
aus, das Ökosystem Erde zu verändern. Der Zustand in den letzten
10.000 Jahren hat die Entstehung einer menschlichen Zivilisation
erlaubt, aber auch die Instrumente geschaffen, den Ast abzusägen,
auf dem wir sitzen. In der Geschichte sind schon einige menschliche
Zivilisationen an Umweltveränderungen zugrunde gegangen (>> Diamond:
Kollaps); jetzt steht aber möglicherweise die
menschliche Zivilisation insgesamt auf dem Spiel. Das bisher
vorherrschenden Denken jedenfalls führt in eine terra incognita
(Paul Crutzen), einen Zustand der Erde, wie wir ihn niemals erlebt
haben und der nach allem, was wir wissen, auch nicht erstrebenswert
ist.
Die Tragfähigkeit des Ökosystems Erde erhalten
Um unser Handeln mit der Reichweite unserer Einflüsse wieder
vereinbar zu machen, wäre eine neue Ethik der globalen Verantwortung
für unsere Lebensgrundlagen notwendig. Viele Industrien haben es
geschafft, in der Vergangenheit ihre Abfälle zu reduzieren; global
reicht die Ressourceneffizienz bei weitem noch nicht aus. Auch die
Energieeffizienz ist in der Vergangenheit gestiegen, auch sie bei
weitem nicht genug. Die Umstellung auf kohlenstofffreie
Energieträger hat gerade erst begonnen. Große Herausforderungen
bleiben, wie etwa die Versorgung absehbar (über) neun Milliarden
Menschen mit Nahrung und sauberem Wasser.
Die wirtschaftliche Aufholjagd von Indien und China zeigt zudem,
dass die Industrieländer nicht mehr alleine über die Zukunft des
Ökosystems Erde entscheiden: Die Globalisierung der Wirtschaft führt
auch zu globalen Abhängigkeiten und Beziehungen; globale Probleme
fordern globale Lösungen - die aber immer auch lokales Handeln
bedeuten werden. Auch dies ist eine ganz neue Herausforderung, denn
viele Schwellen- und Entwicklungsländer haben noch ganz andere
Prioritäten. Aber nicht nur der Waren-, auch der Ideenaustausch ist
inzwischen global, auch in Indien, China und anderen Ländern gibt es
längst viele Menschen, die umdenken. Ideen, wie die Tragfähigkeit
des Ökosystems Erde für den Menschen erhalten werden und das Leben
für die Menschen dennoch mindestens so lebenswert wie heute bleiben
kann, gibt es genug. Hiervon handelt der nächste Abschnitt: >>
Strategien
für die Zukunft.
Weiter zu:
>> Strategien
für die Zukunft
Ähnliche Themen:
>> Die
Erde als Ökosystem