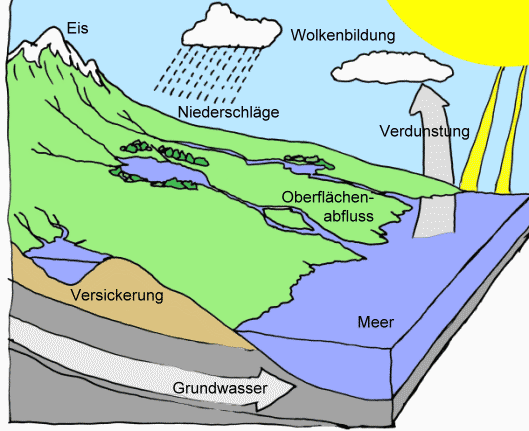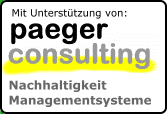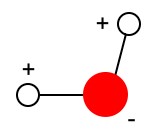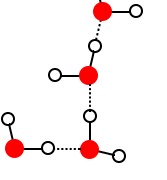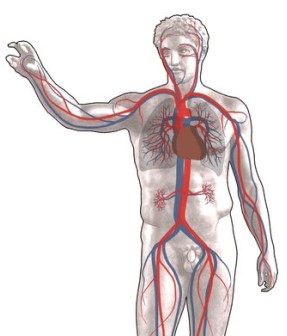Das globale Ökosystem
Die Quelle des Lebens
Die Hydrosphäre
Die Erde ist vom Weltall aus betrachtet ein
blauer Planet – dies ist die Farbe des Wassers,
das fast drei Viertel seiner Oberfläche bedeckt. Erst das
Vorhandensein von Wasser ermöglicht Leben. Aus diesem Grund suchen
Raumsonden auf anderen Planeten nach Wasser – ohne Wasser werden
dort mit Sicherheit keine Lebewesen gefunden. Auf der Erde ist
Wasser reichlich vorhanden, 1,4 Milliarden Kubikkilometer insgesamt.
Allerdings ist das Wasser über die Erde und über das Jahr
ungleichmäßig verteilt, so dass es an vielen Orten aus Sicht des
Menschen entweder zu viel oder zu wenig Wasser gibt.

Wasser kommt auf der Erde
flüssig, als Eis oder (hier als Wolke) als Gas vor.
Das Foto zeigt einen Eisberg im Largo Argentino, aus wikipedia,
Beitrag “Wasser”,
abgerufen am 17.06.2006. Foto: Ilya Haykinson, Lizenz: Creative
Commons
Attribution
2.0
Die gesamte Wassermenge der Erde wird auf 1,4 Milliarden
Kubikkilometer geschätzt (400;
ohne die unbekannte Menge, die tief im Erdinneren in Gesteinen
eingeschlossen ist, mehr dazu >> hier).
Davon sind gut 97 Prozent Salzwasser; nur 2,75 Prozent (38,5
Millionen Kubikkilometer) sind Süßwasser. Obwohl unsere ganz frühen
Vorfahren wie alles Leben auf dem Land aus den Ozeanen gekommen sind
(siehe >> hier)
– der salzige Geschmack unseres Blutes erinnert daran, dass auch
dieser Apfel nicht weit vom Baum gefallen ist -, können wir heute
vom Salzwasser nicht leben: wir brauchen Süßwasser. Von diesem
steckt das meiste im antarktischen Eis – insgesamt sind rund drei
Viertel des Süßwassers (29 Millionen Kubikkilometer) in Gletschern
und Eisdecken gebunden. Und 98,5 Prozent des flüssigen Süßwassers
(9,5 Millionen Kubikkilometer) sind als Grundwasser in den
Hohlräumen der Lithosphäre eingelagert – nur ein kleiner Teil davon,
und der kleine Rest von 144.000 Kubikkilometern, 0,0001 Prozent des
gesamten Wassers auf der Erde, finden sich leicht zugänglich in
Flüssen und Seen, im Boden, in Lebewesen und in der Atmosphäre.
Dieses Wasser verdanken wir dem Wasserkreislauf der Erde.
Nur 0,0001 Prozent des Wasser auf der Erde sind
leicht zugängliches Süßwasser
Der Wasserkreislauf der Erde
Alle Wasserreservoire hängen zusammen, sie bilden den
Wasserkreislauf der Erde. Dieser lässt Süßwasser aus den riesigen
Salzwasservorräten der Ozeane entstehen und sorgt so dafür, dass die
Süßwasservorräte ständig erneuert werden. Angetrieben wird der
Wasserkreislauf von der Sonne: Sonnenstrahlung lässt Wasser aus den
Ozeanen, Seen und Flüssen, dem Boden und den Lebewesen verdunsten.
So gelangt es in die >> Atmosphäre.
Durch die Winde wird der Wasserdampf über die Erde verteilt, bis er
irgendwo abkühlt, dadurch wieder flüssig wird und schließlich als
Niederschlag (Regen, Schnee oder Hagel) wieder in Ozeane, Seen,
Flüsse und in den Boden gelangt, und von hier in die Lebewesen. Ein
Teil des Wasser versickert und führt zur Neubildung von Grundwasser
(siehe Abbildung):
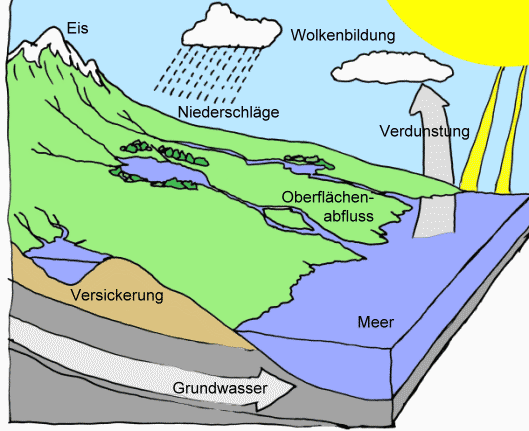
Schema des globalen
Wasserkreislaufs. Eigene Abbildung, verändert nach
Raven et al.,
Environment (1993), S. 82.
Dieser Wasserkreislauf bewegt gewaltige Mengen Wasser: Alljährlich
verdunsten etwa 505.000 Kubikkilometer Wasser, davon 434.000 über
den Ozeanen und 71.000 über dem Festland. Von diesem Wasser fallen
398.000 Kubikkilometer Niederschlag auf die Ozeane, und 107.000 auf
das Festland – es findet in der Summe also jährlich ein Transport
von etwa 36.000 Kubikkilometer (Süß-)Wasser von den Ozeanen auf das
Festland statt. Dieses Wasser fließt letztendlich über die Flüsse
oder als Grundwasserabfluss wieder in das Meer zurück. Dabei kann
das stetig fließende Wasser hartes Gestein abtragen, Sand und Geröll
von den Bergen ins Flachland und an die Küste transportieren; bei
Sturm oder bei Überschwemmungen kann es auch Naturkatastrophen
auslösen. Wasser formt damit die Landschaft der Erde. Eine wichtige
Rolle im Wasserkreislauf spielen auch die Lebewesen, vor allem die
Wälder: Wälder spielen die Rolle eines Schwammes, der das Wasser
nach Regenfällen zurückhält und anschließend nach und nach wieder
abgeben. Baumwurzeln halten den Boden fest, der Wasser speichert;
Baumkronen geben Moosen und anderen Pflanzen Schatten, die Wasser
speichern, und die Bäume verdunsten Wasser, der dann wieder als
Niederschlag fällt – große Wälder machen einen Teil ihrer
Niederschläge selbst und beeinflussen weiträumig den Wasserhaushalt.
Der von der Sonne angetriebene Wasserkreislauf
erneuert unablässig die Süßwasservorräte
Diese oben genannten Zahlen des Wasserkreislaufs bedeuten auch,
dass die Zeit, die das Wasser in den verschiedenen Reservoiren
verbringt, sehr unterschiedlich ist: Aus den Meeren mit 1,37
Milliarden Kubikkilometern verdunsten jährlich 434.000
Kubikkilometer, das Wasser wird also nur alle 3.200 Jahre komplett
ausgetauscht. In der Atmosphäre finden sich dagegen nur 13.000
Kubikkilometer Wasser – 505.000 Kubikkilometer Niederschlag
bedeuten, dass dieses Wasser etwa alle 9 Tage komplett erneuert
wird.
Die Entstehung des Wasserkreislaufs
Flüssiges Wasser gab es erst, nachdem die in ihrer frühen
Entwicklung heiße Erde soweit abgekühlt war, dass Wasser flüssig
wurde und sich aus den Regenfällen ein erster Urozean bildete (siehe
>> hier).
Das Wasser wusch Mineralien aus den Gesteinen aus, und gemeinsam mit
den Mineralsalzen aus Vulkanausbrüchen und Staub aus den Wüsten
reicherten sich diese im Laufe der Zeit immer weiter an
(Mineralsalze bleiben ja bei der Verdunstung im Meereswasser) – so
entstand über die Jahrmilliarden allmählich der Salzgehalt der
Meere, der heute zwischen 3,3 und 3,7 Prozent beträgt. (Das Ergebnis
dieses Prozesses beeinflusst übrigens auch unser Klima: Der
Salzgehalt bestimmt auch die Dichte des Meerwassers; und die Dichte
und die Temperatur sind Antriebskräfte für Meeresströmungen wie das
>> “globale
Förderband” – siehe >> Klima
der Erde.)
Möglicherweise hat das Leben selber
dazu beigetragen, dass es heute noch Wasser auf der Erde gibt: Die
Reaktion von Oxiden aus Basaltgestein mit Kohlendioxid aus der Luft
und Wasser führte zu Bildung verschiedener Karbonate, dabei wurde
Wasserstoff in die Atmosphäre freigesetzt. Wasserstoff ist aber so
leicht, dass er von der Anziehungskraft der Erde nicht festgehalten
werden kann – er entweicht in den Weltraum. Mit der Erfindung der
Fotosynthese wurde Wasserstoff aber in das Molekül Glucose
eingebunden (mehr dazu siehe >> hier);
außerdem nutzten Bakterien den Wasserstoff als Energieträger. Ohne
diese “Nebenwirkungen” des Lebens gäbe es womöglich keinen
Wasserstoff mehr auf der Erde.
Wasser
– ein ganz besonderes Molekül
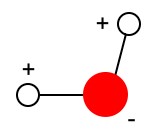
Das Wassermolekül:
weiß = Wasserstoff,
rot = Sauerstoff.
Das Molekül besitzt eine negativ und eine positiv geladene Seite.
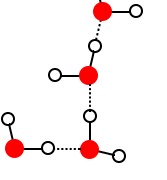
Wasserstoffbrückenbindungen (gestrichelte Linien)
ermöglichen die Entstehung eines “Netzes”, das die besonderen
Eigenschaften des Wassers erklärt.
Die chemische Formel von Wasser – H2O – ist
wahrscheinlich die bekannteste der Welt; und dennoch überrascht
Wasser die Chemiker bis heute. In vielen Punkten ist Wasser nämlich
nicht “normal” – und das ist (aus der Sicht des Lebens) auch gut so.
So hat Wasser für ein Molekül seiner Größe eigentlich einen viel zu
hohen Schmelzpunkt (0 °C), und verdampft erst bei 100 °C; nur darum
gibt es Flüsse und Seen auf der Erde. “Normalerweise” werden Stoffe
immer dichter, je kälter sie werden – Wasser nicht. Daher schwimmt
Eis auf dem Wasser (und können Lebewesen unter der Eisdecke
überleben). Auch die Wärmespeicherkapazität von Wasser ist viel
größer, als es einem Molekül seiner Größe zukommt – nur daher können
Meeresströmungen das Klima in Europa so angenehm machen.
Der Grund für diese "Anomalien" liegt in der Struktur des
Wassermoleküls. Es besitzt eine negativ und eine positiv geladene
Seite. Wassermoleküls: Das Molekül ist aufgebaut wie ein V (siehe
obere Abbildung rechts): Auf einer Seite sitzt das Sauerstoff-Atom,
auf der anderen die beiden Wasserstoff-Atome. Diese sind positiv
geladen, das Sauerstoff-Atom jedoch negativ. Und so können sich die
Wasserstoff-Atome eines Wasser-Moleküls (über eine sogenannte
Wasserstoffbrücken-Bindung) an die Sauerstoff-Atome eines anderen
Wasser-Moleküls anlagern; und daher bilden sie Verbände, die größer
sind und andere Eigenschaften haben als das eigentliche
Wasser-Molekül (untere Abbildung). Inzwischen kennen die Forscher
über 70 "Anomalien" des Wassers, und diese geben mitunter Anlass für
esoterische Spekulationen, die zumeist Beispiele für "irregeleitete
Extrapolationen" sind. Aber manche sind auch Auswirkungen sind
auch wissenschaftlich noch umstritten sind – eine Übersicht über
aktuelle Fragen gibt die (englischsprachige) Webseite Water
Structure and Science.
Seine Eigenschaften machen Wasser auch zu einem
zentralen Element des Lebens: Einerseits kann es durch seine polare
Struktur viele Stoffe lösen und ist dadurch das universale
Lösemittel des Lebens, andererseits kann es durch seine stabile
Struktur auch andere Stoffe stabilisieren, etwa Eiweiße oder die
Erbsubstanz DNA. Wie wichtig Wasser ist, mag eine Zahl
verdeutlichen: Der Körper des Menschen besteht zu etwa 60 Prozent
aus Wasser, das Gehirn gar zu 70 bis 75 Prozent.
Wasser und Klima
Auch energetisch ist Wasser ein besonderes Molekül: Um Wasser zu
erwärmen, ist sehr viel Energie notwendig. Daher speichert Wasser in
Seen und Ozeanen viel Wärme, und wirkt ausgleichend auf das Klima –
in Meeresnähe oder nahe großer Seen ist das Klima ausgeglichener als
fernab vom Wasser. Und Meeresströmungen, zum Beispiel das >> Globale
Förderband, transportieren riesige Wärmemengen aus tropischen
Regionen in nördliche Breiten und machen hier das >> Klima
angenehmer. Auch verdunstetes Wasser in der >> Atmosphäre
trägt wesentlich zum Wärmetransport durch die Winde bei; bei der
Verdunstung wird nämlich noch mehr Wärmeenergie im Wasserdampf
gespeichert (die sogenannte “latente (da nicht fühlbare) Wärme”;
diese wird freigesetzt, wenn der Wasserdampf wieder flüssig wird,
also beim Abregnen wird. Außerdem ist Wasserdampf ein Treibhausgas;
sein Anteil am natürlichen Treibhauseffekt (mehr dazu >> hier)
beträgt etwa 60 Prozent. Auch Wolken beeinflussen das Klima, indem
sie einerseits Sonnenlicht reflektieren, zum anderen aber auch
Wärmestrahlung zurückhalten. Ob Wolken letztendlich zur Erwärmung
oder aber zur Abkühlung führen, hängt von ihrer Höhe und von ihrer
Form ab – tiefe, wasserreiche Wolken kühlen, hohe Eiswolken wärmen.
Die in den Wolken transportierte Feuchtigkeit bestimmt natürlich
auch und vor allem die Niederschlagsmenge, einen weiteren wichtigen
Klimafaktor.
Wasser und Gestein
Wasser ist eines der wichtigsten Kräfte für die
Erosion – Niederschläge tragen Gebirge ab und lassen ganze
Inseln wieder vergehen; Gezeiten und brechende Wellen formen die
Küstenlinie. Damit formt der Wasserkreislauf das Gesicht der Erde.
Dabei kann er sogar geologische Vorgänge tief unter der Erde
beeinflussen, wie am Beispiel des Himalaya gezeigt wurde (mehr dazu
>> hier).
Wasser und Leben
Wasser ist die “Matrix des Lebens”: Alle physiologischen Prozesse
laufen in wässriger Umgebung ab. Erst beim Kontakt mit Wasser falten
sich die Eiweiße so, wie es für ihre Funktion notwendig ist;
biochemischen Reaktionen benutzen Wasser als ein “Schmiermittel” und
für den Transport von Protonen (positiv geladene Wasserstoffatome).
Auch die DNS,
der Träger der Erbinformation, nimmt ihre berühmte Form der
Doppelhelix nur ein, wenn Wasser vorhanden ist. Wasser bringt die
Nährstoffe aus der Nahrung in die Zellen und entfernt Reststoffe.
Die Folge: Ohne Wasser sterben die meisten Lebewesen viel schneller
als ohne Nahrung (und die wenigen Ausnahmen fallen in einen
inaktiven Zustand); nur die Luft ist noch wichtiger. Da das Wasser
in den Lebewesen beständig erneuert wird, verbindet Wasser – ähnlich
wie die Luft, siehe >> hier
– alle Lebewesen mit ihrer Umwelt und untereinander.
Daneben bildet Wasser für viele Lebewesen einen Lebensraum:
Dies gilt zuallererst für die Ozeane, die über
sieben Zehntel der Erdoberfläche einnehmen (>> Lebensräume
des Ozeans), und indirekt auch für den Menschen: Die Mehrheit
der Erdbevölkerung lebt am Rande der Kontinente, höchstens 100 km
von den Ozeanen entfernt. Diese Tatsache zeigt die Bedeutung der
Ozeane für die Menschen (und führt auch zu einer Belastung der
Ozeane durch menschliche Aktivitäten). Dies gilt für die
verschiedenen Süßwasserlebensräume, wie Flüsse und
Seen, aber auch das Wasser im Boden, das für die Lebenswelt dort
unverzichtbar ist. Im Bodenwasser sind Nährstoffe
gelöst, es dient den Pflanzen zur Deckung ihres Wasser- und
Nährstoffbedarfs und versorgt die Mikroorganismen, die organischen
Kohlenstoff, aber auch Verunreinigungen abbauen können. Wesentlich
vom Wasser werden auch die Feuchtgebiete
beeinflusst, zu denen die Niederungsgebiete der großen Flüsse,
Sümpfe, Moore und Feuchtwälder gehören. Diese Gebiete sind in der
Regel sehr produktiv und regulieren den Wasserfluss, womit sie
Hochwasser verhindern oder mildern und die Grundwasserbildung
fördern.
Über die Niederschläge beeinflusst das Wasser im Zusammenspiel mit
der Temperatur ganz wesentlich auch die Vegetation auf dem Festland
(>> Lebensräume
- Das Festland). Die Verfügbarkeit oder der Mangel an Wasser
haben zudem im Laufe der Evolution zu
einzigartigen Anpassungen der Lebewesen geführt, die gelernt haben,
mit Wassermangel, Überflutungen und Gezeiten zurecht zu kommen.
Außerdem beeinflusst die Vegetation wiederum die Verdunstung; manche
Ökosysteme wie die tropischen Regenwälder schaffen sich einen großen
Teil ihrer Niederschläge selbst.
Die Hydrosphäre
in uns
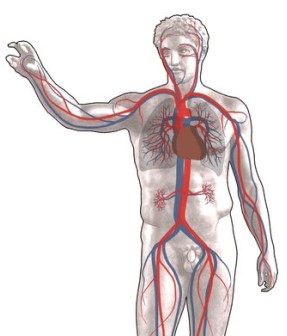
Der Blutkreislauf des Menschen, das zentrale
Verteilungssystem für Flüssigkeiten und die in ihnen gelösten
Stoffe. Abbildung verändert aus Wikipedia Commons (abgerufen
21.07.2007), Lizenz: Creative
Commons attribuition 2.5
Das Innere aller lebenden Zellen (früher “Protoplasma” genannt)
besteht weitgehend aus Wasser; hier finden sich etwa 60 Prozent des
Wassers eines menschlichen Körpers. Die anderen 40 Prozent
zirkulieren außerhalb der Zellen, so bestehen etwa 90 – 95 Prozent
des flüssigen Anteils unseres Blutes aus Wasser. Insgesamt besteht
der Mensch zu etwa 60 Prozent aus Wasser (Babys zu 75 Prozent, alte
Menschen zu 50 Prozent).
Wasser hilft beim Transport von Nährstoffen im Blut, beim
Abtransport unerwünschter Stoffe (die in den Nieren ausgefiltert und
mit dem Urin ausgeschieden werden), wirkt bei zahlreichen Reaktionen
des Stoffwechsels mit und hilft über das Schwitzen bei der Regelung
unserer Körpertemperatur.
Wasser nehmen wir durch Trinken (gut die Hälfte des
Tagesbedarfs) und mit der Nahrung (ein weiteres gutes Drittel) auf,
der Rest wird beim Stoffwechsel freigesetzt. Zu wenig Wasser löst
ein Durstgefühl aus; zu viel Wasser führt dazu, dass die Nieren mehr
Wasser abscheiden. So bleibt der Wasserhaushalt im Gleichgewicht,
solange genug Wasser zur Verfügung steht. Ohne Wasser aber kann der
Mensch nur ein paar Tage lang überleben ...
Das Wasser und die Menschheit
Die Bedeutung des Wassers hat dazu geführt, dass das Wasser in
vielen Religionen als Quelle der Existenz beschrieben wird (das
rituelle Bad der Hindus im Ganges, die rituelle Waschung der Moslems
vor dem Betreten einer Moschee und die christliche Taufe erinnern
daran); und dass der Mensch während seiner gesamten Geschichte die
Nähe zum Wasser gesucht hat. Die ersten Siedlungen der Menschheit
wurden dort angelegt, wo es genug Wasser gab (>>
hier), viele große Städte sind an Flüssen oder dem Meer
entstanden. Im Laufe der Zeit hat sich die Situation oft grundlegend
geändert: War Mesopotamien vor 5.000 Jahren noch eine grüne
Landwirtschaftsregion (>> hier),
liegen hier heute die Wüsten des Irak; lag Tenochtitlàn, die
Hauptstadt der Azteken (>> hier),
noch auf einer Insel, ist Mexiko-City heute eine Stadt mit
konstanten Wasserproblemen. Wasser ist in vielen Regionen der Welt
knapp – 40 Prozent aller Haushalte in Afrika südlich der Sahara
liegen über eine halbe Stunde von der nächsten Quelle entfernt.
Viele dieser Probleme hat der Mensch selbst verursacht. Entwaldung
zerstört die Speicherfähigkeit der Ökosysteme; Niederschläge fallen
heute oft nicht mehr auf den Boden, in Seen oder Flüsse, sondern auf
vom Menschen versiegelte Fläche: auf Straßen, Parkplätze oder
Gebäude. Dieser Niederschlag füllt dort kein Grundwasser mehr auf,
sondern wird über die Kanalisation in die Flüsse geleitet und
gelangt mit diesen ins Meer. (In Deutschland sind schätzungsweise
sechs Prozent der Landfläche versiegelt, täglich kommen etwa 120
Hektar dazu – ein bedeutender Anteil des Wassers wird dadurch dem
natürlichen Wasserkreislauf entzogen. Mehr zum Thema: >>
hier). Die Wirkung der Bodenversiegelung wird noch dadurch
verstärkt, dass viele Flüsse seit Beginn der Industrialisierung
begradigt und eingedeicht wurden (>> mehr),
wodurch ebenfalls der Abfluss beschleunigt und die Neubildung von
Grundwasser verringert wurde. Erst in jüngster Zeit wird die
Bedeutung der natürlichen Wasserspeicherung für die Ökosysteme und
die Wasserversorgung der Menschen langsam erkannt, in einigen
Regionen der Erde beginnt man bereits, Feuchtgebiete und
Flusssysteme wieder in einen naturnahen Zustand zu versetzen.
Wassermangel kann man aber auch dadurch zu beheben versuchen, dass
man Wasser aus weit entfernten, wasserreicheren Regionen, in die
Städte führt. Aquädukte gehören fast so lange zur Geschichte der
Menschheit wie der Bau von Städten (>> mehr);
der Bau von Stauseen ebenso, erreichte aber im Industriezeitalter
neue Dimensionen. Dabei entsteht Wassermangel heute nicht nur
dadurch, dass zu wenig Wasser vorhanden ist, sondern auch dadurch,
dass das verfügbare Wasser verschmutzt wird (>> mehr).
Mehr zum Thema Wasser:
Die
Nutzung des Wassers durch den Menschen
Eine
kleine Geschichte der Wasserverschmutzung
Lebensräume
des Ozeans
Das globale Ökosystem – weiter mit:
Das Klima der Erde
- die Hydrosphäre (Wasser)
Zur
Übersicht