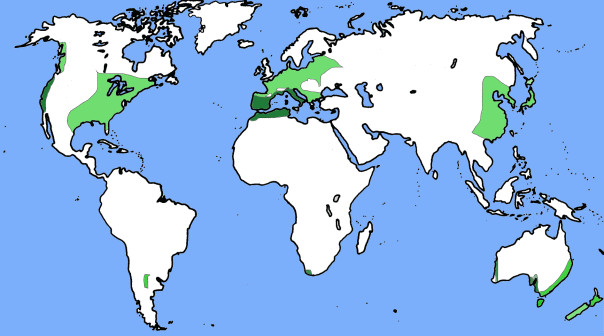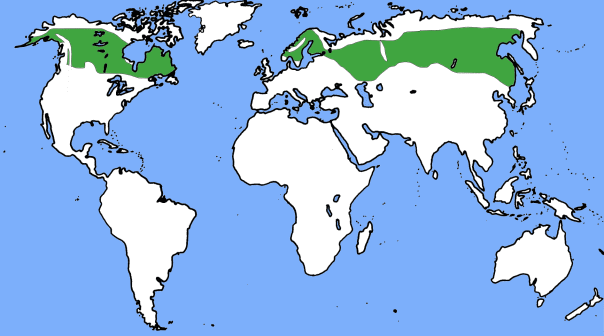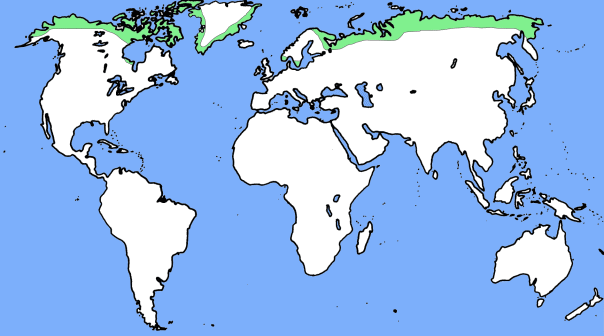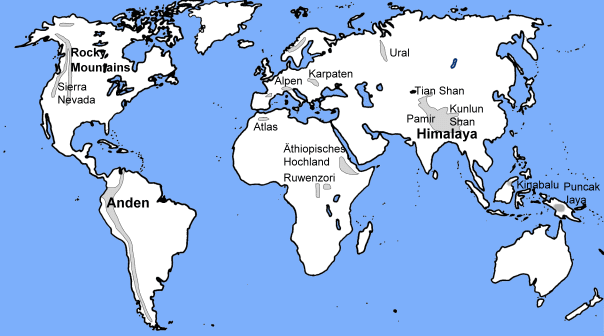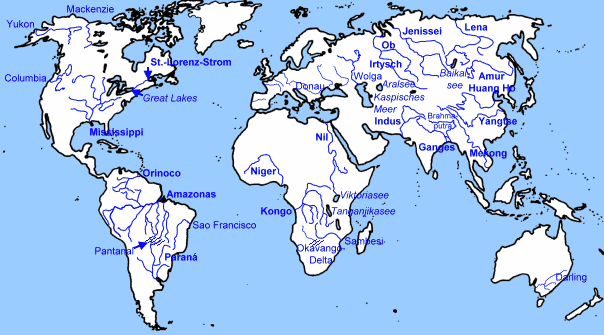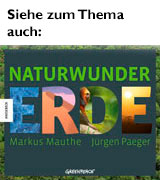Das globale Ökosystem
Die Lebensräume des Festlands
Das Festland
Knapp drei Zehntel der Oberfläche unseres Planeten sind Festland.
Wie im Meer, so ist auch hier die pflanzliche Produktion die Basis
allen Lebens; nur spielt hier nicht im Wasser schwebendes
Phytoplankton diese entscheidende Rolle, sondern vor allem im Boden
wurzelnde Pflanzen: Der größte Teil der pflanzlichen Biomasse auf
dem Festland steckt in den Wäldern dieser Erde, aber auch Grasländer
sind sehr produktiv. Das >> Klima,
das Relief und die >>
Böden bestimmen, welche Pflanzen wo wachsen können; und die
Pflanzen bestimmen mit, welche Tiere wo leben können, welche
Ökosysteme also entstehen können. Diese würden die Erde prägen, gäbe
es nicht den Einfluss des Menschen, der die natürlichen Ökosysteme
großflächig durch Landwirtschaft, Siedlungen und Verkehrswege
ersetzt hat (>> mehr);
heute ist die Kenntnis der potenziellen natürlichen Ökosysteme die
Basis für die Entwicklung naturverträglicher Bewirtschaftungsformen.
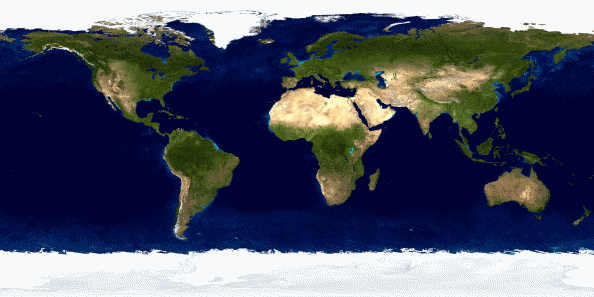
Die Erde aus dem Weltall.
Abb. aus Satellitenfotos zusammengesetzt, (Quelle: NASA, http://visibleearth.nasa.gov/).
Die Produktivität und der Reichtum der
natürlichen Lebensräumen auf dem Festland sind in erster Linie von
der Sonnenstrahlung und der Verfügbarkeit von Wasser abhängig. Die
reichsten Lebensräume gibt es da, wo es reichlich Sonne und
Süßwasser gibt. Bei den Lebensräumen kann man grob zwischen Wäldern,
Grasland und Wüsten unterscheiden; Wälder wachsen überall, wo es
nicht zu kalt, zu trocken oder zu nährstoffarm ist – dort entstehen
Grasländer oder gar Wüsten.
Tropenwälder
Die artenreichsten, komplexesten und produktivsten Ökosysteme des
Festlandes sind die immergrünen tropischen Regenwälder.
Sie ziehen sich als ein breiter Gürtel rund um den Äquator um die
Erde; hier kommen 50 bis 75 Prozent aller Arten vor, nach Ansicht
mancher Biologen sogar 90 Prozent. Im tropischen Regenwald werden
regelmäßig auf 100 x 150 Meter eines Waldstücks 200 Baumarten
gezählt: Mehr als in ganz Europa heimisch sind. Über die Gründe
dieser Vielfalt wird noch spekuliert: Zum einen wurden die
Regenwälder während der Eiszeiten nie ganz zerstört, aber
ausreichend gestört, um die Entwicklung neuer Arten anzuregen. Zum
anderen ermöglicht das ganzjährig feuchtwarme Klima eine
ununterbrochene Tätigkeit der Bakterien und Pilze, die abgestorbenes
Material schnell abbauen – was einen permanenten Nachschub an
Mineralstoffen sicherstellt, aber auch verhindert, dass eine dicke
Humusschicht entsteht. Die Bäume sind höher als in gemäßigten Zonen,
sie werden bis zu 60 Meter hoch; Lianen hängen von ihnen herab,
Kletterpflanzen winden sich hinauf, auf den Zweigen siedeln Farne,
Orchideen und Bromelien als "Aufsitzer": Die zahlreichen
Kleinstlebensräume des Regenwaldes fördern nicht nur die Vielfalt an
Pflanzen, sie ermöglichen auch eine außerordentliche Vielfalt an
Insekten, Amphibien, Reptilien und anderen Tieren. Und die
Wechselwirkungen zwischen so vielen Arten kann die Vielfalt dann
immer weiter steigern, etwa durch gegenseitige Anpassungen – so gibt
es Fische, die äußerlich von einem treibenden Blatt nicht zu
unterscheiden sind; Geckos, die Baumrinde nachahmen; Fangschrecken,
die sich als Orchideenblüte tarnen: Tarnung ist einer der
spannendsten Aspekte dieser Wechselwirkungen. Die Vielfalt sollte
aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in einem Regenwald weniger
Tiere, und vor allem weniger große Tiere, leben als etwa auf
Grasländern. Dies liegt daran, dass weniger als 10 Prozent der
Biomasse jedes Jahr umgesetzt werden (der Rest ist in beständigen
Strukturen wie Holz gespeichert); in einer Savanne beispielsweise
aber 30 Prozent.
Tropische Regenwälder binden jedes Jahr
1 – 3,5 Kilogramm Kohlenstoff pro Quadratmeter.
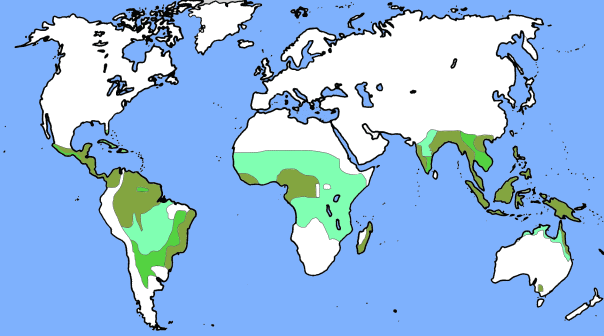
Natürliche Ausdehnung der Tropen:
Tropische und subtropische Wälder: Dunkel – immergrüner Regenwald,
mittelgrün – Saisonregenwälder und laubabwerfende Wälder, hellgrün –
Dornwälder und Savannen,
(Tropische Regenwälder gehören heute zu den Lebensräumen, deren
Vernichtung besonders zum Verlust an biologischer Vielfalt (>>
mehr) beiträgt, mehr >>
hier.)
Die trockenen Tropen
Abseits der tropischen Regenwälder gibt es weitere Tropenwälder: Zu
den Wendekreisen hin gibt es zwar noch genug Regen, aber die
Trockenzeit wird immer länger – je nach ihrem Einfluss bilden sich
über Saisonregenwälder (etwa die asiatischen
Monsunwälder) schließlich tropische laubabwerfende Wälder,
wie die Teakwälder Südasiens und die Mahagoniwälder Afrikas (beide
Waldtypen sind heute weitgehend abgeholzt), bis hin zu den Dornwäldern,
etwa die Caatinga Brasiliens. Zwischen den trockenen
Tropenwäldern und den Grasländern stehen die Savannen,
bei denen eine offene Baum- und Strauchschicht über Grasland steht.
An den tropischen und subtropischen Küsten stehen die Mangrovenwälder,
deren Bedeutung für den >> Lebensraum
Ozean wir dort schon gesehen haben.
Grasländer und Wüsten
An den Wendekreisen sinkt die warme, trockene Luft in Bodennähe, es
gibt kaum Niederschläge, so dass es für Wälder zu trocken wird: hier
entstehen Grasländer und Wüsten.
Der Übergang beginnt mit den tropischen und subtropischen Savannen,
und geht dann über die Halbwüsten in die großen Trockengebiete
nördlich und südlich der Tropen über; Regen fällt dort oft über
Jahre nicht. Zu den größten Wüsten gehören die Sahara und die Gobi,
zu den ältesten die Namib im Südwesten Afrikas. Solch extreme
Lebensräume fordern Anpassungen des Lebens an die Trockenheit; so
speichern viele Pflanzen Feuchtigkeit oder keimen erst nach
Regenfällen. Tiere leben oft im Untergrund und kommen erst im
Dunkeln an die Oberfläche, so halten es viele Echsen und die Mungos.
Mehr über Wüsten: Naturwunder
Erde – Wüsten
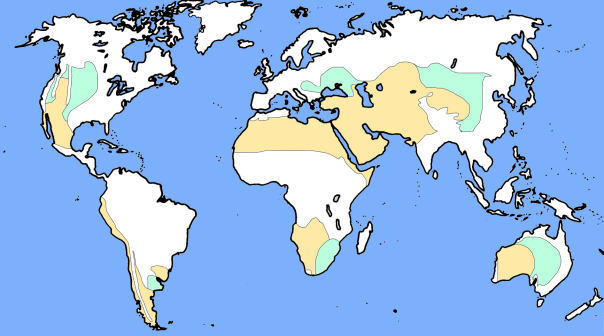
Ausdehnung der Steppen
(hellgrün) und der Wüsten (hellbraun),
Grasländer gibt es auch in den gemäßigten
Zonen, wie die Puszta in Ungarn, die Prärien Nordamerikas oder die
Pampa Südamerikas: Es sind dies Regionen mit kontinentalem Klima;
die weit entfernten Ozeane liefern nicht genug Feuchtigkeit und
können die Unterscheide zwischen heißen, trockenen Sommern und
kalten Wintern nicht abmildern; Bäume wachsen in solchem Klima
nicht. Ein großer Teil der pflanzlichen Biomasse steckt bei
Grasländern im Boden; die Wurzeln können viele Meter tief reichen.
Da bei Gräsern die gesamte oberirdische Pflanze Fotosynthese treibt,
sind Grasländer in der Regel sehr produktiv; daher leben in ihnen
oft große Herden wandernder Pflanzenfresser, etwa Gnus, Zebras und
Gazellen in Afrika, Bisons in Nordamerika oder Saiga-Antilopen in
der russischen Steppe. Dabei haben sich Gräser und Pflanzenfresser
im Laufe der Evolution so weit aneinander angepasst, dass die
Beweidung den Gräsern nicht schadet – im Gegenteil, manche Gräser
wachsen besser, wenn sie beweidet werden.
Schlechtes Futter
– große Tiere
Pflanzen bestehen im wesentlichen aus zwei
Molekülgruppen: Die eine besteht aus Stoffen wie Zellulose und
Lignin und baut Stützgewebe, z.B. Holz, aus; die andere besteht aus
Proteinen und Kohlehydraten und steht mit dem Stoffwechsel in
Verbindung. Letztere sind für Pflanzenfresser sehr nährreich, die
ersteren viel weniger. Das Verhältnis dieser beiden Gruppen hängt
vom Nährstoffreichtum des Bodens ab: Pflanzen auf nährstoffarmen
Böden bilden relativ mehr Stützgewebe, bei Pflanzen auf
nährstoffreichen Böden wird ein größerer Anteil an Proteinen und
Kohlehydraten gebildet. Pflanzenfresser, die von Pflanzen
nährstoffarmer Böden leben, müssen daher mehr essen, um den geringen
Anteil an Proteinen und Kohlehydraten auszugleichen; sie brauchen
daher ein größeres Verdauungssystem und einen größeren Körper, in
den dieses passt (außerdem brauchen größere Tiere im Verhältnis zum
Körpergewicht weniger Nährstoffe, kommen also eher mit
nährstoffarmer Nahrung aus). Die größten heute lebenden
Pflanzenfresser auf dem Festland sind Elefanten – ihre Größe ist
keine Folge guter Ernährung, sondern im Gegenteil eine Anpassung an
die schlechte Qualität ihrer Nahrung. (Elefanten brauchen jedoch
eine Menge Nahrung: Daher sind sie am häufigsten, wo die Böden zwar
nährstoffarm sind, es aber ausreichend regnet, so dass genug
Pflanzen wachsen.)
Wälder des Mittelmeerklimas
Jenseits der Trockengebiete finden sich einige Regionen mit
Mittelmeerklima – hier sind die Sommer heiß und trocken, die Winter
aber mild und regenreich. Mittelmeerklima findet sich oft auf der
Westseite der Kontinente, da hier im Winter Westwinde von Meer Regen
bringen; Beispiele sind der Mittelmeerraum, Kalifornien, Chile und
die Kapregionen in Südafrika und Südwest-Australien. Hier bilden
sich mediterrane Hartlaubgehölze – kleine, harte
Blätter schränken die Verdunstung im trockenen Sommer ein. Hierzu
gehören die Steineichenwälder des Mittelmeerraums, das Chaparral in
Kalifornien, die Jarrah- und Karriwälder Australiens und die
Hartlaubwälder Chiles. Bei ausreichender Feuchtigkeit kann sich hier
auch immergrüner temperierter Laubwald wie der
kanarische Lorbeerwald halten; andere Beispiele finden sich im
Südosten der U.S.A., wo zunehmend immergrüne Arten in den
sommergrünen Laubwäldern vorkommen. Besonders artenreich sind die gemäßigten
Regenwälder, die in Gebieten mit sehr hoher Feuchtigkeit
vorkommen: Am spektakulärsten sind wohl die Küstenmammutwälder an
der nordamerikanischen Pazifikküste, daneben kommt dieser Waldtyp
auch an der chilenischen Pazifikküste, in Südaustralien und auf
Neuseeland vor. Ähnlich wie die tropischen Regenwälder sind diese
Wälder sehr artenreich.
Webseiten zum Thema:
>> Temperate
Rainforests of the Northern Pacific Coast
[englischsprachig]
Das National Geographic Magazine hat einige
schöne Artikel über die gemäßigten Regenwälder der
nordamerikanischen Pazifikküste veröffentlicht und ins Internet
gestellt (allesamt englischsprachig):
>> Nature's
Champion – über den Olympic National Park ganz in
Nordwesten der USA (Juli 2004)
>>
Redwoods. The Super Trees – über die Küstenmammutbaumwälder
(Oktober 2009)
>>
Spirit Bear – über die Regenwälder des kanadischen British
Columbia (August 2011)
Die größten Bäume
der Welt
 In den Küstenmammutwäldern der
nordamerikanischen Pazifikküste stehen die größten Bäume der Welt:
Der größte hat eine Stammhöhe von über 115 Metern. Der
Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) ist ein Nadelbaum.
Typisch für die Mammutwälder sind Nebel, die vor allem im Sommer zum
Wasserhaushalt beitragen. Sein Holz, aufgrund seiner rötlichen Farbe
als “Redwood” bekannt, ist aufgrund seiner Dimension und
hoher Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Pilze eines der besten
Nutzhölzer überhaupt – eine Eigenschaft, die beinahe das Ende der
Wälder bedeutet hätte. Ihre Abholzung begann, als Kalifornien 1848
von Mexiko an die USA abgetreten wurde und Goldfunde zahlreiche
Siedler anlockten; einen Höhepunkt erreichte er beim Wiederaufbau
San Franciscos nach dem Erdbeben von 1906. Heute sind weniger als
fünf Prozent der Küstenmammutwälder unberührter Urwald, die größten
Reste befinden sich im Redwood National Park im Norden
Kaliforniens. Über die richtige Bewirtschaftung der übrigen Wälder
wird in den USA intensiv gestritten.
In den Küstenmammutwäldern der
nordamerikanischen Pazifikküste stehen die größten Bäume der Welt:
Der größte hat eine Stammhöhe von über 115 Metern. Der
Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) ist ein Nadelbaum.
Typisch für die Mammutwälder sind Nebel, die vor allem im Sommer zum
Wasserhaushalt beitragen. Sein Holz, aufgrund seiner rötlichen Farbe
als “Redwood” bekannt, ist aufgrund seiner Dimension und
hoher Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Pilze eines der besten
Nutzhölzer überhaupt – eine Eigenschaft, die beinahe das Ende der
Wälder bedeutet hätte. Ihre Abholzung begann, als Kalifornien 1848
von Mexiko an die USA abgetreten wurde und Goldfunde zahlreiche
Siedler anlockten; einen Höhepunkt erreichte er beim Wiederaufbau
San Franciscos nach dem Erdbeben von 1906. Heute sind weniger als
fünf Prozent der Küstenmammutwälder unberührter Urwald, die größten
Reste befinden sich im Redwood National Park im Norden
Kaliforniens. Über die richtige Bewirtschaftung der übrigen Wälder
wird in den USA intensiv gestritten.
Abbildung: Küstenmammutwald im Redwood National Park.
Foto: US National Park Service.
>> Copyright
Information.
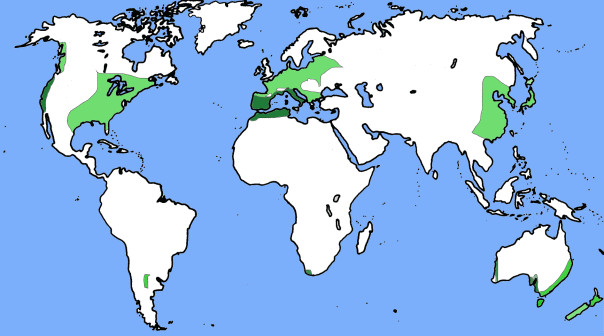
Natürliche Ausdehnung der
mediterranen Hartlaub-Wälder (dunkel) und der sommergrünen
Laubwälder (mittelgrau).
Sommergrüne Laubwälder
Bei gemäßigtem Klima, wie es in Mitteleuropa vorherrscht, bilden
sich sommergrüne Laubwälder, etwa die typischen
Buchenwälder Deutschlands. Die ausgedehnten Winter machen das
Abwerfen der Blätter erforderlich; die Sommer sind lang genug, dass
es sich für die Pflanzen lohnt, Blätter neu austreiben zu lassen
(werden die Sommer zu kurz, wie weiter im Norden oder in den Bergen,
herrschen Nadelbäume vor). Neben Mitteleuropa kommen ausgedehnte
sommergrüne Laubwälder auch in der Osthälfte der USA, im Osten
Chinas, in Korea und in Japan vor. Diese Laubwälder stehen im
allgemeinen auf guten Böden, typische Baumarten sind Buchen, Eichen,
Ahorn und Erlen; die mitteleuropäischen Wälder sind aufgrund der
Eiszeiten relativ artenarm. An sich aber sind alle Wälder relativ
artenreich: Aufgrund ihrer Höhe bieten sie Tieren auch weit über dem
Erdboden Lebensräume; da zudem umstürzende Bäume immer wieder Lücken
reißen, bestehen Wälder aus einem Mosaik aus altem Bestand,
Lichtungen und heranwachsenden Bäumen – wenn dieses Bild heute
selten ist, liegt es daran, dass die meisten „Wälder“ heute intensiv
bewirtschaftete Forsten sind.
Die Taiga des Nordens
Weiter nördlich wachsen boreale Nadelwälder (auch
Taiga genannt); sie bedecken etwa 11 Prozent des Festlandes und
kommen auf der nördlichen Halbkugel vor: Sie bedecken die nördliche
Hälfte Nordamerikas (Kanada, Alaska) und Eurasien von Skandinavien
über Sibirien bis in die Mongolei – ein 700 bis 2.000 Kilometer
hoher und 13.000 Kilometer breiter Waldgürtel. Die ausgedehnten
Nadelwälder bestehen aus nur wenigen Baumarten, meist Fichten,
Kiefern, Tannen oder Lärchen. Nadeln reduzieren die Verdunstung in
der kalten Jahreszeit, wenn das Wasser im Boden gefroren ist, können
aber sofort mit der Fotosynthese beginnen, sobald es taut; sie
nutzen die kurze Vegetationszeit daher sehr effektiv. Häufig sind in
der Taiga feuchte Vertiefungen, die von den eiszeitlichen Gletschern
ausgeschabt wurden: Hier mischen sich Erlen, Birken und Weiden unter
die Nadelbäume. In der Taiga leben große Raubtiere wie der
Amur-Tiger, Bären, Wölfe und der Luchs; die größten Pflanzenfresser
sind die Elche, im Winter wandern die Rentierherden aus der Tundra
(siehe unter Grasländer) in die Taiga. Der überwiegende Teil der
Tiere ist aber klein bis mittelgroß, viele Nagetiere und kleinere
Räuber (Hermelin, Zobel, Nerz) kommen hier vor.
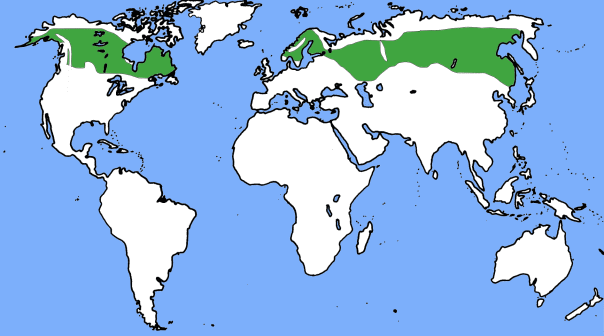
Natürliche Ausdehnung
der borealen Nadelwälder (Taiga).
Die Tundra
Nördlich der Taiga wird es dann zu kalt für Bäume: Hier bleibt der
tiefere Boden ständig gefroren, und daher können die Wurzeln
größerer Pflanzen nicht tief genug eindringen. Daher hier kommen vor
allem Moose, Flechten, Seggen und niedrige Zwergsträucher vor; dies
ist die Tundra. Im Winter halten es hier nur sehr widerstandsfähige
Tiere wie Moschusochse und Polarfuchs aus, auch im Sommer ist die
Tundra nicht artenreich; die relativ wenigen Arten können aber in
großer Zahl vorkommen: Schneegänse und Rentiere werden in großer
Zahl von den langen Tagen angelockt.
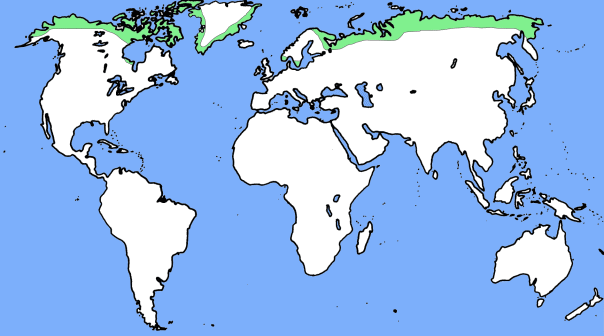
Ausdehnung der Tundra.
Webseite zum Thema:
Einen aktuellen Artikel zur Gefährdung der Tundra im Norden Alaskas
durch die Erdölförderung findet sich auf der Webseite des National
Geographic Magazine: >> Fall
of the Wild (englischprachig).
Gebirge
Variiert wird die Vielfalt noch durch Gebirge und die durch das
Wasser bestimmten aquatischen Lebensräume. Bei den
Gebirgs-Ökosystemen entdeckte der Naturforscher Alexander von
Humboldt (>>
hier), dass die Höhenstufen der Abfolge der Vegetation von den
Tropen zu den Polen entsprach. In den Alpen etwa folgen auf die
Laubwälder nach oben hin Nadelwälder (entsprechend der Taiga) und
auf diese die alpine Stufe, die der Tundra entspricht; in den
tropischen Gebirgen kommen noch die tropischen und subtropischen
Stufen dazu.
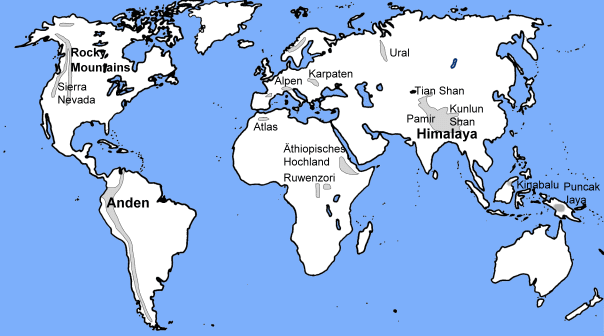
Die wichtigsten Gebirgszüge der
Erde.
Alexander von Humboldt und
seine Nachfolger
Im Jahr 1799 verwirklichte Alexander von Humboldt
einen langjährigen Traum: Die Erforschung der Welt, um das
“Ineinanderweben aller Naturkräfte, ... den Einfluss der toten Natur
auf die belebte Tier- und Pflanzenschöpfung” zu untersuchen. Durch
den Tod seiner Mutter zu großem Vermögen gekommen, hoffte er, sich
der Weltumsegelung von Kapitän Baudin anschließen zu können. Als
diese verschoben wird, beginnen Humboldt und ein Botaniker, Aimé
Bonpland, den er in Paris kennengelernt hat, auf eigene
Faust: Am spanischen Hof erhält er einen Reisepass für Spaniens
Besitzungen in Übersee und setzt auf eigene Kosten nach Neu-Granada
über. Er landet in Cumaná (im heutigen Venezuela), und erkundet fünf
Jahre lang die Regenwälder, Savannen und Hochgebirge des heutigen
Venezuelas, Kolumbiens, Ecuadors, Perus, Mexikos und Kubas, befährt
den Orinoco (und sieht, dass dieser tatsächlich mit dem Amazonas
verbunden ist) und scheitert an der Besteigung des Chimborazo (6.310
m), der damals als der höchste Berg der Erde gilt. Humboldt und
Bonpland sammeln tausende von Pflanzen, von denen 3.600 neu für die
Wissenschaft sind. Später malt Humboldt aus der Erinnerung ein
Aquarell des Chimbarazo, in das er seine wissenschaftlichen
Beobachtungen einträgt – und die Höhenzonen beschreibt. Diese Karte
und sein Werk “Ideen zu einer Geographie der Pflanzen” gelten als
Begründung der Vegetationsgeographie, der Beziehung der Vegetation
zu den Landschaften der Erde. Auf dem Rückweg war er drei Wochen
Gast von Thomas Jefferson, dem dritten Präsidenten der USA, und
verbrachte den Rest seines Lebens damit, seine Notizen, Zeichnungen
und Sammlungen zu sichten und in einer 29bändigen Reisebeschreibung
zu veröffentlichen. Sein Meisterwerk wurde aber der unvollendete
“Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung”. Das Buch ist
heute noch lesenswert.
Baudin startete seine Reise übrigens
im Jahr 1800, und erkundete drei Jahre lang die Südsee. Auf der
Reise wurden unter anderem 18.400 Tiere gesammelt, von denen 2.500
neu für die Wissenschaft sind. Weitere große naturkundliche
Studienreisen waren die der deutschen Naturkundler Johann
Baptist von Spix und Carl Friederich Philipp
von Martius, die 1817 bis 1829 Brasilien und das
Flusssystem des Amazonas erkunden; die Erforschung des indischen
Hochlandes durch den englischen Botaniker Joseph Hooker
von 1847 bis 1849, die der südamerikanischen Tierwelt durch den
englischen Zoologen Henry Walter Bates von 1848
bis 1859.
Süßwasserlebensräume
Zu den Lebensräumen des Süßwassers gehören Ströme, Flüsse und Bäche
sowie Seen, Teiche und Moore sowie periodisch überflutete
Feuchtgebiete; sie alle können erheblich zum biologischen Reichtum
eines jeden Lebensraumes beitragen. Der weitaus größte Anteil des
Süßwassers ist jedoch als ewiges Eis in den Polkappen gebunden. An
den Polen ist der Wechsel zwischen Winter und Sommer (man könnte
auch sagen, zwischen Nacht und Tag, denn jenseits der Polarkreise
ist es im Winter 24 Stunden am Tag dunkel und im Sommer 24 Stunden
lang hell) sehr drastisch; in der wegen ihrer Höhe kälteren
Antarktis bleiben im Winter nur eine Pinguin- und eine Robbenart.
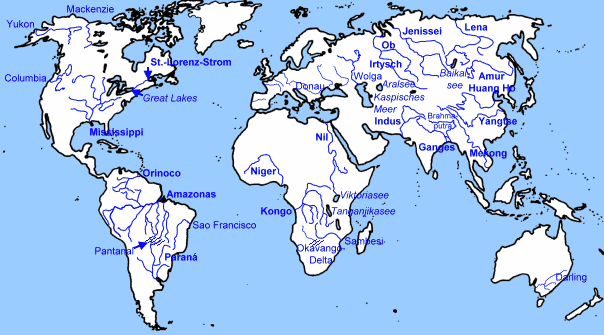
Große Flüsse, Seen und
Feuchtgebiete der Erde.
Weitere Seiten zum Ökosystem Erde:
>> Übersicht
>> Die
Erde als Ökosystem
>> Boden
>> Wasser
>> Luft
>> Klima
>> Lebensraum
Ozean
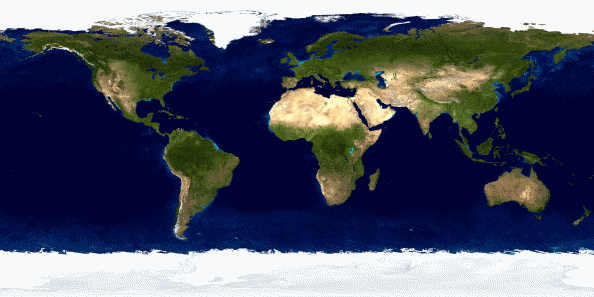
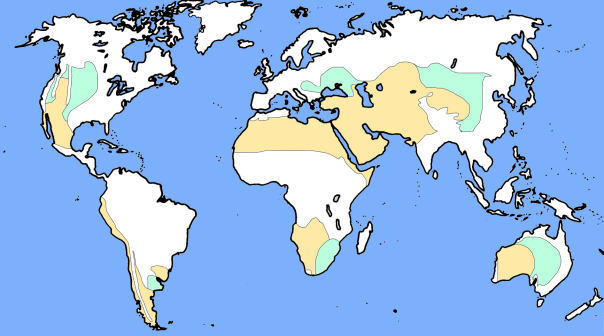
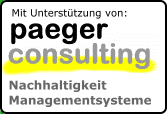


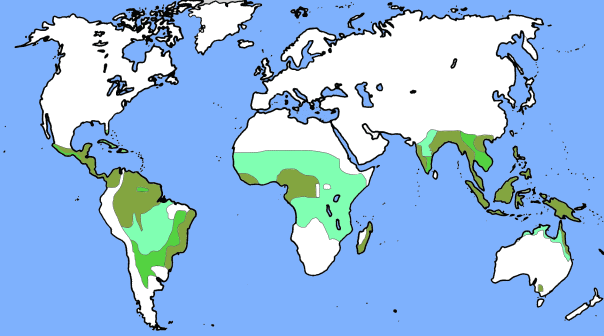
 In den Küstenmammutwäldern der
nordamerikanischen Pazifikküste stehen die größten Bäume der Welt:
Der größte hat eine Stammhöhe von über 115 Metern. Der
Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) ist ein Nadelbaum.
Typisch für die Mammutwälder sind Nebel, die vor allem im Sommer zum
Wasserhaushalt beitragen. Sein Holz, aufgrund seiner rötlichen Farbe
als “Redwood” bekannt, ist aufgrund seiner Dimension und
hoher Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Pilze eines der besten
Nutzhölzer überhaupt – eine Eigenschaft, die beinahe das Ende der
Wälder bedeutet hätte. Ihre Abholzung begann, als Kalifornien 1848
von Mexiko an die USA abgetreten wurde und Goldfunde zahlreiche
Siedler anlockten; einen Höhepunkt erreichte er beim Wiederaufbau
San Franciscos nach dem Erdbeben von 1906. Heute sind weniger als
fünf Prozent der Küstenmammutwälder unberührter Urwald, die größten
Reste befinden sich im Redwood National Park im Norden
Kaliforniens. Über die richtige Bewirtschaftung der übrigen Wälder
wird in den USA intensiv gestritten.
In den Küstenmammutwäldern der
nordamerikanischen Pazifikküste stehen die größten Bäume der Welt:
Der größte hat eine Stammhöhe von über 115 Metern. Der
Küstenmammutbaum (Sequoia sempervirens) ist ein Nadelbaum.
Typisch für die Mammutwälder sind Nebel, die vor allem im Sommer zum
Wasserhaushalt beitragen. Sein Holz, aufgrund seiner rötlichen Farbe
als “Redwood” bekannt, ist aufgrund seiner Dimension und
hoher Widerstandsfähigkeit gegen Fäulnis und Pilze eines der besten
Nutzhölzer überhaupt – eine Eigenschaft, die beinahe das Ende der
Wälder bedeutet hätte. Ihre Abholzung begann, als Kalifornien 1848
von Mexiko an die USA abgetreten wurde und Goldfunde zahlreiche
Siedler anlockten; einen Höhepunkt erreichte er beim Wiederaufbau
San Franciscos nach dem Erdbeben von 1906. Heute sind weniger als
fünf Prozent der Küstenmammutwälder unberührter Urwald, die größten
Reste befinden sich im Redwood National Park im Norden
Kaliforniens. Über die richtige Bewirtschaftung der übrigen Wälder
wird in den USA intensiv gestritten.