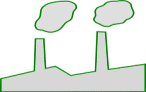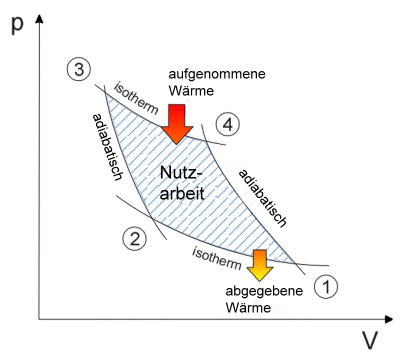Das Zeitalter der Industrie
Hintergrundinformation
Die Erforschung der Energie
Energie – und insbesondere die Umwandlung von Wärme in nutzbare Arbeit – wurde mit der Nutzung der Dampfmaschine auch zu einem wissenschaftlichen Thema, dessen Erforschung die Grundlage für unsere heutige Energienutzung legte.

Fadenpendel gehörten zu den ersten Körpern, mit denen Naturforscher die Gesetze der Bewegung und diese verursachenden Kräfte untersuchten; eine Beschäftigung, die zur Entdeckung der Energie führte. Mit Hilfe des hier abgebildeten Foucaultschen Pendels zeigte der französische Physiker Léon Foucault zudem, dass sich die Erde um ihre Achse drehte. Ausschnitt eines Fotos von Mirela Britchi aus wikipedia, abgerufen 1.11.2017, Lizenz: >> c.c. 3.0
Von den Anfängen zum Energieerhaltungssatz
Das Wort Energie tauchte zum ersten Mal in Aristoteles’ Metaphysik als energeia auf: Aristoteles stellte neben die wirkliche Welt noch die mögliche Welt – wenn etwa jemand auf einem Stuhl sitzt, kann er jederzeit aufstehen und weggehen. Dazu muss er aber tätig werden; und energeia war das, was man aufbringen musste, um das Mögliche zum Wirklichen zu machen. Als solches war sie eine philosophische Verallgemeinerung, mit der Veränderungen erklärt werden konnten. (Wärme war für Aristoteles eine eigene und unzerstörbare Substanz.)
Die mathematische Beschreibung der Natur, die schließlich zur heutigen Vorstellung von Energie führen sollte, entwickelte sich über Jahrhunderte. Dahinter stand auch der Traum von Geräten und Maschinen, die dem Menschen die Arbeit abnehmen konnten. Bereits 200 v.u.Z. wurden in China Wasserräder gebaut, um das Jahr 600 wurden in Persien Windräder genutzt. Aber Flüsse konnten austrocknen, der Wind wehte nicht immer: schon früh träumte die Menschheit von einem "perpetuum mobile", einer Maschine, die ewig lief und dabei auch noch Arbeit verrichten konnte. Alle Versuche, eine solche zu bauen, scheiterten aber. Ab 1775 lehnte die Französische Akademie der Wissenschaften die Prüfung weiterer Vorschläge ab, Begründung: "Diese Art Forschung hat mehr als eine Familie zugrunde gerichtet, und in vielen Fällen haben Techniker, die Großes hätten leisten können, ihr Geld, ihre Zeit und ihren Geist darauf verschwendet."
Dass der Bau eines perpetuum mobile unmöglich war, hatte die entstehende moderne Naturwissenschaft gezeigt. Zu deren Begründern zählt Galileo Galilei, der Ende des 16. Jahrhunderts die Fallgeschwindigkeit von Körpern (mit "Körpern" meinen Naturforscher Gegenstände jeder Art) untersuchte und feststellte, dass die erreichte Geschwindigkeit von der Fallhöhe abhing, und es für den Zusammenhang eine Regel gab (das Quadrat der erreichten Geschwindigkeit [v²] war proportional der Fallhöhe [h]: h ∝ v² in der von Galilei bevorzugten "mathematischen Sprache", ∝ bedeutet proportional). Der niederländische Naturforscher Christiaan Huygens untersuchte Mitte des 17. Jahrhunderts den Zusammenstoß zweier Körper (hierzu ließ er Kugeln an einer Schnur hängen) und entdeckte die Stoßgesetze. Huygens untersuchte zwei Arten von Stößen: elastische Stöße (die Körper verformen sich dabei nicht; solche Zusammenstöße waren etwa beim damals populären Billardspiel zu beobachten) und inelastische oder plastische Stöße (bei denen sich die Körper verformen). Er erkannte, dass bei elastischen Stößen vor und nach dem Stoß das Produkt aus Masse und Quadrat der Geschwindigkeit (m·v²) unverändert blieb. Huygens hat sich später auch mit Kreisbewegungen beschäftigt, er prägte den Begriff Zentrifugalkraft für die Tendenz eines – z.B. durch eine Schnur gehaltenen – Körpers in einer Kreisbewegung, diesen Kreis zu verlassen (was z.B. geschieht, wenn die Schnur reißt. Huygens erkannte, dass die Zentrifugalkraft abhängig vom Kreisradius und dem Produkt m·v² war (1504). Die Vorarbeiten von Galilei und Huygens konnte Isaac Newton aufnehmen, als er die hier dargestellten Grundlagen der klassischen Mechanik beschrieb. Für unser Thema ist wichtig, dass er erkannte, dass Körper ihren Bewegungszustand beibehalten, wenn nicht eine "Kraft" auf sie einwirkt. Wirkt eine Kraft auf einen Körper ein, wird sein Bewegungszustand verändert, er wird etwa schneller ("beschleunigt") oder ändert seine Bewegungsrichtung. Der Begriff Kraft wurde von Newton als zeitliche Änderung des Impulses (des mechanischen Bewegungszustandes) eines Körpers definiert (1506); der Impuls war seinerseits durch Masse und Geschwindigkeit (in Bewegungsrichtung) festgelegt. Eine solche Kraft, war die von Newton entdeckte Schwerkraft: Körper zogen sich proportional zu ihrer Masse gegenseitig an (1508). Eine besondere Leistung war es, zu erkennen, dass auch die Bahn der Planeten auf einer Beschleunigung beruhte; Newton konnte durch die Anwendung seiner Bewegungsgesetze auch die Keplerschen Planetenbahnen erklären. Newtons Schwerkraft (= Gravitationskraft) wurde sofort von vielen Naturforschern akzeptiert, aber seine Bewegungsgesetze blieben lange wenig beachtet und umstritten.
Zu den Kritikern gehörte der deutsche Philosoph und Mathematiker Gottfried Leibniz (1550). Aus Newtons Bewegungsgesetzen folgte, dass der Impuls (m·v) ein Maß für die Kraft war. Leipniz hatte aber aus Galileos Fallversuchen theoretisch abgeleitet, dass bei einer Krafteinwirkung nicht der Impuls, sondern die Größe m·v² erhalten blieb (1552), wie auch Huygens schon bei seinen Stoßversuchen gefunden hatte. Leibniz führte dazu die Begriffe "vis viva" (lebendige Kraft) und "vis mortua" (tote Kraft) ein: In einem fallenden Körper wirkte die "vis viva", die dabei aufgenommene Energie wurde als "vis mortua", die nicht als Bewegung erkennbar war, gespeichert. Bei elastischen Stößen spielte dies keine Rolle, deshalb blieb (in Übereinstimmung mit Huygens Stoßgesetzen) die Größe m·v² erkennbar erhalten. Bei inelastischen Zusammenstößen (bei denen die Körper sich verformen) geht aber ein Teil der Bewegung verloren; die Kraft sollte nach Leibniz aber in den Teilkörpern, aus denen sich ein Körper zusammensetzt und die von dem Stoß dauerhaft erschüttert werden, (in diesem Fall, da die Teilkörper sich bewegten, als "vis viva") erhalten bleiben. In jedem Fall blieb die Summe aus "vis viva" und "vis mortua" immer gleich. Ein großer Anhänger dieser Theorie war der Schweizer Mathematiker Johann Bernoulli, der Beispiele dafür fand, dass "vis viva" gespeichert werden kann (etwa in einer gespannten Feder) und ebenfalls vermutete, dass "vis viva" und "vis mortua" ineinander umgewandelt werden könnten.
Dass die Beschäftigung mit mechanischen Kräften nicht ausreichte, um Maschinen zu bauen, die dem Menschen die Arbeit abnahmen, wurde deutlich, als mit der Nutzung der Dampfmaschinen die Erfüllung dieses Traumes näher rückte. Die Techniker und Ingenieure, die sich mit der Dampfmaschine beschäftigten, konnten mit dem Streit um die Erhaltung von Impuls oder "vis viva" und "vis mortua" wenig anfangen, sie hatten eine lebensnähere Messgröße: Arbeit. Mit Hilfe der geleisteten Arbeit konnte man verschiedene Maschinen vergleichen, etwa eine Dampfmaschine mit einem Wasserrad. Arbeit konnte man praxisnah als Produkt aus Kraft und Weg berechnen: Wenn man 20 kg einen Meter hoch hebt, ist dass doppelt so viel Arbeit, als wenn man 10 kg einen Meter hoch hebt (das Anheben von Lasten war eine zentrale Frage, denn die ersten Dampfmaschinen wurden ja zum Abpumpen von Wasser aus Kohleminen verwendet). Ein verwandter Begriff ist Leistung, definiert als Arbeit pro Zeit: werden die 20 kg in der halben Zeit einen Meter hoch gehoben, ist die Leistung doppelt so groß (1512). Dieser Ansatz trug Früchte: so wurde erkannt, dass ein oberschlächtiges Wasserrad (dem das Wasser von oben zugeführt wird) etwa doppelt soviel Arbeit bei gegebener Wassermenge leisten konnte wie ein unterschlächtiges Wasserrad. Es gab aber noch ein Problem: Mit der Dampfmaschine wurde Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt. Wärme war offenbar keine Kraft, konnte aber in eine solche umgewandelt werden und dann mechanische Arbeit verrichten. Damit kam das Konzept des Aristoteles wieder zu Ehren: in der Wärme steckte offenbar auch die Möglichkeit, eine Arbeit zu verrichten; damit sie zu einer Kraft wurde, musste sie aber erst umgewandelt werden.
Für die Naturforscher war Wärme ein Thema geworden, seit im 17. Jahrhundert das Thermometer entwickelt worden war und Temperaturen gemessen werden konnten. Einer der ersten Naturforscher, die sich mit der Wärme beschäftigten, war der Schotte Joseph Black (der Entdecker des Kohlendioxids). Black entdeckte, dass Eis beim Schmelzen Wärme aufnimmt, ohne seine Temperatur zu verändern. Damit hat er als erster einen Unterschied zwischen Wärme und Temperatur gemacht, und prägte den Begriff der latenten Wärme, die irgendwie im Eis gespeichert wurde, aber nicht zu einer messbaren Temperaturänderung führte. Black hielt aber in der Tradition von Aristoteles die Wärme für einen Stoff, wie auch der französische Chemiker Antoine Lavoisier (einem der Väter der modernen Chemie), der Wärme für eine unsichtbare Substanz hielt, die sich zwischen den Molekülen anderer Substanzen aufhielt. Der englische Erfinder Graf Rumford, der Ende des 18. Jahrhunderts bemerkt hatte, dass sich Kanonenrohre erwärmen, wenn sie aufgebohrt werden, und dass die entstehende Wärme ungefähr der beim Bohren verrichteten Arbeit entsprach, schloss aber, dass dieses Ergebnis nicht mit dem "Ausfließen" eines im Kanonenrohr vorhandenen Wärmestoffes zu erklären sei, sondern dass Wärme durch mechanische Arbeit entstehen kann. Er vermutete, dass Wärme eine Form von Bewegung sei. Was aber könnte sich da bewegen? Die Antwort schälte sich bei der Beschäftigung mit Gasen heraus, die mit der Frage nach dem Gewicht der Luft begonnen hatte. Robert Boyle und Edme Mariotte entdeckten unabhängig voneinander, dass der Druck eines Gases bei gleichbleibender Temperatur ("isotherme Zustandsänderung") und gleichbleibender Stoffmenge umgekehrt proportional seinem Volumen ist (Druck p ~ 1/V; Boyle-Mariottesches Gasgesetz); Joseph Louis Gay-Lussac, dass bei gleichbleibendem Druck das Volumen eines Gases proportional der Temperatur ist (Gay-Lussacsches Gasgesetz). Die Versuche zur Erklärung dieser Gesetze, die in Versuchen gefunden worden waren, führte zur Entstehung der kinetischen Gastheorie: Stoffe (Gase) wurden als Ansammlung atomarer Kügelchen verstanden, auf die man die Prinzipien der Newtonschen Mechanik anwenden konnte. Da man hierbei aufgrund der großen Zahl und ihrer kleinen Größe nicht die einzelnen Teilchen untersuchen konnte, musste eine statistische Herangehensweise erfolgen. So entstand die statistische Mechanik, mit deren Hilfe man aus den Bewegungen der Gasteilchen die messbaren Eigenschaften von Gasen wie Druck, Volumen und Temperatur ableiten konnte. Analog wurde auch bei festen Stoffen die Temperatur auf mikroskopische Bewegungen der Teilchen zurückgeführt.
Die Dampfmaschine machte die Frage des Zusammenhangs zwischen Wärme und Bewegung dann wirtschaftlich relevant. Die Firma Boulton & Watt verkaufte ihre Dampfmaschinen zunächst nicht, sondern verleaste sie; als Nutzungsentgelt verlangte sie ein Drittel der gegenüber dem Vorläufer, der Newcomen-Dampfmaschine, eingesparten Brennstoffkosten. Damit wurde es interessant, die Vorgänge in den Maschinen zu erforschen, wie James Watt selbst es mit der Untersuchung der Temperatur-, Druck- und Volumenverhältnisse in seinen Dampfmaschinen begann.
Grundlegend theoretisch durchdrungen wurde die Dampfmaschine aber erst 1824 von dem französischen Physiker Sadi Carnot, der damit die Wärmelehre (Thermodynamik) begründete. Carnot konnte dabei auf die Gasgesetze zurückgreifen; er erklärt die Vorgänge in den Dampfmaschinen auch für alle anderen Arten von Wärmekraftmaschinen allgemeingültig, indem er die Vorgänge in der Dampfmaschine gedanklich als reversiblen Kreisprozess (also einen Vorgang, bei dem am Ende der ursprüngliche Zustand wieder hergestellt wird) mit vier Einzelschritten zerlegte:
- Isotherme Expansion: Wird das Dampfventil geöffnet und strömt Dampf in den Zylinder, wird Wärme vom heißen Temperaturreservoir (dem Dampfbehälter) entnommen.
- Adiabatische Expansion: Wird das Dampfventil
geschlossen, expandiert der Dampf und kühlt dabei ab; durch die
Expansion wird mechanische Arbeit verrichtet.
- Isotherme Kompression: Durch das eingespritzte Wasser geht Wärme vom Dampf in das Wasser über, das Volumen des Dampfes verringert sich wieder.
- Adiabatische Kompression: Durch den Luftdruck auf den Kolben wird das Gas verdichtet, dabei wird mechanische Arbeit verrichtet.
Carnot erkannte, dass die mechanische Arbeit, die von der Dampfmaschine erzeugt wird, letztlich auf das Bestreben der Wärme, von einem heißen zu einem kalten Reservoir zu fließen, zurückgeht. Carnot fand auch heraus, dass der Anteil an Wärme, der in mechanische Arbeit umgewandelt werden kann (die Effizienz e) von den Temperaturen der beiden Reservoirs abhängt: je größer die Differenz, desto mehr mechanische Arbeit kann gewonnen werden. Der theoretisch höchstmögliche Wirkungsgrad e beträgt e = 1 - (Temperatur kaltes Reservoir / Temperatur heißes Reservoir). Da zudem das kalte Reservoir nicht kälter als die Umgebungstemperatur sein konnte, kann Wärme niemals vollständig in mechanische Arbeit umgewandelt werden.
1834 wurde Carnots Entdeckung von dem französischen Physiker Benoît Clapeyron in einem Diagramm grafisch dargestellt, das noch heute die Grundlage thermodynamischer Untersuchungen ist.
Das von Benoît Clapeyron entwickelte
Diagramm des Carnot-Zyklus (>>
hier)
war ein wichtiger Schritt zum Verständnis thermodynamischer Prozesse
(siehe
Text). Lesebeispiel: Bei der isothermen Expansion in einer
Dampfmaschine
(von 3 nach 4) nimmt Dampf Wärme aus der Kohlefeuerung auf und
vergrößert
sein Volumen V, dabei nimmt der Druck p ab. Abbildung verändert
aus wikipedia,
>> Carnot-Prozess,
abgerufen 2.8.2011, Lizenz: >> c.c.
3.0
(Da jeder Einzelschritt in diesem “Carnot-Prozess” umkehrbar ist, kann eine umgekehrt arbeitende Wärmekraftmaschine unter Aufnahme mechanischer Arbeit Wärme aus dem kalten Medium aufnehmen und an das warme Medium abgeben – auf diesem Prinzip der Wärmepumpe beruht auch die Funktionsweise von Kühlschränken.)
Unterdessen hatte sich der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler mit Newtons Mechanik beschäftigt. Er hat die Eigenschaften von krummlinigen Bewegungen untersucht, Newtons Mechanik mit der Anwendung auf Drehbewegungen erweitert und Newtons "Kraft" mathematisch als F = m·a formuliert. 1738 veröffentlichte der mit Euler befreundete Schweizer Mathematiker Daniel Bernoulli (ein Sohn des oben erwähnten Johann Bernoulli) sein Hauptwerk "Hydrodynamica", dass sich mit der Strömung von Fluiden (Flüssigkeiten und Gasen) beschäftigte. Darin formulierte Bernoulli unter anderem das Prinzip, dass der Druck, der von einer Flüssigkeit ausgeübt wird, umgekehrt proportional ihrer Strömungsgeschwindigkeit ist. Damit zeigte sich für Bernoulli der Erhalt der "vis viva", die sich entweder als Strömung (aktuelle Bewegung) oder Druck (potenzielle Bewegung) zeigen konnte. In diesem Werk berechnete Bernoulli auch die Arbeit, die von einem Gas ausgeübt werden konnte; die Bedeutung wurde aber nicht erkannt (und erst 1792 von dem britischen Ingenieur Davies Gilbert wiederentdeckt). Die Mathematiker und Physiker interessierten sich um diese Zeit eher für die genaue Berechnung der Planetenbahnen; sie blieb aber trotzt Newtons Gravitationsgesetz schwierig, da die mathematischen Methoden hierfür fehlten. Das "Zweikörperproblem" (die Berechnung der Bewegung zweier Körper umeinander) lösten um 1800 unabhängig voneinander der deutsche Mathematiker Carl Friedrich Gauß und der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace auf ganz verschiedenen Wegen; problematisch blieb aber die Einbeziehung von Bahnstörungen, etwa durch dritte Körper (wie andere Himmelskörper). Hierzu wurde, insbesondere von Euler und aufbauend hierauf dem italienischen Mathematiker Joseph-Louis Lagrange die Variationsrechnung erfunden. Mit dieser und dem "Prinzip der kleinsten Wirkung" lassen sich die Bewegungen auch in Mehrkörpersystemen berechnen. Entscheidend für die Entdeckung des Energiebegriffs sollte der Weg zum "Prinzip der kleinsten Wirkung" sein. Johann Bernoulli hatte schon 1717 den Begriff der "virtuellen Arbeit" eingeführt: nicht jeder Körper wird von einer Kraft in Bewegung gesetzt. So wirkt die Schwerkraft auch auf einen Körper ein, der auf einem Tisch liegt; er kann aber durch den Tisch nicht nach unten fallen. Es gibt also bei solchen "Zwangsbedingungen" (die die Bewegung des Körpers einschränken) eine der (in diesem Fall) Schwerkraft entgegengesetzte "Zwangskraft", und die leistet eine "virtuelle Arbeit" (da der Körper sich ja nicht bewegt). In einem Brief an den französischen Wissenschaftler Pierre de Varignon, in dem Bernoulli dieses erläuterte, benutzte er erstmals den Begriff "Energie": die Summe der positiven Energien sei bei der virtuellen Arbeit gleich der Summe der negativen Energien. (1743 gelang es dem französischen Mathematiker D'Alembert, zu berechnen, wie sich viele Körper verhalten, die sich nicht nur gegenseitig beeinflussen, sondern auch durch Zwangskräfte auf bestimmten Bahnen gehalten werden. Das Prinzip der kleinsten Wirkung – die Natur erreicht ihr Ziel immer mit dem geringsten Aufwand – wurde 1744 von dem französischen Naturforscher Pierre Maupertuis erstmals formuliert und war mit Bernoullis virtueller Arbeit und D'Alemberts Prinzip Ausgangspunkt für Joseph-Louis Lagranges 1788 erschienene "Analytische Mechanik", in der das Verhalten von Systemen durch die Lagrange-Funktion beschrieben wird (zudem ist der Formalismus im Gegensatz zu Newtons System auch in beschleunigten Bezugssystemen gültig). In der Lagrange-Funktion sind Impuls und Kraft, vektorielle (also richtungsgebundene) Größen, durch richtungsunabhängige Größen wie Arbeit und Energie ersetzt – wobei Bernoullis Begriff Energie nicht aufgegriffen worden war und daher auch von Lagrange nicht benutzt wurde.
Aber um 1800 war die Zeit reif dafür. 1802 führte der englische Augenarzt und Physiker Thomas Young das Doppelspaltexperiment durch, das zeigte, dass Licht – wie bereits Mitte des 17. Jahrhundert von Christiaan Huygens vermutet – sich wie eine Welle verhielt. Young vermutete, dass auch Wärme Wellencharakter habe, Licht und Wärme im Grunde also das gleiche waren, der Unterschied läge nur in Wellenlänge, die bei Wärme größer war (er wusste nicht, dass Wilhelm Herrschel bereits 1800 Sonnenstrahlung durch ein Prisma gelenkt und gefunden hatte, dass die Strahlung jenseits des roten Endes des Spektrums – die Infrarot- oder Wärmestrahlung – ein Thermometer stark erwärmt hatte). Der englische Chemiker Humphry Davy (wie Young ein Schüler Graf Rumfords) zeigte, dass die Stromerzeugung in der Voltasäule (Alessandro Voltas 1800 vorgestellter Vorläufer der Batterie) auf einer chemischen Reaktion beruhte. Licht und Wärme, Strom und Chemie (sowie, wie 1752 Benjamin Franklin bei der Untersuchung von Blitzen gezeigt hatte, Strom, Licht und Wärme) schienen also alle irgendwie zusammenzuhängen; und alle hatten etwa mit Bernoullis "vis viva" und "vis mortua" zu tun: 1807 schlug Young in seinem Hauptwerk, dem zweibändigen "A Course of Lectures in Natural Philosophy and the Mechanical Arts" vor, für die "vis viva" den griechischen Begriff energeia, Energie, zu verwenden. Diesmal wurde er schnell aufgegriffen, zuerst von Davy, der bereits 1806 von der offensichtlichen Beziehung zwischen elektrischer Energie und chemischer Affinität (Reaktionsbereitschaft) sprach. Young verwendete den Begriff aber nur für mechanische Energie, also Bewegungsenergie (kinetische Energie, was die Rotationsenergie einschließt) und Lageenergie (potenzielle Energie), die in der Lagrange-Funktion als T (kinetische Energie) und V (potenzielle Energie) auftauchen. Diese Begriffe wurden aber erst 1852 von William Thomson eingeführt (siehe unten), wir haben hier also noch nicht ganz den heutigen Energiebegriff.
Der nächste große Erkenntnissprung betraf ein wesentliches fehlendes Element: die Wärme. 1840 ließ sich der deutsche Mediziner Julius Robert Mayer als Schiffsarzt auf dem holländischen Dreimaster Java nach Batavia (dem heutigen Jakarta) anheuern. Dort fiel im auf, dass das venöse Blut seiner Patienten dort heller war als im heimischen Deutschland. Er schloss, dass es weniger oxidiert sei, da der Körper bei tropischen Temperaturen weniger Wärme produzieren muss. Nach seiner Rückkehr und Niederlassung als Oberwundarzt in Heilbronn beschäftigte ihn die Frage, ob nicht auch die Wärme, die bei Muskelarbeit entsteht, auf die Oxidation von Blut zurückgeht, und vermutete, dass Bewegungsenergie in Wärme umgewandelt werden könne – Wärme also demnach kein Stoff, sondern eine Form von Energie war. Dieser Vermutung nachgehend, zeigte er, dass Wasser durch Schütteln erwärmt werden konnte und veröffentlichte 1842 einen ersten Wert zur Umrechnung von Bewegungs- in Wärmeenergie. 1845 beschrieb er in seinem Büchlein “Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel” zudem Muskeln als etwas Ähnliches wie Wärmekraftmaschinen, die Energie aus der Nahrung in Bewegung umwandelten.
Unabhängig von Mayer führte der britische Physiker James Prescott Joule zur gleichen Zeit thermodynamische Untersuchungen durch. Joule war hierzu durch die Entdeckung angeregt wurden, dass sich elektrische Leiter bei Stromdurchfluss erwärmten; und auch er entdeckte, dass Wasser durch mechanische Bewegung erwärmt werden konnte. Seine Entdeckungen und genaue Messungen hierzu veröffentlichte er 1850 und verwendete erstmals die Begriffe elektrisches und mechanisches Wärmeäquivalent. Ihm zu Ehren ist die SI-Einheit für Energie heute als Joule benannt. Dass “seine” Entdeckung dem weitaus bekannteren Joule zugeschrieben wurden, trieb Mayer, der sich nicht wissenschaftlich ausdrücken konnte und von den zeitgenössischen Physikern zunächst nicht als ernstzunehmend angesehen wurde, in die Verzweiflung. Aber heute ist anerkannt, dass seine Arbeiten die Formulierung des Energieerhaltungssatzes durch den deutschen Physiologen und Physiker Hermann von Helmholtz vorwegnahmen; Helmholtz verfasste 1846 eine Arbeit “Ueber den Stoffwechselverbrauch bei Muskelaktionen” und veröffentlichte 1847 das Buch “Über die Erhaltung der Kraft”. Helmholtz, der Titel zeigt es, verwendete noch den Begriff Kraft, nutzen diesen aber auch, wie der Kontext zeigt, für das, was heute Energie heißt, daher gilt er als Energieerhaltungssatz (Energie kann in einem abgeschlossenen System weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur umgewandelt werden) heute als erster Hauptsatz der Thermodynamik. Den Begriff Energie in seiner heutigen Fassung, im Unterschied zu Young die Wärme einschließend, formulierte wenige Jahre später der britische Physiker William Thomson (der spätere Lord Kelvin) auf der Basis von Clausius' Erkenntnissen (siehe folgender Abschnitt)
Vom Energieerhaltungssatz zur Entropie
Die nächste entscheidende Weiterentwicklung leistete der deutsche Physiker Rudolf Clausius. Zwischen dem damaligen Verständnis des Carnot-Prozesses und dem Energieerhaltungssatz bestand ein Widerspruch, auf den der William Thomson als erster hingewiesen hatte: Wie konnte die Wärme erhalten bleiben und gleichzeitig mechanische Arbeit geleistet werden? 1850 veröffentlichte Clausius sein Buch “Ueber die bewegende Kraft der Wärme und die Gesetze, welche sich daraus fuer die Wärmelehre selbst ableiten lassen”, darin formulierte er – die Erkenntnisse Carnots mit seinen eigenen verbindend – den Energieerhaltungssatz neu, indem er eine innere Energie U eines Systems einführte, Wärme als Energieform behandelte und die Beziehung zwischen innerer Energie U eines Systems und Wärmemenge Q und Arbeit W wie folgt formulierte: ΔU = ΔQ + ΔW (Δ steht für Differenz, die innere Energie eines Systems ändert sich also mit zu- oder abgeführter Wärme und zugeführter oder geleisteter Arbeit). Clausius erkannte auch, dass im Carnot-Prozess nicht wie von Carnot angenommen die zu- und die abgeführte Wärme gleich waren, sondern nur der Teil der Wärme, der nicht in mechanische Arbeit umgewandelt wurde, auf das kalte Energiereservoir übertragen wird. Damit erwies sich der Energieerhaltungssatz als richtig. Dass Wärme aber nur eine Form von Energie war, erklärte eine andere Beobachtung nicht, die auch Carnot schon gemacht hatte: Wärme kann spontan nur von einem heißen zu einem kalten Körper fließen, sie fließt niemals von alleine von einem kalten zu einem heißen Körper – Eis schmilzt in einem warmen Raum, da Wärme aus dem Raum ins Eis fließt; niemals entsteht in einem warmen Raum aber spontan Eis aus Wasser. Aus dieser Beobachtung heraus formulierte Clausius 1850 den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik: Es gibt keine Zustandsänderung, deren einziges Ergebnis die Übertragung von Wärme von einem Körper niederer auf einen Körper höherer Temperatur ist. Diesen Gedanken griff William Thomson sofort auf, und entwickelt ihn weiter. Er wusste, dass der Carnot-Prozess ein idealer, reversibler Prozess war, aber in der Realität Wärme durch Wärmeleitung oder auch Reibung verloren ging, was aufgrund des zweiten Hauptsatzes irreversibel war. In der Realität wurde daher weniger von Dampfmaschinen weniger als die maximal mögliche Arbeit geleistet; dies verstieß aber nicht gegen die Energieerhaltung, da diese Energie als Wärme "verstreut" wurde. 1852 erklärte er, dass es in der realen Welt eine Tendenz zur Verstreuung ("Dissipation") von mechanischer Energie gäbe, und eine Wiederherstellung dieser mechanischen Energie (die Umwandlung der Wärme in mechanische Energie) nur unter Energieverlust möglich sei. (Weiter folgerte er: in endlicher Zeit muss daher die Erde für menschliches Leben ungeeignet sein.) In diesen Arbeiten griff Thomson auch Clausius' modernen Energiebegriff auf, der auch von Helmholtz sofort akzeptiert wurde und sich in der Physik durchsetzen sollte.
Was
ist Energie?
Eine etwas vereinfachende Definition ist: Energie ist die Fähigkeit
eines Systems, eine Arbeit zu verrichten. Sie wird durch Kräfte (die
im Unterschied zur Energie gerichtete Größen sind, also in eine
bestimmte Richtung wirken) übertragen. Damit die Definition stimmt,
muss aber Arbeit etwas anders als in der klassischen Mechanik
definiert werden, damit auch die Wärmezufuhr von dem Begriff erfasst
wird. Arbeit wird hierfür einfach als durch Kräfte übertragene
Energie definiert (1520),
und Energie bedeutet im Grunde nichts anderes, als die
Fähigkeit eines Systems, eine Veränderung auszulösen.
Der ursprünglich rein empirische (also durch
Versuche und Messungen abgeleitete) Energieerhaltungssatz wurde 1918
von der Mathematikerin Emmy Noether bewiesen, die
damals über die mathematischen Eigenschaften der physikalischen
Gesetze nachdachte (1530).
Sie erkannte, dass die Symmetrien in den Gleichungen eng mit
sogenannte Erhaltungsgrößen zusammenhängen (Größen, die erhalten
bleiben, wie für die Energie im Energieerhaltungssatz formuliert).
Als Symmetrie bezeichnen Physiker die Eigenschaft eines Systems,
nach Veränderungen unverändert zu sein. Der Buchstabe "A" ist
beispielsweise spiegelsymmetrisch: nach einer Spiegelung sieht er
aus wie vorher. Eine andere mögliche Symmetrie ist die Zeitsymmetrie
(genauer: Zeittranslationssymmetrie, Translation steht für
Linearbewegung aller Teile eines Systems): das Ergebnis einer
physikalischen Messung hängt nicht von der Uhrzeit ab. Emmy Noether
fand nun 1918 eine Formel (das Noether-Theorem),
das Symmetrie und Erhaltungsgröße verknüpft, und zeigt, dass Energie
die Erhaltungsgröße ist, die aus der
Zeitsymmetrie folgt.
Energie kann in verschiedenen Formen vorkommen: Wir haben oben
bereits die mechanische Energie kennengelernt, die
wiederum als kinetische Energie (Bewegungsenergie) und potenzielle
Energie (Lageenergie) vorkommt (nach der allgemeinen Definition für
Energie also die Fähigkeit eines Körpers ist, aufgrund seiner
Bewegung oder seiner Lage eine Veränderung auszulösen [z.B. ein
anderes System zu verformen]), die thermische Energie
(Wärme), die Lichtenergie und die chemische
Energie aus der Nahrung kennengelernt; es gibt aber noch
viele weitere Energieformen, praktisch bedeutsam sind etwa die
elektrische Energie (Strom) oder die Kernenergie,
die bei der Kernspaltung oder Kernfusion (etwa in der Sonne)
freigesetzt wird. Die einzelnen Energieformen können mitunter weiter
unterteilt werden, z.B. die Bewegungsenergie in Translationsenergie
(Bewegung des Schwerpunktes) und Rotationsenergie (Drehung um den
Schwerpunkt).
Als Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhundert entdeckte,
dass Masse und Energie nach der Formel E=mc² ineinander umgewandelt
werden können, musste auch Masse als Energieform betrachtet werden.
Die gespeicherte Energie einer Masse wird Äquivalenzmasse
genannt. Jede Energieumwandlung aus Materie muss also mit einem
Masseverlust einhergehen, etwa die Verbrennung von Kohle. Aufgrund
des hohen Wertes von c² ist dieser aber viel zu klein, um in der
Praxis messbar zu sein und eine Rolle zu spielen. Relevant wurde
diese Entdeckung aber mit der Entdeckung der Kernspaltung, mit der
die Umwandlung von Materie in Energie zu einer Energiequelle wurde (Eine
kleine Geschichte der Atomkraft).
Schon Carnot hatte ja festgestellt, dass nicht die gesamte Wärmemenge in nutzbare Arbeit umgewandelt werden, sondern dass der maximal umwandelbare Anteil von der Temperaturdifferenz zwischen den beiden Temperaturreservoirs abhing. Clausius erkannte, dass im Carnot-Prozess das Verhältnis von übertragener Wärme zu absoluter Temperatur bei beiden Temperaturreservoiren gleich war: ΔQ heißes Reservoir / T heißes Reservoir = ΔQ kaltes Reservoir / T kaltes Reservoir. Wenn dieses Verhältnis aber konstant ist, kann es auch als eigene Größe beschrieben werden: ΔS = ΔQ/T. 1865 prägte Clausius für S den Begriff Entropie. Die Entropie ist wie Druck oder Temperatur eine Zustandsgröße, mit der ein System beschrieben werden kann. Bei Wärmezufuhr nimmt die Entropie eines Systems zu, bei Wärmeabfuhr ab. Da im Carnot-Prozess mehr Wärme zu- als abgeführt wird, netto also Wärme zugeführt wird, nimmt bei der Umwandlung von Wärmeenergie in mechanische Arbeit die Entropie zu. Praktisch äußert sich dies dadurch, dass unvermeidlich ein Teil der Wärme ungenutzt (als “Abwärme”) verloren geht; eine Dissipation von Energie findet also nicht nur wie von Thomson erkannt in der realen Welt durch Wärmeleitung und Reibung, sondern selbst bei einem idealen Prozess wie dem Carnot-Prozess zwangsläufig statt. Die neue Größe Entropie kann also, anders als Energie, erzeugt werden. Da ohne Zufuhr von Energie Wärme nicht in andere Energieformen umgewandelt werden kann, kann Entropie aber nicht vernichtet werden. Damit kann der zweite Hauptsatz der Thermodynamik auch so formuliert werden, dass in einem abgeschlossenen System (also einem System ohne Energieaustausch mit seiner Umwelt) Vorgänge unmöglich sind, bei denen die Entropie abnimmt. Der zweite Hauptsatz schränkt somit den ersten Hauptsatz der Thermodynamik insofern ein, als nicht alle Energieumwandlungen, die nach dem ersten Hauptsatz möglich sind, auch tatsächlich von alleine stattfinden können.
Was ist
Entropie?
Clausius konnte den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zwar
mathematisch formulieren, aber nicht erklären, was diese eigentlich
war. Dies gelang erst dem österreichischen Physiker Ludwig
Boltzmann. Boltzmann war ein Anhänger der von Dalton
(wieder) eingeführten Atomtheorie
und gemeinsam mit Clausius und James Clerk Maxwell ein Begründer der
kinetischen Gastheorie, die die Eigenschaften von Gasen durch die
Bewegung ihrer Teilchen erklärte. Demnach sind die Teilchen (Atome
oder Moleküle) eines Gases in ständiger, ungeordneter Bewegung, und
so entsteht etwa der Druck eines Gases durch Zusammenstöße seiner
Teilchen mit der Gefäßwand, oder die Temperatur durch die mittlere
Bewegungsenergie der Teilchen. Diese Erklärungen waren alles
Anwendungen statistischer Konzepte auf Teilchen, und so sollte
Boltzmann auch die Entropie erklären. Ein makroskopischer Zustand
(etwa der rundherum gleiche Druck eines mit Gas gefüllten Behälters)
kann durch sehr viele verschiedene mikroskopische Zustände
hervorgerufen werden – so sagt der gleiche Druck nur, dass die
Gasteilchen im Mittel gleich über das gesamte Volumen des Behälters
verteilt sind, aber nichts über die jeweiligen individuellen
Aufenthaltsorte, Flugrichtungen und Geschwindigkeiten der einzelnen
Teilchen.
Die Entropie war für Boltzmann ein Maß für die Zahl der
möglichen mikroskopischen Zustände, in denen sich ein
makroskopisch beschriebenes System theoretisch befinden könnte.
Niedrige Entropie bedeutet also, dass es nur wenige mikroskopische
Zustände gibt, die den makroskopisch erkennbaren Zustand bilden
können; hohe Entropie bedeutet, dass es sehr viele verschiedene
mikroskopische Zustände gibt, die dies können. Da es viel mehr
Zustände mit hoher Entropie als solche mit niedriger Entropie gibt,
ist es bei Änderungen des Zustandes sehr viel wahrscheinlicher, dass
ein Zustand mit hoher Entropie als einer mit niedriger Entropie
entsteht; wahrscheinlich ist also eine Zunahme der Entropie. Der
gegenteilige Fall ist physikalisch nicht ausgeschlossen, aber so
selten, dass er noch nie beobachtet wurde. Diese Definition ließ
sich auch auf energetische Systeme übertragen; so ist es
wahrscheinlicher, dass Wärme von einem heißen zu einem kalten Körper
fließt, da die sich in dem heißen Körper heftig schwingenden
Teilchen mit größerer Wahrscheinlichkeit die "ruhigeren" Teilchen
des kalten Körpers anstoßen als umgekehrt. Etwas vereinfacht kann
man die Entropie damit als Maß für innere
Stabilität eines Systems verstehen (1590),
Systeme mit hoher Entropie sind stabiler als solche mit niedriger
Entropie.
Mitunter wird Entropie anschaulich auch als Maß für die "Unordnung" eines Systems bezeichnet. Die Bezeichnung ist aber nicht immer zutreffend: Gelegentlich sind geordnete Systeme mit einer Struktur stabiler als ungeordnete Systeme, dann führt die Tendenz zur Zunahme der Entropie zur Entstehung von Strukturen. Das ist dann der Fall, wenn hierbei die freie Energie minimiert wird. Dieser Begriff stammt aus der Anwendung der Hauptsätze der Thermodynamik auf chemische Reaktionen, vor durch den amerikanischen Physiker Josiah Willard Gibbs zwischen 1876 und 1878. Chemische Reaktion laufen dann von alleine ab, wenn bei ihnen Energie frei wird. Klassisch ist eine Verbrennung: bei ihr wird Wärme frei. Solche Reaktionen heißen exotherme Reaktionen. Es gibt aber auch endotherme Reaktionen, bei denen von den Reaktionspartnern Wärme aus der Umgebung aufgenommen wird, die ebenfalls von alleine ablaufen. Den Wärmeinhalt eines Systems nennen Chemiker Enthalpie, von altgriechisch en ‚in‘ und thálpein ‚erwärmen; die Änderung bei einer chemischen Reaktion Reaktionsenthalpie (ΔH). Eine negative Reaktionsenthalpie heißt, es wird Wärme abgegeben (die Reaktion ist also exotherm), bei einer positiven Reaktionsenthalpie wird Wärme aufgenommen (die Reaktion ist endotherm). Da auch bei chemischen Reaktionen der 1. Hauptsatz der Thermodynamik gilt, entspricht die Reaktionsenthalpie der Änderung der inneren Energie des Systems (1592). Weiter muss der 2. Hauptsatz der Thermodynamik beachtet werden, nach dem die Entropie zunehmen muss (ΔS > 0). In einem geschlossenen System, das sich im Energieaustausch mit seiner Umgebung befindet, in die Wärme abgenommen oder aus der sie aufgenommen wird, heißt dieses: ΔS (System) + ΔS (Umgebung) > 0. Wie wir oben gesehen haben, ist ΔS = ΔQ/T, ΔQ (Umgebung) entspricht aber der aufgrund der Reaktionsenthalpie abgegebenen Wärme des Systems (-ΔH), also ist ΔS (Umgebung) = -ΔH (System)/T, und das heißt ΔS (System) - ΔH (System)/T > 0. Damit können wir jetzt den Zusatz (System) weglassen, es gilt ΔS - ΔH/T > 0 bzw. ΔH - T·ΔS < 0. Diese Größe, ΔH - T·ΔS, heißt nach Josiah Willard Gibbs Gibbs-Energie (Symbol ΔG) und wird auch freie Energie oder freie Enthalpie genannt. Wie wir oben gesehen haben, können alle Reaktionen mit ΔG < 0 nach dem 2. Hauptsatz der Thermodynamik spontan ablaufen, auch wenn sie dabei Wärme aus der Umgebung aufnehmen. Entscheidend ist, dass hierfür die Entropieänderung (T·ΔS) größer sein muss als die aufgenommene Wärmemenge ΔH. (Wir sehen an der Formel ΔG = ΔH - T·ΔS auch, dass die freie Energie von der Temperatur T abhängt; man kann mit der Formel daher auch berechnen, ab welcher Temperatur diese Reaktion spontan abläuft.)
Die Zunahme von freier Energie spielt nicht nur bei chemischen Reaktionen, sondern auch bei physikalischen Vorgängen eine Rolle: So bilden etwa in Wasser gelöste Fettsäuren spontan Bläschen aus Doppelmembranen. Auch hierbei führt eine Zunahme der Entropie zu einer freien Energie kleiner als 0. Die generelle Tendenz zur Zunahme der Entropie spricht also nicht grundsätzlich dagegen, dass sich geschlossenen Systemen aufgrund der Tendenz zur Minimierung der freien Energie geordnete Strukturen bilden, sobald eine Energiequelle zur Verfügung steht; diese Fähigkeit zur Selbstorganisation dürfte bei der Entstehung des Lebens eine Rolle gespielt haben. Die im 2. Hauptsatz dargestellte Zunahme der Entropie kann jedenfalls lokal durchaus auch die Bildung geordneter Strukturen antreiben, wie unter anderem die Entstehung von Strukturen im Universum (einschließlich der Sonne und der Erde) beweisen.