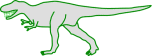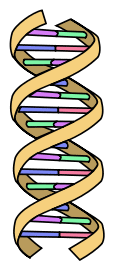Das Leben
Immer
noch ein Rätsel:
Die Entstehung des Lebens
Wir wissen noch nicht, wie und wann das Leben
auf der Erde entstanden ist; und vielleicht werden wir es auch
niemals herausfinden: Die Entstehung des Lebens war ein historischer
Vorgang. Wir können aber untersuchen, wie es entstanden sein könnte
und die Mechanismen verstehen, die dazu führen, dass aus
anorganischer Materie Leben entsteht. Dazu gibt es plausible
Erklärungsansätze. Und eines ist sicher: Seit irgendwann vor 4,4 bis
3,3 Milliarden Jahren gab es Leben auf der Erde...

”Weißer Raucher”: Solche
alkalinen
Tiefseequellen gelten als ein möglicher Entstehungsort des Lebens,
da mögliche Zellvorläufer hier relativ geschützt waren vor den
unwirtlichen Bedingungen der Erdfrühzeit und reichlich chemische
Energie zur Verfügung stand. Foto: US-National Oceanic and
Atmospheric Administration, Ocean Explorer Website >>
hier, public domain.
Irgendwann vor etwa 4 Milliarden Jahren ...
Die Erde vor 4 Milliarden Jahren war ein
Planet, den wir kaum erkannt hätten: Ein Tag dauerte weniger als
sechs Stunden; wenn es hell war, schien eine rötliche Sonne schwach
durch einen dunstigen, rötlichen Himmel; nachts wäre der riesige
Mond kaum und von den Sternen nichts zu sehen gewesen. Aus einem
riesigen Ozean ragten nur erste Proto-Kontinente, die von
gewaltigen Gezeitenwellen umtost waren. Auf dieser Erde, irgendwann
vor 4,4 bis 3,3 Milliarden Jahren, begann das Leben. Wie genau das
Leben entstanden ist, oder ob es gar aus dem Weltall auf die Erde
kam, wissen wir noch nicht. Die Suche nach dem Ursprung des Lebens
gleiche dem Versuch, die Geschichte der Menschheit nur aus ein paar
Faustkeilen und den Ruinen des Industriezeitalters zu
rekonstruieren, schrieb der Spiegel einmal. Da ist etwas dran: Die
ersten Lebewesen haben nicht bis heute überdauert – sie wurden
vermutlich von ihren Nachfolgern gefressen. Die Wissenschaftler, die
die Ursprünge des Lebens untersuchen, sind also auf Indizien
angewiesen. 1996 berichtete der amerikanische Geologe Stephen
Mojzsis in der Fachzeitschrift Nature von geochemischen
Lebensspuren in den 3,8 Milliarden Jahre alten
Isua-Gneisen auf Grönland: einen hohen Anteil des Kohlenstoff-Isotops
12C (0105); 2015 wurden
ähnliche Anzeichen in 4,1 Milliarden Jahre alten
Zirkon-Kristallen aus Westaustralien gefunden (0110).
Diese Anzeichen sind ein hohes 12C/13C-Verhältnis in dem
Kohlenstoff, der in den Zirkon-Kristallen eingeschlossen ist. Das
leichte Kohlenstoff-Isotop 12C wird bei der
Fotosynthese etwas stärker als das schwerere Isotop 13C in
organische Moleküle eingebaut. Es findet sich daher mit erhöhtem
Anteil in Algen und Pflanzen, und in der Folge auch in allen
Pflanzenfressern und gilt normalerweise als Beleg für organische
Entstehung. Demnach hätte es also schon vor 3,8 Milliarden Jahren
nicht nur Leben, sondern auch schon eine Form der Fotosynthese geben
müssen. Aber biologische Prozesse sind nicht die einzig mögliche
Ursache für ein hohes 12C/13C-Verhältnis (0110),
und die Funde sind daher ein Hinweis, aber kein Beweis
für Leben zu dieser Zeit. Umstritten sind auch 3,5
Milliarden Jahre alte fossile Cyanobakterien, die der
amerikanische Geologe James William (Bill) Schopf 1993 in den
westaustralischen Apex Cherts gefunden zu haben glaubt – für andere
Forscher ähneln seine „fossilen Bakterien“ eher Hohlräumen, die auch
durch geologische Prozesse entstanden sein könnten. Schopf selber,
einer der führenden Paläontologen, hält aber nach Messungen der
Isotopen-Komposition seiner Funde an seiner Interpretation fest.
Sein schärfster Kritiker, der englische Paläontologe Martin Brasier,
glaubt nun auch selbst, nur 30 Kilometer entfernt rund 3,4
Milliarden Jahre alte "Fossilien" gefunden zu haben. (Wenn das Leben
aus chemischen Vorläufern – siehe unten – entstanden ist, gibt es
ohnehin ein Kontinuum zwischen nicht lebendig und lebendig. Daher
sollte es auch nicht verwundern, dass die Einstufung möglicher
Frühformen umstritten ist.) Als älteste weitgehend unbestrittene
Spuren des Lebens gelten rund 3,3 Milliarden Jahre
alte Mikrofossilien (0115);
spätestens zu dieser Zeit gab es also Leben auf der Erde. Wie ist es
dazu gekommen?
Die Theorie von der Urzeugung
Die Entstehung des Lebens kann man als Resultat eines göttlichen
Schöpfungsaktes sehen (an den man glauben muss) oder als Ergebnis
natürlicher Prozesse: Dann wurden die ersten Lebensformen durch
chemische Reaktionen aus unbelebter Materie gebildet. Die ersten
Naturforscher glaubten noch an eine “Urzeugung”, wonach mindestens
kleine Lebewesen jederzeit spontan aus unbelebter Materie entstehen
konnten – die Entstehung von Maden in Fleisch schien dafür ein
Beispiel zu sein. Diese Theorie wurde 1668 von Francesco Redi
widerlegt, einem Gelehrten am Hof der Medici in Florenz: Er zeigt,
dass in Flaschen mit Fleisch keine Maden entstanden, wenn er
verhinderte, dass Fliegen an das Fleisch gelangten. Redi schloss
daraus, dass alles Leben “von Pflanzen und Tieren selbst abstammt”.
Aber fast gleichzeitig erschloss das neu entwickelte Mikroskop den
Biologen eine neue Welt: Lebewesen, die so klein waren, dass sie mit
dem bloßen Auge nicht zu sehen waren. Diese entstanden offenbar doch
von selbst, und 1748 wies der englische Pfarrer John Needham in
Bratensoße scheinbar spontan entstandene Bakterien nach. Die Idee
von der Urzeugung lebte wieder, blieb aber umstritten: 1768 konnte
der italienische Gelehrte Lazzaro Spallanzani zeigen, dass keine
Bakterien entstanden, wenn die Soße lange genug gekocht (heute würde
man sagen: sterilisiert) wurde. Das überzeugte aber nicht alle
Naturforscher: Für sie hatte Spallanzani durch seine Kocherei
einfach die “Lebenskraft” der Luft im Kolben zerstört. Diese
Zweifel zerstreute erst fast 100 Jahre später der französische
Chemiker Louis Pasteur: Im Jahr 1862 wiederholte
der Spallanzanis Experiment, sorgte aber dafür, dass Luft über einen
S-förmigen Flaschenhals (der Staub und Mikroorganismen zurückhielt,
die angenommene “Lebenskraft” aber nicht) in den Behälter gelangen
konnte. Es entstanden keine Bakterien. Ohne Flaschenhals wuchsen
diese aber sofort – das Leben kam also mit dem Staub und den
Mikroorganismen in die Bouillon. Damit war die “Urzeugung” endgültig
widerlegt; und während die Kirche die Zuständigkeit für die
Schöpfung wieder alleine bei Gott sah, stellte sich für die Biologen
die neue Frage: Wenn Leben nicht spontan entstehen kann, wie war es
dann auf die Erde gekommen? Um diese Frage beantworten zu können,
mussten sie aber erst einmal die Frage beantworten, was Leben
eigentlich ist.
Was
ist Leben?
Leben ist einfach zu erkennen: Lebewesen reagieren auf ihre
Umgebung und verhalten sich zweckbestimmt (bewegen sich z.B. in
Richtung auf eine Nahrungsquelle oder weg von einer Gefahr), und sie
vermehren sich. Steine oder andere Dinge, die nicht leben, machen
dies nicht. Aber diese Beschreibung erklärt nicht, was Leben
eigentlich ist. Früher glaubte man (siehe oben) an eine
magische "Lebenskraft" (vis vitalis), die hinter dem Leben
stehen müsse, aber Pasteurs Experimente und seine Erkenntnis, die
er bei der Untersuchung der Fermentation (alkoholischen Gärung)
gewann, dass diese nämlich durch Hefezellen ausgelöst wird,
schwächten diese Idee: wenn die Gärung, also die Umwandlung von
Zucker in Alkohol und damit eine chemische Reaktion (wie ein halbes
Jahrhundert vor Pasteur einer der Väter der Chemie, der französische
Wissenschaftler Antoine Lavoisier, herausgefunden hatte), von einem
Lebewesen ausgelöst werden kann, gibt es offenbar keinen
prinzipiellen Unterschied zwischen dem Leben und chemischen
Reaktionen. Pasteur schloss daraus: "Chemische Reaktionen sind eine
Lebensäußerung der Zelle". Zu diesem Zeitpunkt war aber auch der
Glaube, dass die (sich mit Kohlenstoffverbindungen beschäftigende)
"organische Chemie" grundsätzlich verschieden von der "anorganischen
Chemie" sei, widerlegt: 1828 war es dem deutschen Chemiker Friedrich
Wöhler gelungen, "organischen" Harnstoff aus anorganischen
Komponenten herzustellen.
Aber auch wenn das Leben aus den gleichen chemischen Elementen
besteht wie alles andere auch (0120),
so ist das Leben doch keine "gewöhnliche" Chemie, sonst wäre die
Vermutung einer vis vitalis wohl nie entstanden. 1860
entdeckte der französische Chemiker Marcelin Berthelot in
zerstoßenen Hefezellen eine interessante Substanz: sie löste die
Aufspaltung von Haushaltszucker (Saccharose) in Traubenzucker
(Glukose) und Fruchtzucker (Fruktose) aus, wurde aber selbst bei
dieser chemischen Reaktion nicht verbraucht. Er nannte diese
Substanz Invertase. Invertase ist ein Enzym (früher
"Ferment" genannt): ein in Lebewesen gebildeter Katalysator – ein
Katalysator ist ein Stoff, der eine chemische Reaktion (häufig
extrem) beschleunigt. Und damit war man dem "chemischen Geheimnis"
des Lebens auf die Spur gekommen. Die meisten Phänomene des Lebens
entstehen durch chemische Reaktionen, die von Enzymen katalysiert
(beschleunigt) werden. In den Zellen aller Lebewesen (mehr)
laufen gleichzeitig hundert oder tausende solcher durch Enzyme
katalysierter chemischer Reaktionen ab, mit denen die Strukturen der
Zelle aufgebaut werden; gleichzeitig werden Stoffe abgebaut, um
Energie freizusetzen und die Strukturen der Zelle zu recyceln. Die
meisten Enzyme sind Proteine (Eiweiße), daneben gibt es auch
katalytisch aktive Ribonukleinsäure (RNS) oder
Desoxyribonukleinsäure (DNS) (mehr zu diesen Substanzen hier).
Proteine sind, wie die Erbmoleküle DNS und RNS und auch die Lipide,
die die Zellmembranen bilden, Polymere. Ein Polymer ist ein
kettenartiges Molekül, dass "aus vielen (gleichen) Teilen aufgebaut"
ist; im Falle der Proteine sind das (20 verschiedene) Aminosäuren.
Sobald eine solche Aminosäurekette entstanden ist, faltet sie sich
zu einer dreidimensionalen Struktur. Die meisten variablen Teile
der Aminosäuren finden sich an den Außenseiten dieser Struktur und
führen dazu, dass jedes Protein spezifische chemische Eigenschaften
hat – die dafür sorgen, dass ein Enzym eine ganz bestimmte chemische
Reaktion katalysiert. Dabei sind Wechselwirkungen zwischen den
Enzymen und den chemischen Substanzen ("Substrate" genannt), die
sie "bearbeiten" extrem genau und können sich gezielt auf einzelne
Atome oder chemische Bindungen beziehen. Und Enzyme können auch
"zusammenarbeiten": das Produkt einer Reaktion wird direkt an ein
anderes Enzym weitergeleitet und dort weiterbearbeitet. So werden
komplexe Strukturen wie Lipidmembranen hergestellt oder die DNS
kopiert. Neben der Rolle als Katalysator erfüllen andere Proteine
weitere wichtige Aufgaben in der Zellchemie. Alleine in einer
Hefezelle gibt es mehr als 40 Millionen Proteinmoleküle, und jedes
Enzym unter ihnen kann in jeder Sekunde abertausende oder sogar
Millionen chemische Reaktion abwickeln. Damit dies alles geordnet
abläuft, gibt es neben den Enzymen weitere Strukturen in den Zellen,
z.B. die Ribosomen, an denen die Proteine hergestellt werden.
Ribosomen bestehen aus mehreren Dutzend Proteinen und einigen
RNS-Molekülen. In den größeren Eukaryoten-Zellen (siehe hier)
gibt es zudem von Membranen abgegrenzte Kompartimente wie den
Zellkern (die "Organellen"). Jede einzelne Zelle eines Lebewesens
ist damit um Dimensionen komplexer als die größte Chemiefabrik,
aber alles, was hier geschieht, gehorcht den Gesetzen der Physik
und der Chemie.
Die Chemie liefert denn auch die beste Annäherung an eine
Definition: Leben ist ein selbstherstellendes,
selbsterhaltendes und fortpflanzungsfähiges System, das
in einem chemischen Prozess aus “nicht lebendigen” Bausteinen
entsteht. (Dabei spielt der Kohlenstoff, das Element, um das sich
die organische Chemie dreht, tatsächlich eine große Rolle: das
liegt vor allem daran, dass Kohlenstoff eine enorme Vielfalt
unterschiedlicher stabiler chemischer Verbindungen eingehen kann
[siehe auch
Kohlenstoff und Leben]). Selbstherstellend
bedeutet, dass die Bestandteile eines Lebewesens sich „von selbst“
zusammenfügen. Dies ist in der Natur nichts Ungewöhnliches: das
Wachstum von Kristallen, die Wolkenbildung oder bestimmte chemische
Reaktionen sind „selbstherstellend“ – diese Vorgänge geschehen
aufgrund der Eigenschaften des Materials und werden nicht von außen
"aufgezwungen". Aber die genannten Vorgänge sind nicht
selbsterhaltend; die entstandenen Systeme zerfallen früher oder
später wieder. Das hat mit einem der wichtigsten Naturgesetze, dem
zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, zu tun: Sich selbst überlassen,
tendieren geordnete Strukturen zum Zerfall. (Der zweite Hauptsatz
der Thermodynamik besagt, dass in der Natur bei allen Vorgängen, die
von alleine ablaufen, die Entropie – ein Maß für die "Unordnung" –
zunimmt; mehr dazu hier.)
Der Aufbau und Erhalt geordneter Strukturen in Lebewesen bedeutet
jedoch eine Abnahme der Entropie, und diese ist nur möglich, wenn
einem System Energie zugeführt wird. Und das ist der entscheidende
Punkt: Leben kann sich im Unterschied zu den anderen
selbstherstellenden Systemen selbst dauerhaft erhalten, weil es sich
selbst aktiv mit Energie versorgen kann. Damit wird es zum
autonomen „selbsterhaltenden“ System. Wichtig ist
dabei das aktiv: In der Natur gibt es auch andere
selbsterhaltende Systeme, zum Beispiel ein Feuer – solange
Brennstoff und Sauerstoff vorhanden sind, wird es brennen. Aber
sobald der Brennstoff zur Neige geht, erlischt das Feuer, ist also
nicht dauerhaft selbsterhaltend (0125).
Dieses Problem umgeht das Leben mit der aktiven Beschaffung der zu
seinem Erhalt notwendigen Materie und Energie. Und diese Fähigkeit
des Lebens ist irgendwie durch die Wechselwirkungen zwischen seinen
Bausteinen entstanden (0130).
Selbsterhaltung bedeutet natürlich nicht, dass Leben völlig
unabhängig von seiner Umwelt wäre, im Gegenteil: die Materie und die
Energie, die zur Aufrechterhaltung des Lebens notwendig sind,
stammen aus der Umwelt. (Physikalisch gesehen muss das so sein: bei
der Erzeugung der Energie, die sich ein Lebewesen zuführt, muss mehr
Entropie entstanden sein, als beim Aufbau der geordneten Strukturen
in einem Lebewesen abgebaut wird, so dass in der Summe eine Zunahme
der Entropie erfolgt – wie es der zweite Hauptsatz der Thermodynamik
verlangt. [0132])
Heute hängt das Leben in den allermeisten Fällen von der
Sonnenenergie ab; die ersten Lebensformen dürften – wie es auch
heute noch einige "chemotrophe" Bakterien tun – energiereiche
chemische Verbindungen genutzt haben. Die Aufnahme und Umwandlung
von Energie und Materie in Lebewesen heißt „Stoffwechsel“;
und dieser ist daher ebenfalls ein Merkmal des Lebens. Vom
Stoffwechsel leiten sich weitere typische Eigenschaften des Lebens
ab. Erstens: Die Aufnahme von Stoffen und Energie muss gezielt sein
– in der Umgebung eines Lebewesens können sich ja auch Stoffe oder
Energie finden, die ihm schaden könnten; Lebewesen können daher
immer auf Reize in der Umgebung reagieren. Zweitens: Die chemischen Reaktionen des
Stoffwechsels können zudem nur stattfinden, wenn die
Reaktionspartner nicht zu sehr verdünnt werden, daher finden alle
Lebensvorgänge in von der Außenwelt abgetrennte Grundeinheiten
statt: den Zellen, aus denen alle Lebewesen
aufgebaut sind (0135).
Diese Zellen sind wiederum, wie wir oben gesehen haben,
kompartimentiert, also in Bereiche mit bestimmten Funktionen
unterteilt. Bei größeren mehrzelligen Lebewesen gibt es solche
Kompartimente auch auf höherer Ebene: denn sprechen wir z.B. von
Organen (wie der Leber oder dem Herz), die spezielle Aufgaben
wahrnehmen.
(Genau genommen können sich aber nur Archaeen und Cyanobakterien
vollständig selbst erhalten, alle anderen Lebewesen sind wiederum
von anderen Lebewesen abhängig: alle Pilz-, Pflanzen- und Tierarten
einschließlich des Menschen sind für ihre Zellchemie auf deren Hilfe
angewiesen. So sind Pflanzen auf Bakterien und Cyanobakterien
angewiesen, die den Stickstoff aus der Luft "pflanzenverfügbar"
machen [siehe >> Stickstoffkreislauf].
Tiere leben wiederum von den Stoffen, die Pflanzen herstellen –
direkt, wenn sie Pflanzen fressen und indirekt, wenn sie andere
Tiere fressen. Pilze wiederum leben von ausgeschiedenem oder aus
abgestorbenen anderen Lebewesen stammendem organischen Material.
Auch der Mensch ist eigentlich ein Ökosystem: auf jedem Menschen
leben mehr Einzeller als er Körperzellen besitzt [und das sind etwa
30.000 Milliarden]! Und wir brauchen diese, so produzieren in
unserem Darm bestimmte Bakterien Aminosäuren und Vitamine, die wir
nicht selber herstellen können.
Das Leben auf der Erde ist Bestandteil eines
einzigen vernetzten Ökosystems, und nur Archaeen und Cyanobakterien
könnten ohne dieses überleben.
Wenn alle Menschen diese Grundlage ihres Lebens verstanden hätten,
würden sie vielleicht öfter mal darüber nachdenken, wie clever es
ist, dass wir es in Kauf nehmen, als Nebenwirkung unserer
Lebensweise genau dieses Ökosystem tiefgreifend
zu zerstören.)
..........................................................................................................
Energiegewinnung in Lebewesen
Am Anfang jeder Nahrungskette stehen Organismen – Bakterien, Algen
oder Pflanzen –, die aus Wasserstoff (oder einem anderen
Elektronenspender, siehe unten) und Kohlendioxid organische
Verbindungen herstellen (die Primärproduzenten).
Kohlendioxid ist in der Luft oder im Meerwasser enthalten,
Wasserstoff muss zumeist erst aus Verbindungen freigesetzt werden.
Dies kann aus chemischen Verbindungen wie Schwefelwasserstoff oder
Methan geschehen (wie im Falle der Schwefel- oder Methanbakterien);
in den meisten Fällen werden hierfür heute jedoch mit Hilfe von
Sonnenlicht Wassermoleküle gespalten, das ist der Kern der
Fotosynthese, heute die wichtigste, aber aufgrund ihrer
Komplexität sicher nicht die ursprüngliche Energiequelle für das
Leben. Um aus Kohlendioxid organische Verbindungen herzustellen,
muss es reduziert werden; organische Verbindungen entstehen daher
zumeist (0140) mittels
einer "Atmung" genannten
Redoxreaktion: Kohlendioxid nimmt Elektronen auf, die aus
Wasserstoff oder einem anderen "Elektronenspender" stammen. Der
Elektronenfluss vom Elektronenspender zum Kohlendioxid verläuft
dabei entlang einer Kette von Molekülen – der "Atmungskette" –;
entscheidend ist, dass hierbei (nicht unähnlich dem
Elektronentransport beim Stromfluss) Energie fließt – und diese wird
in Form von Protonengradienten über Membranen in
der Zelle gespeichert: positiv geladenen Wasserstoffionen (Protonen)
von Protonenpumpen aus dem Zellinneren nach außen gepumpt, wodurch
eine Spannungsdifferenz und ein Konzentrationsgefälle entstehen.
Dieses elektrochemische Gefälle wird (nicht unähnlich den Vorgängen
in einem Wasserkraftwerk) als Energiequelle genutzt: Beim
Rücktransport der Protonen in das Zellinnere durch ein Enzym namens
ATP-Synthase wird die Energie wieder frei und zur Herstellung von ATP
(Adenosintriphosphat) aus Adenosindiphosphat (ADP),
genutzt. Für die Aufklärung dieser “chemiosmotischen Koppelung”
erhielt der britische Biochemiker Peter Mitchell im Jahr 1978 den
Nobelpreis für Chemie. (Das gleiche Prinzip (0145)
liegt auch der Fotosynthese zugrunde, diese dürfte sich daher von
der Atmung ableiten.) ATP ist sehr energiereich; die in diesem
Molekül gespeicherte Energie wird wieder frei, wenn eine
Phosphatgruppe abgespalten wird und wieder Adenosindiphosphat (ADP)
entsteht (0150). Die
hierbei freigesetzte Energie ist der mit Abstand häufigste Weg, wie
die von Enzymen katalysierten Reaktionen im Zellinneren mit Energie
versorgt werden – also der Aufbau des Erbmoleküls DNS, von
Proteinen, von Fetten ...; alles wird durch ATP
angetrieben. ATP wird in allen Lebewesen als
„Energieüberträger“ genutzt und ist damit sozusagen die universelle
Energiewährung der lebenden Zelle – wenn ein chemischer
Vorgang in einer Zelle Energie braucht, werden energiereiche
ATP-Moleküle in ADP umgewandelt, wobei die im ATP gespeicherte
Energie wieder frei wird. Ein Mensch produziert und verbraucht jeden
Tag etwa das dreifache seines Gewichtes an ATP, manche Bakterien
sogar das siebentausendfache; das mag die Bedeutung dieses Moleküls
für den Energiestoffwechsel verdeutlichen.
..........................................................................................................
Eng mit Selbstherstellung und dauerhafter Selbsterhaltung in
Zusammenhang steht die Fortpflanzungsfähigkeit:
ein sich selbst herstellendes und dauerhaftes System wird sich auch
vermehren, wenn Materie und Energie in der Umwelt vorhanden sind.
Insofern ist die Fähigkeit zur Fortpflanzung eigentlich nichts
anders als die logische Folge der ersten beiden Eigenschaften, hatte
aber derartige Folgen und ist derart kennzeichnend für das Leben,
dass sie gesondert erwähnt werden soll. Das Leben ist damit nämlich
„anstekkend“: es breitete sich auf der Erde aus. Es hat zudem alle
erdgeschichtlichen Umwälzungen von mindestens 3,5 Milliarden Jahren
überstanden, sich also als äußerst robust erwiesen; und es gibt auch
keine Anzeichen dafür, dass sich dies in absehbarer Zeit ändern
könnte. (Für einzelne Arten stellt sich die Situation allerdings
ganz anders dar, mehr darüber >> hier.)
Die Fortpflanzungsfähigkeit alleine ist noch kein Kennzeichen des
Lebens, sondern kommt auch in anderen chemischen Systemen vor: Der –
auch in Lebewesen sehr verbreitete – Citratzyklus etwa, bei dem
Essigsäure (ein Molekül mit zwei Kohlenstoff-Atomen) mit
Kohlendioxid zu Pyruvat (mit drei Kohlenstoffatomen) reagiert, das
wiederum mit Kohlendioxid zu Oxalacetat reagiert – und so weiter,
bis schließlich Zitronensäure (mit sechs Kohlenstoffatomen)
entsteht. Wenn Zitronensäure in Essigsäure und Oxalacetat zerfällt,
können aus einem Citratzylus zwei werden – der chemische Prozess
vermehrt sich also.
Nun kann das Leben sich aber nicht nur vermehren, wenn Energie und
Materie sowieso vorhanden sind, sondern diese aktiv suchen. Dazu
muss es Informationen aus der Außenwelt sammeln und
verarbeiten. Um die komplexen Reaktionen im Inneren der Zellen
aufrechtzuerhalten, ist es zudem notwendig, dass auch Informationen
aus dem Zellinneren (etwa über die chemischen Bedingungen dort)
gesammelt und verarbeitet werden. Für die Informationsverarbeitung
in der Zelle gibt es viele gut untersuchte Beispiele. Eines ist
etwa die Herstellung von Proteinen, bei der Information von der DNS
in die Aminosäuresequenz der Proteine übersetzt wird (siehe hier).
Die Gene von der DNS können zudem an- und abgeschaltet werden
("Repressoren" genannte Moleküle, schalten Gene ab, "Aktivatoren"
genannte Gene schalten Gene an). Grundlagen zum Verständnis dieser
Genregulation legten die beiden französischen Biologen François
Jacob und Jacques Monod (die dafür 1965 den Nobelpreis für Medizin
erhielten), die zeigten, dass das Darmbakterium Escherichia
coli zwei verschiedene Zucker mit zwei unterschiedlichen
Enzymen abbaute. Sie konnten zeigen, dass das Gen für eines der
Enzyme abgeschaltet wurde, wenn das Bakterium mit dem anderen Zucker
ernährt wurde, und wieder angeschaltet wurde, wenn das Bakterium
mit dem alternativen Zucker versorgt wurde. (Wie wir heute wissen,
sorgt dafür der alternative Zucker selbst: dieser bindet sich an das
Repressormolekül des Gens, ein Protein, und beeinträchtigt dessen
Funktion. Das Gen wird ohne das Repressormolekül wieder aktiv und
produzierte das zur Nutzung des alternativen Zuckers notwendige
Enzym.) Informationstheoretisch handelt es sich hierbei um eine
negative Rückkoppelung: die Anwesenheit des alternativen Zuckers
führt dazu, dass dieser abgebaut wird. Die Zelle besteht aus
zahlreichen solcher informationsverarbeitenden Einheiten (in der
Biologie spricht man von "Signalwegen"), die deutlich komplexer sein
können, miteinander verbunden sind und in der Summe erstaunliche
Dinge vollbringen – Dinge, die wir Leben nennen.
Diese erstaunlichen Fähigkeiten müssen aber nicht nur in einer
Zelle vorhanden sein, sondern an die Tochterzellen weitergegeben
werden. Dazu braucht es einen Informationsspeicher.
Diese Rolle übernimmt bei fast allen bekannten Lebewesen (0155)
zum größten Teil die Erbsubstanz
DNS, die bei einer Zellteilung ebenfalls kopiert und an die
Tochterzellen weitergegeben wird. Dass fast alle bekannten
Lebewesen die DNS und sogar ohne Ausnahmen den gleichen
„genetischen Code“ zur Informationsweitergabe nutzen, gilt wie auch
die universelle Energiewährung ATP als Beleg dafür, dass alles
heutige Leben einen gemeinsamen Vorfahren hat. (Es ist dagegen kein
Beweis dafür, dass Leben nur einmal entstanden ist: es könnte auch
mehrfach entstanden sein, aber nur eine Linie hätte bis heute
überlebt.) Mit anderen Worten: alles Leben ist miteinander verwandt.
Wir sind nicht nur – siehe oben – von anderen Lebewesen abhängig,
wir sind auch mit ihnen verwandt. Soweit wir wissen, sind wir
Menschen die einzigen Lebewesen, die sich dieser Verwandtschaft
bewusst sind. Ältere Kulturen (siehe etwa die Darstellung in dem
Buch Geflochtenes Süßgras)
haben dieses längst verinnerlicht, den indigenen Potawatomi in
Nordamerika etwa gelten Pflanzen und Tiere als "nichtmenschliche
Verwandte". Alten Wissen, das es auf dem Weg zur ökologischen
Nachhaltigkeit wiederzuentdecken gilt (siehe >> Die
kulturelle Vielfalt der Menschheit).
..........................................................................................................
Informationsspeicher DNS
Die Erbsubstanz DNS besteht aus Basen, Zucker und Phosphatgruppen;
entscheidend für die Informationsspeicherung und -weitergabe sind
die Basen. Von diesen gibt es vier verschiedene, von denen wir uns
hier nur die Anfangsbuchstaben merken müssen: A, C, G und T (0160).
Sie stellen so etwas wie das Alphabet der DNS dar, das aus diesen
vier Buchstaben besteht. Die Worte der DNS-Sprache bestehen immer
aus drei Buchstaben, zum Beispiel ACT, CGA oder TTC. Jedes Wort
steht für eine Aminosäure, ein Satz steht für eine Erbanlage:
Aminosäuren sind nämlich die Bausteine der Proteine, die als Enzyme
die meisten chemischen Reaktionen in der Zelle steuern. Die
Informationsweitergabe funktioniert also über die Herstellung von
Proteinen. Um aus einem DNS-Satz ein Protein herzustellen, wird
zunächst eine Negativkopie eines Gens (Erbanlage) in Form eines mRNS
genannten Moleküls hergestellt – die RNS ist ein der DNS chemisch
eng verwandtes, jedoch weniger stabiles Molekül. Die mRNS wird dann
zu den „Proteinfabriken“ der Zelle (den „Ribosomen“) transportiert,
wo mit Hilfe einer weiteren RNS (der tRNS) die Aminosäuren
entsprechend der „Worte“ der DNS zu einem
Protein verknüpft werden. Ob aber überhaupt ein Protein
hergestellt wird, hängt von der von Jacob und Monod entdeckten
Genregulation ab, die nicht nur zur Aufrechterhaltung von stabilen
chemischen Zuständen genutzt werden: Raupen und Schmetterlinge oder
die Zellen unserer Leber und unserer Haare haben ja die gleichen
Gene, die Unterschiede zwischen ihnen kommt durch unterschiedliche
Muster der Genaktivierung zustande. Daher sind die Erbanlagen (die
berühmten „Gene“) eher mit Subroutinen eines Computerprogramms
vergleichbar (ein Bild des englischen Biologen Richard Dawkins).
Wie genau dieses aber gesteuert wird, ist eines der aktuellsten
Forschungsgebiete der Genetik, die DNS erweist sich dabei als
komplizierter und vielfältiger, als früher angenommen – die
Vererbung besteht aus einem komplexen, raumzeitlichen Zusammenspiel
von DNS, Proteinen und anderen Molekülen, das noch niemand wirklich
verstanden hat.
Die Teilung der DNS zur Weitergabe in die Tochterzelle ist jedoch
leicht verständlich, wenn man weiß, dass die Basen in den Sprossen
sich immer nur in zwei Paaren miteinander verbinden: C–G und A–T.
Wenn sich nun die beiden Hälften der Leiter in der Mitte trennen,
wird sich C immer nur mit G und A immer nur mit T verbinden, und so
wird jeweils die fehlende Hälfte wieder ergänzt: es entstehen zwei
identische Kopien. (Mehr zur DNS >> hier.)
Dabei geschehen jedoch Fehler, von Zeit zu Zeit verändert sich
dadurch die Erbinformation eines Lebewesens: Diese Variabilität ist
Grundlage der Evolution, die die große
Vielfalt des Lebens auf der Erde
hervorgebracht hat. DNS kann aber auch extrem stabil sein, wenn
auftretende Veränderungen keine Vorteile bringen: so ist die DNS,
mit denen Teile der Ribosomen codiert werden, bei allen Organismen,
von den Archaeen und Bakterien über die Pilze und Pflanzen bis hin
zum Menschen gleich – sie ist also über drei Milliarden Jahre
unverändert geblieben.
..........................................................................................................
Mit diesen Informationen über das Leben wird jetzt
nachvollziehbar, welche Fragen bei der Suche nach der Entstehung des
Lebens im Vordergrund stehen. Erstens: Wie gewannen die Vorläufer
der ersten Lebewesen Energie, um sich selbst erhalten zu können? Wie
entstand also der Stoffwechsel? Zweitens: Wie entstand die
Fähigkeit zur Informationsweitergabe bei der Vermehrung? (Die DNS
war mit ziemlicher Sicherheit nicht das erste System, da zu ihrer
Teilung Proteine benötigt werden, die erst mit Hilfe der DNS
hergestellt werden.) Und wie kamen Stoffwechsel und
Informationsweitergabe zusammen? Oder sind sie gemeinsam entstanden?
Wie könnte das Leben entstanden sein?
Die Überlegungen zur Entstehung des Lebens wurden in Zusammenhang
mit Darwins
Evolutionstheorie neu angefacht. Darwin selbst hielt sich
mit Aussagen über die Entstehung des Lebens zurück (sein Stammbaum
in “Die Entstehung der Arten” hatte keine Wurzeln), aber der Biologe
Ernst Haeckel vertrat im Jahr 1868 in einer Vorlesungsreihe an der
Universität Jena die Ansicht, das Leben könne durch spontane
Vereinigung geeigneter chemischer Stoffe zu primitiven Organismen
entstanden sein. (Der Unterschied zur Theorie von der “Urzeugung”
ist, dass heute die “geeigneten chemischen Stoffe” vom Sauerstoff in
der Atmosphäre zerstört oder von den Lebewesen aufgefressen würden;
die Entstehung des Lebens also ein einmaliger historischer Vorgang
war.) Aufgegriffen wurde Haeckels Idee von dem russischen
Biochemiker Aleksandr Oparin, der 1924 das Buch „Ursprung des
Lebens“ veröffentlichte und – unabhängig davon – von dem englischen
Physiologen John B. S. Haldane: Beide vermuteten, durch chemische
Reaktionen in der sauerstofffreien Uratmosphäre seien organische
Verbindungen entstanden, die sich in den Urozeanen angesammelt und
zu primitiven Lebensformen vereinigt hätten. Nach Oparin verlief
der Weg über sogenannte „Koazervate“: kleine Anhäufungen von
Biomolekülen in hohen Konzentrationen. Die Überlegungen werden
heute als chemische Evolution betitelt: Ähnlich
wie bei der
biologischen Evolution wird davon ausgegangen, dass chemisch
stabilere Verbindungen länger bestehen bleiben und sich durch
weitere Reaktionen verändern können – und wenn die neuen Substanzen
stabiler sind, übernehmen sie die Rolle der ursprünglichen
Ausgangssubstanz.
Die Hypothesen von Oparin und Haldane regten den amerikanischen
Chemiker und Biologen Stanley Miller im Jahr 1953
zu einem berühmten Experiment an, bei dem er in einem teilweise
mit Wasser gefüllten Glaskolben Gasen starken elektrischen
Entladungen aussetzte: Die Gase sollten die Uratmosphäre der Erde
darstellen, die elektrischen Entladungen Blitze und das Wasser den
Urozean. Tatsächlich fand Miller anschließend organische Stoffe im
Wasser, darunter Aminosäuren, die Bausteine der Proteine. Dieses mit
organischen Stoffen angereicherte Wasser sollte eine Art „Ursuppe“
darstellen, in der das Leben entstanden ist. Leider stellte sich
später heraus, dass Millers Annahme über die Uratmosphäre nicht
stimmte (0165), und mit
realistischeren Annahmen wollte die Entstehung von Aminosäuren nicht
gelingen. Die Annahme einer „Ursuppe“ wurde schließlich dadurch
gerettet, dass organische Stoffe, darunter Aminosäuren, in großen
Mengen im Weltall entdeckt wurden. Sie könnten durchaus mit dem
Kometenbombardement der jungen Erde auf unseren Planeten gelangt
sein – dies hätte demnach nicht nur Wasser, sondern auch die für das
Leben notwendigen organischen Baustoffe auf die Erde gebracht. Das
eigentliche Problem der „Ursuppe“ ist ein ganz anderes: In dem
starken Gezeiten ausgesetzten und daher aufgewühlten Urozean hätten
sich kaum irgendwo derartige Konzentrationen an organischen Stoffen
ansammeln können, um bedeutungsvolle chemische Reaktionen in Gang zu
setzen. Miller glaubte daher später, dass das Leben in periodisch
austrocknenden Tümpeln entstanden sein könnte, in denen organische
Substanzen konzentriert wurden. Aber auch hier blieben noch Fragen
offen: Welche Energiequelle hätte die Bildung hoch geordneter,
komplexer Systeme antreiben können? Die Energieversorgung des
heutigen Lebens beruht, wie wir oben gesehen haben, auf der
Freisetzung von Wasserstoff; die Selbstherstellung und
Selbsterhaltung komplexer Systeme entgegen der Tendenz zur Zunahme
der Entropie hat zumindest solange eine ständige externe Versorgung
mit Energie erfordert, bis das Leben zu einer aktiven
Energieversorgung (Stoffwechsel) in der Lage war. Bisher konnte
aber niemand plausibel erklären, wie dies in der energiearmen
Ursuppe geschehen sein könnte.
Die Hypothese von der hydrothermalen Lebensentstehung
Daher beflügelte eine Entdeckung aus dem Jahr 1977 sofort die
Phantasie der Forscher, die nach den Ursprüngen des Lebens suchten:
In jenem Jahr wurden erstmals die Tiefseequellen untersucht, die
wenige Jahre zuvor vor den Galapagos-Inseln entdeckt worden waren.
Es war eine bizarre Welt: Aus den Quellen stieg stark saures Wasser
mit großen Mengen dunkler Metall-Schwefelverbindungen auf (daher
werden sie auch „Schwarze Raucher“ genannt); vor
allem aber fand sich dort, obwohl kein Sonnenlicht mehr in diese
Tiefen reicht, wimmelndes Leben. Als Schlüssel stellten sich
Bakterien heraus, die vom Schwefelwasserstoff lebten, der aus den
Quellen austritt. Von diesen Bakterien lebten wiederum alle anderen
Lebewesen. Hier war nun eine Energie- und Wasserstoffquelle
gefunden, die es auch in der Frühzeit der Erdgeschichte gegeben hat.
Allerdings: Die heute vom Schwefelwasserstoff lebenden Bakterien
brauchen Sauerstoff, und den gab es in der Erdfrühzeit im
Meereswasser nicht. Der heutige, komplexe Stoffwechsel ist aber auch
kaum in einem Schritt entstanden; frühe Lebensformen haben
vermutlich ohnehin Energie ganz anders genutzt. Eine Hypothese
hierfür entwickelte beispielsweise der Münchener Chemiker Günther
Wächtershäuser: Demnach wäre die von der Reaktion des
Schwefelwasserstoffs mit Eisen aus dem Meerwasser zu
Eisen-Schwefel-Verbindungen wie Pyrit („Katzengold“) freigesetzte
Energie die erste Energiequelle des Lebens gewesen. Wächtershäuser
zeigte auch, dass diese Energie ausreicht, aus den im Quellwasser
vorhandenen Stoffen organische Verbindungen aufzubauen. Offen
bleibt, ob diese organischen Substanzen nicht im Meerwasser zu stark
verdünnt werden, oder falls sie – wie Wächtershäuser annimmt – an
der Oberfläche von Pyrit gebunden sind, wie sie dort für eine
weitere Reaktion zusammenkommen konnten. Zum anderen bestehen
Schwarze Raucher höchstens ein paar Jahrzehnte lang; es ist sehr
zweifelhaft, ob in so kurzer Zeit hier Leben entstehen konnte.
Neben den Schwarzen Rauchern gibt es jedoch andere Arten von
Hydrothermalquellen, von denen allerdings erst wenige untersucht
sind: alkaline
Tiefseequellen wie die im Jahr 2000 gefundene „Lost City“
im Atlantik. An diesen tritt stark basisches Wasser aus; es ist
derart mineralreich, dass sich beim Austritt poröse Kalkschlote
abscheiden. Solche Tiefseequellen waren schon länger fossil bekannt,
und haben Forscher wie den schottischen Geochemiker Michael ("Mike")
Russell beschäftigt. Die poröse Mikrostruktur der Schlote ähnelte
nämlich den Zellen von Lebewesen, und es gibt auch noch andere
Parallelen zwischen den Schloten und lebenden Zellen. Die
Untersuchungen in der Lost City zeigten, dass im Quellwasser
reichlich freier Wasserstoff enthalten ist, dieser Wasserstoff wird
bei der Reaktion des in den Schloten reichlich vorhandenen Minerals
Olivin mit Wasser zu Serpentinit freigesetzt, ist also geochemischen
Ursprungs. Er wird von einigen der dort lebenden Archaeen
(0170) direkt verwendet,
um mit Kohlendioxid aus dem Meerwasser organische Molekülen zu
bilden und Energie freizusetzen. Könnte dieses, so fragte sich
Russell, nicht dem Stoffwechsel ursprünglicher Organismen ähneln?
Wie wir oben gesehen haben, ist die Reaktion von Wasserstoff und
Kohlendioxid die Grundlage allen Stoffwechsels. Diese für das Leben
zentrale Reaktion ist jedoch alles andere als einfach (0175),
sondern erfordert eine hohe Aktivierungsenergie. Diese wird in
Lebewesen mit Hilfe von Proteinen, die als Katalysatoren fungieren,
herabgesetzt, wodurch (genau das macht Katalysatoren aus) die
chemische Reaktion ermöglicht wird.
Proteine sind aber Produkte des Lebens und können daher nicht der
Anfangszustand gewesen sein. In der Frühzeit der Erde – damals waren
alkaline Hydrothermalquellen vermutlich weit verbreitet – dürften
aufgrund des eisenhaltigen Meerwassers die dünnen Trennwände
zwischen den Poren Eisen-(Nickel-)Mineralien enthalten haben. Eisen,
Nickel und andere Übergangsmetalle aber sind gute Katalysatoren für
organische Reaktionen. Tatsächlich zeigte sich im Labor, dass
Eisennickelsulfide die Reaktion zwischen Wasserstoff und
Kohlendioxid katalysieren können. Angetrieben wird diese Reaktion
von einem Protonengradienten (0180),
der in alkalinen Hydrothermalquellen dort entsteht, wo aufsteigendes
basenreiches Wasser (mit niedriger H+-Konzentration)
durch dünne, halbleitende anorganische Trennwände vom sauren (und
damals aufgrund der höheren Kohlendioxid-Konzentration in der
Atmosphäre deutlich saurerem als heute) Meerwasser mit hoher H+-Konzentration
getrennt ist. Ein Protonengradient ist aber die Grundlage für die
chemiosmotische
Koppelung, einem der beiden Mechanismen (0145),
mit denen alle bekannten Lebewesen ihren zentralen Energiespeicher
ATP erzeugen (der andere ist die
"Substratkettenphosphorylierung", dabei wird eine Phosphatgruppe aus
Zwischenprodukten des Abbaus organischer Verbindungen auf das ADP
übertragen). Damit ähneln die chemischen Bedingungen in den
Schlotbläschen denen lebender Zellen, tatsächlich könnten die
Schlotbläschen zumindest theoretisch als elektrochemische Reaktoren
organische Moleküle hergestellt haben.
Die Reaktion von Wasserstoff mit Kohlendioxid ist heute noch die
Kohlenstoff- und Energiequelle für zwei Gruppen von Lebewesen, die
Methanogene (die zu den Archaeen
gehören) und den Acetogene (die zu den Bakterien
gehören); das zeigt, dass diese Reaktion alleine ausreichend ist, um
Lebewesen mit Kohlenstoff und Energie zu versorgen. Beide Gruppen
verwenden zur Kohlenstofffixierung den "reduktiven
Acetyl-Coenzym-A-Weg", dessen Kern das reaktionsfreudige
Molekül Acetyl-Coenzym-A (Acetyl-CoA) ist, das leicht mit anderen
organischen Molekülen reagiert; es kann auch direkt mit Phosphat zu
Acetylphosphat reagieren. Dieses Molekül verhält sich ähnlich wie
die universelle Energiewährung ATP, es wird auch heute noch von
einigen Bakterien genutzt und kann beispielsweise
Dehydratisierungsreaktionen antreiben, mit denen Aminosäuren und
andere Bausteine zu Ketten zusammengeführt werden. Der reduktive
Acetyl-Coenzym-A-Weg gilt als der älteste Weg der
Kohlenstofffixierung, vor allem, weil die anderen fünf bekannten
Wege der Kohlenstofffixierung wesentlich komplexer sind und nicht
nur von der chemiosmotischen Koppelung angetrieben werden, sondern
zusätzlich mit ATP versorgt werden müssen. Aber Acetyl-CoA ist
bereits ein komplexes Molekül, und muss einfachere Vorläufer gehabt
haben. In alkalinen hydrothermalen Schloten entstehende einfache
Moleküle wie Methylthioacetat könnten dort ursprünglich die heutige
Funktion von Acetyl-CoA (dessen Reaktivität auf eine
"Thioester-Bindung" zurückgeht, die Methylthioacetat genauso
besitzt) übernommen haben, und so Energie und organische Bausteine
für die Entstehung des Lebens geliefert haben, zumal sich die
organischen Bausteine bei der Abkühlung der hydrothermalen Lösung
durch einen "Thermophorese" genannten Vorgang (beim Abkühlen nimmt
die Bewegungsenergie der Moleküle ab, und zwar umso mehr, je größer
diese sind, wodurch sich die größeren organischen Verbindungen
anreichern) in den Mikroporen der Kalkschlote angesammelt haben
dürften, was ihre weitere Reaktion miteinander begünstigt hätte. Da
alkaline Hydrothermalquellen bis zu 100.000 Jahre lang bestehen
können, hätte hier nun wesentlich mehr Zeit für die Entstehung des
Lebens zur Verfügung gestanden als in den Schwarzen Rauchern.
Wie dies ausgesehen haben könnte, skizzierte 2015 der britische
Biochemiker Nick Lane (0185):
Zu den Verbindungen, die sich in den Kalkschloten bilden konnten,
gehörten demnach auch Lipiddoppelschichten (diese entstehen spontan
aus Fettsäuren), die als einfache organische Membranen wiederum
einfache organische Protozellen mit einem, wie wir oben gesehen
haben, im Prinzip ausreichenden Energie- und
Kohlenstoff-Stoffwechsel bilden konnten. In den Zellmembranen
könnten auch Proteine eingebettet gewesen sein, die mit
Eisen-(Nickel-)Schwefel-Mineralien aus dem Meerwasser Chelatkomplexe
gebildet haben, die ganz analog der Minerale in den Trennwänden als
Katalysator fungiert hätten (und einen Ansatzpunkt für die Erklärung
der Entstehung membrangebundener Enzyme, die oftmals metallische
Co-Faktoren besitzen, darstellt – der reduktive Acetyl-Coenzym-A-Weg
der Methanogene wird beispielsweise durch ein in die Membran
eingebettetes Eisen-Schwefel-Protein, eine "energieumwandelnde
Hydrogenase" [ECH, von engl. energy-converting hydrogenase],
angetrieben), der die durch den Protonengradienten zwischen dem
Zelläußeren und Zellinneren angetriebenen Reaktion beschleunigt
hätte.
Allerdings sind heutige Membranen im Unterschied zu einfachen
Lipiddoppelschichten fast undurchlässig für Protonen, der
Protonengradient wird aktiv – durch "Protonenpumpen" (Proteine, die
in der Membran sitzen und Protonen aktiv gegen den Gradienten
transportieren) – hergestellt. Das muss auch so sein, wenn das
Leben auch an Orten stattfinden soll, wo es keinen natürlichen
Protonengradienten gibt. Aber warum sollten Protozellen
Zellmembranen ausbilden, die für Protonen undurchlässig sind,
wenn sie sich damit von ihrem energetischen Antrieb, dem natürlichen
Protonengradienten, abschneiden? Und wie sollten Protonenpumpen
entstanden sein, die in einer durchlässigen Membran keinerlei
Vorteil bieten (die mit Energieaufwand gepumpten Protonen könnten ja
durch die Membran jederzeit wieder zurückströmen)? Bill Martin und
Nick Lane sahen hierfür einen möglichen Weg: Viele Membranproteine
wie die ATP-Synthase (dem Enzym, das die Herstellung der
"Energiewährung" ATP katalysiert) werden nicht nur durch einen
Protonenfluss, sondern auch durch einen Fluss des sehr ähnlichen
Natriumions (Na+) angetrieben. Viele Zellen, so auch die
Methanogene, verfügen zudem über sogenannte Antiporter, die nach Art
einer Drehtür ein geladenes Ion durch ein anderes, etwa H+
durch Na+, ersetzen). Solche Antiporter lassen einen
zusätzlichen Na+-Gradienten entstehen, und da der auch
Enzyme antreiben kann, steht der Zelle damit mehr Energie zur
Verfügung. Solche Zellen können auch bei einem weniger ausgeprägten
Protonengradienten "überleben" und hätten daher größere Bereiche im
Hydrothermalschlot besiedeln können. Vor allem aber lohnt es sich
für Zellen mit einem Natrium-Protonen-Antiporter, Protonenpumpen zu
entwickeln: Da Membranen um einige Größenordnungen weniger
durchlässig für Na+ sind als für Protonen, kann das
gepumpte Natriumion weniger leicht zurückströmen; es sollte daher
bevorzugt durch die Membranproteine wieder in die Zelle strömen, wo
der Einstrom chemische Reaktionen antreibt. Damit stehen mehr Ionen
als Antrieb für den Energie- und Kohlenstoff-Stoffwechsel zur
Verfügung; netto bedeutet dies einen Energiegewinn von etwa 60
Prozent.
Dieser Vorteil wird noch vergrößert, wenn die Membran weniger
durchlässig wird – dann fließen mehr Protonen durch den Antiporter,
was den Ionengradienten weiter erhöht. Mit anderen Worten:
Protonenpumpen führen zu einem Selektionsdruck für undurchlässige
Membranen. Protonenpumpen und undurchlässige Membranen würden aber
die Zelle unabhängig von natürlichen Protonengradienten machen, wenn
sie eine andere Energiequelle findet, die die Protonenpumpen
antreibt. Diese Energiequelle dürfte die Atmung gewesen sein, bei
der z.B. Nitrate oder Sulfate als Elektronenspender genutzt wurden,
um anorganische Substanzen oder Gase zu oxidieren. Damit kann die
Protozelle auch jenseits der Hydrothermalschlote überleben und sich
im freien Meerwasser ausbreiten... Dieses Szenario ist bisher
weitgehend Spekulation, aber immerhin eine, die die Biochemie
ursprünglicher Lebewesen wie der Methanogene von plausiblen
geochemischen Vorgängen in alkalinen Hydrothermalquellen der
Erdfrühzeit ableitet und sich prinzipiell im Labor überprüfen lässt.
Für Nick Lane, einem der Verfechter dieser Hypothese (0185),
könnte dieser Ansatz auch die fundamentalen Unterschiede zwischen
Archaeen und Bakterien erklären, die Protonenpumpen und
undurchlässige Membranen unabhängig voneinander entwickelt hätten:
Einige Acetogene hätten die ECH, die bei Methanogenen den reduktiven
Acetyl-Coenzym-A-Weg antreibt, "umgedreht" (die meisten Enzyme sind
reversibel, können also auch umgekehrt funktionieren) und, anstatt
einströmende Protonen zu nutzen, Protonen nach außen gepumpt. (Für
die ursprüngliche Funktion des ECH musste dann natürlich eine neue
Lösung gefunden werden, was dazu führte, dass die Acetogene kein
Methan, sondern Essigsäure produzieren.) Die Methanogene hätten
dagegen die ECH als Enzym beibehalten, und aus einer kleinen
Veränderung in einem Antiporter eine Protonenpumpe entwickelt. Alle
anderen Unterschiede im Kohlenstoff-Stoffwechsel dieser beiden
Gruppen leiten sich von diesem Unterschied ab; und da die
Entwicklung einer undurchlässigen Zellmembran aus der mutmaßlich
ursprünglichen Lipiddoppelschicht erst auf die Protonenpumpe folgte,
dürfte auch diese unabhängig voneinander erfolgt sein, wodurch die
Unterschiede in der Zellmembran
verständlich werden (und auch die von in der Zellmembran
eingebetteten Membranproteine, die sich an die Veränderungen der
Zellmembran anpassten: so kommt die ATP-Synthase in Archaeen und
Bakterien vor, unterscheidet sich aber in den beiden Gruppen.
Vermutlich gab es sie also bereits beim "ursprünglichen gemeinsamen
Vorfahren" (LUCA, von engl. last universal common ancestor),
hat sich in Anpassung an die verschiedenen Membranen aber in zwei
verschiedene Richtungen verändert).
Vor dieser Entwicklung war aber ein anderer Schritt nötig: In den
Hydrothermalquellen hatte es ein ständiger Energiefluss ermöglicht,
Strukturen aufrechterhalten. Außerhalb der Hydrothermalquellen war
hierfür ein Informationsträger notwendig. Bevor wir uns mit diesem,
der DNS, beschäftigen, halten wir aber erst einmal fest: Wenn
Russell, Martin und Lane recht haben, wäre das Leben am Anfang nicht
viel mehr gewesen als ein Weg der Natur, die hohe
Aktivierungsenergie der Reaktion zwischen Wasserstoff und
Kohlendioxid aufzubringen.
Wie entstand die DNS?
Die Frage nach der Entstehung des Informationssystems, also der
DNS, stand lange vor einem Henne-und-Ei-Problem: DNS ist sehr
stabil, ihre Teilung bei der Vermehrung ist nur mit Hilfe eines
Enzyms möglich. Dieses Enzym ist ein Protein, das aber erst mit
Hilfe von DNS hergestellt wird. Was also war zuerst da, und wie ist
es in die Welt gekommen? Einen Lösungsansatz bot die Entdeckung,
dass die RNS, deren Rolle bei der Herstellung von Proteinen wir
>> oben schon gesehen haben,
sowohl als Informationsträger als auch als Enzym wirksam ist. Daraus
entstand die Vorstellung, dass der heutigen DNS-Protein-Welt eine „RNS-Welt“
vorausgegangen sein könnte; der Begriff wurde 1986 von dem
amerikanischen Biochemiker Walter Gilbert geprägt.
Die RNS wäre nach dieser Vorstellung später von der chemisch eng
verwandten DNS als Informationsträger und von den als Katalysatoren
wirksameren Proteinen als Enzym abgelöst worden. Es gibt viele
plausible Überlegungen, wie dies geschehen sein könnte. So könnten
bereits RNS-Schnipsel aus nur zwei Basenpaaren die Herstellung von
Aminosäuren katalysiert haben, die heutigen drei-Buchstaben-Wörter
der DNS wären dann eine Ableitung aus diesen ursprünglichen
RNS-zwei-Buchstaben-Wörtern; die RNS-Schnipsel die Vorläufer der
t-RNS. Wo aber kam die RNS her? RNS ist wie DNS ein Polymer, besteht
also aus aneinandergereihten Bausteinen, die aus einer
Phosphatgruppe, einem Zucker und einer Base bestehen und die
Nukleotid heißen. Eines dieser Nukleotide, das mit der Base „A“, ist
nichts anderes als das Energieüberträgermolekül ADP, das eine
weitere Phosphatgruppe verloren hat (also Adenosinmonophosphat, AMP,
heißt)! Auf einmal sind Energiestoffwechsel und Informationsträger
gar nicht mehr soweit getrennt… 2009 konnte im Labor gezeigt werden,
dass mindestens zwei der vier Nukleotide der RNS unter den
geochemischen Bedingungen der Erdfrühzeit entstehen konnten (0190).
Nukleotide bilden aber spontan längere RNS-Ketten, wenn ihre
Konzentration hoch genug ist. Und hier kommen nun wieder die porösen
Hydrothermalquellen ins Spiel: Hier wären die Konzentrationen von
Nukleotiden hoch genug gewesen, um RNS-Ketten entstehen zu lassen;
und hier könnten aus RNS und den mit ihrer Hilfe entstandenen
Aminosäuren Proteine entstanden sein, die gemeinsam mit der RNS
stabile Systeme ergaben, die der natürlichen Selektion ausgesetzt
wären und sich daher immer weiterentwickelt hätten – so etwa ein
Bild, das Russell und Martin im Jahr 2003 entwarfen. Dabei könnte
auch ein Enzym entstanden sein, das die Bildung von DNS aus RNS
ermöglicht. So ein Enzym gibt es heute noch in bestimmten Viren, es
heißt „reverse
Transkriptase“.
Auch wenn vieles an diesen Ideen noch reine Spekulation ist und
viele Laborexperimente, die zu ihrer Bestätigung (oder
Widerlegung) nötig sind, noch ausstehen: Ganz unmöglich erscheint es
jedenfalls nicht, denkbare Mechanismen der Entstehung des Lebens –
also den Übergang von geochemischen auf biochemische Prozesse – auf
der Erde aufzuklären.
Oder kam das Leben aus dem Weltall?
Selbst die einst belächelte Alternative, dass organische
Verbindungen oder gar die ersten Lebewesen aus dem Weltall auf die
Erde gekommen seien, gilt heute nicht mehr als ausgeschlossen: Wie
oben beschrieben, sind organische Verbindungen im Weltall häufig,
und im Wassereis von Kometen könnten nicht nur diese transportiert
werden, sondern selbst Sporen wohl überleben. Diese Vermutung soll
mit der „Rosetta“-Mission der europäischen Raumfahrtbehörde ESA
überprüft werden, die im Jahr 2014 einen Kometen erreichen und
untersuchen soll. Das Rätsel von der Entstehung des Lebens wird
durch diese Hypothese allerdings nicht gelöst, sondern nur
außerhalb der Erde angesiedelt.
Leben auf der Erde
Wie auch immer es entstanden oder auf die Erde gelangt ist, eins
ist sicher: Seit mindestens 3,3 Milliarden Jahren gibt es Leben auf
der Erde. Als komplexe Moleküle, die Stoffe und Energie aus ihrer
Umgebung zu ihrer eigenen Selbsterhaltung nutzen konnten, und
Moleküle, die Informationen speichern konnten, zusammenkamen,
konnten Informationen über Strukturen gespeichert werden und waren
zudem der biologischen Evolution
ausgesetzt. Lange Zeit hätte man das Leben auf der Erde wohl kaum
bemerkt – es bestand aus Mikroben, die natürliche Vorgänge
beschleunigten und die dabei freigewordene Energie für ihr eigenes
Fortbestehen und ihre Vermehrung nutzten. Gelegentlich geschahen
aber Fehler beim Kopieren der vererblichen Informationen. Die
meisten davon schadeten ihren Trägern, aber einige brachten auch
Vorteile mit sich und führten dazu, dass die Mikroben immer
wirkungsvoller wurden. Die Evolution sollte ungeahnte Neuerungen
schaffen sollte – und dazu führen, dass das Leben die Erde mehrfach
tiefgreifend verändert hat. Aber das ist ein anderes Kapitel (und
Thema der folgenden Seiten. Los geht es mit:
Die Entfaltung des Lebens auf der Erde).
Webtipp:
Glasgow
Origin of Life Website, Webseite des schottischen Geochemikers
Mike Russell zur Theorie der Entstehung des Lebens durch Nutzung
chemischer Energie am Meeresboden.
Auf dem Weg zum
künstlichen Leben
Am 20. Mai 2010 veröffentlichte die
Wissenschaftszeitschrift Science einen Beitrag von Craig Venter,
Hamilton Smith und Kollegen (0195),
die erstmals erfolgreich die DNS eines Lebewesens durch eine
vollständig künstliche DNS ersetzten; und das Lebewesen vermehrte
sich anschließend weiter, lebte also. Auch wenn dieses Experiment
nicht die Ursprünge des Lebens aufklärt – Venter und Kollegen nutzen
ja den biochemischen Apparat einer bestehenden Zelle – wird damit
zum einen deutlich, dass Leben ganz wesentlich von Informationen
abhängt, zum anderen wird damit die Tür zur Erzeugung künstlichen
Lebens ganz weit aufgestoßen. Manchen macht diese Perspektive Angst:
Abgesehen von der Frage, ob wir wirklich genug über das Leben
wissen, um tatsächlich die schon propagierten nützlichen Lebewesen
wie hocheffiziente Algen, die Kohlendioxid aus den Abgasen der
Kraftwerke in Biotreibstoff umwandeln, herzustellen, bleibt vor
allem die Frage, wer uns etwa davor schützt, dass die Hacker, die
heute bösartige Computerviren programmieren, Terroristen oder
feindliche Staaten in Zukunft bösartige “echte” Krankheitserreger
bauen, die sich im Gegensatz zu anderen Waffen auch noch selber
vermehren? Niemand, geben auch diejenigen zu, die die Technik nutzen
wollen. Ihr Argument: Das Wissen lässt sich ohnehin nicht wieder aus
der Welt schaffen, es sollte möglichst öffentlich gemacht werden
(etwa nach Art der “open source”-Software), damit den
möglichen bösartigen Nutzern möglichst viele Experten
entgegenstehen, die solche Angriffe schnell abwehren können.
Diese Seite in
aller Kürze ...
Alle Vorgänge in den Zellen von Lebewesen folgen
physikalischen und chemischen Gesetzen; nach allem, was wir heute
wissen, ist das Leben Chemie. Lebewesen als sich dauerhaft
selbsterhaltende Systeme sind aufgrund des zweiten Hauptsatzes der
Thermodynamik auf eine dauerhafte Zufuhr von Energie angewiesen –
und fähig, sich selbst aktiv mit Energie zu versorgen. Wir wissen
nicht, wie (und wo) das Leben entstanden ist. Überlegungen gehen
dahin, dass Protonengradienten in alkalinen hydrothermalen
Tiefseequellen am Anfang stehen könnten; diese und dort
vorkommende Eisen-(Nickel-)Schwefel-Mineralien hätten demnach die
Entstehung organischer Moleküle angetrieben bzw. katalysiert, die
sich dort angereichert und schließlich erste Protozellen mit einer
Fettsäuremembran und Enzymen gebildet hätten. Ribonukleinsäuren,
die ebenfalls als Katalysatoren wirken, könnten als "Erbmolekül"
die so entstandenen Strukturen festgehalten und der biologischen
Evolution ausgesetzt haben. Mit der Erfindung von Protonenpumpen und
undurchlässigen Membranen könnten die Protozellen sich von dem
natürlichen Protonengradienten unabhängig gemacht und den freien
Ozean besiedeln haben. Wenn dieses auch nur (plausible)
Spekulationen sind, sicher ist: Seit über drei Milliarden Jahren
gibt es Leben auf der Erde.