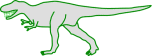Das Leben
Der Weg
zur Vielfalt des Lebens:
Die Evolution
Die Evolutionstheorie besagt, dass die ganze
Vielfalt des Lebens durch allmähliche Veränderungen und Artbildungen
aus einem ursprünglichen Lebewesen hervorgegangen ist. Zahlreiche
Belege aus den unterschiedlichsten Gebieten zeigen, dass die
Evolution eine Tatsache ist, und der von Charles Darwin entdeckte
Prozess der natürlichen Auslese ihre wichtigste Antriebskraft.

Radschlagender Pfau:
Pfauenhähne müssen schön sein, sonst haben sie keine Chance bei den
Hennen – auch die “sexuelle Auslese” (>> hier)
trägt zur Evolution bei. Foto: “BS Thurner Hof”, aus >> wikipedia,
Lizenz: >> cc
3.0.
Die Evolutionstheorie geht auf die bahnbrechenden Entdeckungen
Charles Darwins (>> hier)
zurück und wurde durch Theodosius Dobzhansky, Ernst
Mayr und anderen durch die Einarbeitung der nach Darwin
gewonnenen Erkenntnisse der modernen Genetik zur heutigen
“synthetischen Evolutionstheorie” weiterentwickelt: Durch Mutationen
(und weitere Mechanismen wie die Durchmischung des Erbmaterials bei
der sexuellen Fortpflanzung,
“genetische Drift” und Wanderungen) entstehen Unterschiede in den
Merkmalen der Lebewesen (“Variabilität
des Phänotyps”), auf die die natürliche Selektion
wirkt. Genetische Veränderungen, die die Fähigkeit ihrer Träger zur
Vermehrung erhöhen, werden sich auf Dauer durchsetzen; und da die
Fähigkeit zur Vermehrung von einer besseren Anpassung an die Umwelt
abhängt, wird diese Art der Auslese zu einer immer besseren
Anpassung von Arten an die Umwelt führen. Wenn etwa die Umwelt
abkühlt, werden Tiere mit dichtem Haarkleid länger leben – und
dadurch größere Chancen haben, sich zu vermehren, wodurch im Laufe
der Zeit das Haarkleid dieser Art immer dichter wird – solange, bis
eine weitere Verdichtung keine Vorteile mehr bietet. Die natürliche
Selektion wirkt also auf den Genpool (die Gesamtheit der Gene einer
Population) ein: Gene, die zur Ausprägung begünstigter Merkmale
führen, werden häufiger; Gene, die ungünstige Merkmale verursachen,
werden seltener verschwinden schließlich ganz. Die heute lebenden
Arten gab es also nicht immer, sie sind aus Vorgängerarten
entstanden. Die Vorgänger des Menschen etwa waren Arten, die
affenartig waren (aber nicht die heutigen Affen, die sich ebenfalls
weiterentwickelt haben; >> mehr).
Diese Veränderungen erfolgen allmählich, aus
einem Reptilienei schlüpfte nicht etwa plötzlich ein Vogel, sondern
die Vögel haben sich durch zahlreiche Entwicklungsschritte aus den
Reptilien entwickelt. (Die Geschwindigkeit dieser Veränderungen ist
von Art zu Art unterschiedlich: Veränderungen in der Umwelt können
die Evolution beschleunigen, in einer stabilen Umwelt kann eine Art
auch sehr lange scheinbar unverändert bleiben, wie die sogenannten
“lebenden Fossilien”). Über die unvorstellbar langen Zeiträume
(Biologen sprechen auch von "Tiefenzeit"), in denen die Evolution
stattfand, konnten aber dennoch große Veränderungen entstehen: die
gesamte Vielfalt des Lebens auf der Erde ist so entstanden.
Beigetragen dazu hat, dass es durch die Veränderungen zur
Artbildung kommen kann: Zwischen den Abkömmlingen einer
Art wird der genetische Austausch unterbunden (sei es, dass sie
genetisch unverträglich werden, sei es, dass sie unterschiedliche
Lebensräume besiedeln), so dass sie fortan unterschiedliche Wege
gehen. Dadurch sind aus einer zwei Arten entstanden, und die
oftmalige Wiederholung dieses Vorgangs führte zur heutigen
Artenvielfalt. Alle heutigen Arten gehen also auf einen gemeinsamen
Vorfahren zurück, und dies erklärt, warum alle heutigen
Lebewesen einen gemeinsamen genetische Code und einheitliche
biochemische Vorgänge der Energiegewinnung besitzen – es sind die
jenes gemeinsamen Vorfahrens.
Inzwischen sind die Belege für die Evolution derart zahlreich, dass
sie unter Naturwissenschaftlern als Tatsache gilt (siehe auch
>>
hier). Für die Evolution sprechen Befunde aus den
unterschiedlichsten Gebieten der Biologie.
Die Belege für die Evolution
Fossilienfunde (>> mehr)
sind der vielleicht wichtigste Beleg für die Evolution: In den
ältesten Gesteinen finden sich einfache Lebensformen, in jüngeren
Gesteinen werden sie allmählich immer komplexer. Die jüngsten
Fossilien ähneln den heutigen Lebensformen am meisten. Aus den Daten
der Fossilien lässt sich die Entfaltung des Lebens nachvollziehen
(Übersicht >> hier,
Beschreibung >>
hier); an Fossilien lassen sich evolutionäre Veränderungen
einer Art und die Entstehung neuer Arten nachvollziehen. Besonders
eindrucksvoll gelingt dies bei mikroskopischem Plankton aus dem
Meer: Durch die große Anzahl von Individuen und die Ablagerung
abgestorbener Individuen im Meeressediment kann die Entwicklung
oftmals über Millionen Jahre verfolgt werden. Aber auch bei größeren
Lebewesen konnten in einigen Fällen Abstammungslinien bemerkenswert
vollständig in fossilen Reihen abgebildet werden, etwa die von den
Fischen zu den Amphibien (>> mehr),
von den Reptilien zu den Säugetieren (>> mehr),
die von den Huftieren zu den Walen oder die Geschichte des Pferdes.
Ein Beispiel ist auch die Evolutionsgeschichte des Menschen
(>> mehr).
Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus Fossilienfunden ist, das neue
Strukturen in der Regel aus bereits bestehenden Strukturen
abgeleitet werden, so sind etwa die Beine der Säugetiere nicht
anderes als umgebildete Fischflossen oder die Flügel der Vögel aus
den Vorderbeinen der Dinosaurier entstanden.
Die Evolution liefert damit
eine Erklärung für etwas, das die Biologen schon zuvor als Homologie
beschrieben hatten – sich entsprechende Strukturen bei verschiedenen
Organismen: Die Flügel von Vögeln und die Vorderbeine der Säugetiere
ähneln sich, da beide aus den Vorderbeinen der Dinosaurier
hervorgingen, und diese aus den Knochenansätzen der Fischflossen.
Die Entwicklung neuer Strukturen auf Basis der bestehenden ist auch
die einzige sinnvolle Erklärung eine Reihe anderer Erscheinungen:
Das Auftreten von Rudimenten, Strukturen, die im Laufe der Evolution
ihre ursprüngliche Funktion verloren haben, oder von Atavismen, dem
gelegentlichen Auftreten von Merkmalen oder Eigenschaften, die im
Laufe der Evolution eigentlich längst verloren gegangen sind.
Bekannte Beispiele für Rudimente sind das
menschliche Steißbein, ein Überbleibsel des Schwanzes der
Säugetiere, oder der Blinddarm, der Rest eines Darmanhangs.
Bestehende Strukturen werden zurückgebildet, da ihr Erhalt unnötig
Energie kostet, wenn ihre Funktion wegfällt – so verloren Vögel auf
Inseln, auf denen keine Raubtiere leben und Nahrung leicht zu finden
ist, oftmals die Funktionsfähigkeit ihrer Flügel. Mitunter bekommen
solche Strukturen auch neue Funktionen, so wurden die Flügel der
Pinguine zu Flossen, mit deren Hilfe sie zu ausgezeichneten
Schwimmer wurden. Atavismen, etwa das
gelegentlich vorkommende Auswachsen des Steißbeins zu einem echten
Schwanz oder die Bildung mehrerer Zehen bei Pferden (der Huf ist aus
einem ursprünglich fünfzehigen Vorfahren entstanden), zeigten den
Biologen, dass die Gene für überflüssig gewordene Merkmale nicht aus
den Erbanlagen entfernt werden, sondern nur abgeschaltet werden;
Atavismen entstehen, wenn sie aus irgendeinem Grund wieder aktiviert
werden. Moderne genetische Untersuchungen bestätigten, dass etwa
der Mensch mehrere tausend abgeschaltete Gene
besitzt. So besitzen wir etwa wie alle Primaten ein abgeschaltetes
Gen zur Herstellung eines Enzyms, mit dem wir Vitamin C herstellen
könnten: Offenbar hat ein gemeinsamer Vorfahre aller Primaten diese
Fähigkeit verloren, und wurde aufgrund seiner Vitamin-C-reichen
Ernährung hierfür nicht bestraft – auch abgeschaltete Gene wären
ohne Evolution nur schwer zu erklären.
Die Evolution erklärt auch ein altes Rätsel, das den Biologen vor
Darwin großes Kopfzerbrechen machte: Das Auftauchen und
spätere Verschwinden von Strukturen in der Embryonalentwicklung.
So bilden die Embryonen von Säugetieren Kiemenbögen und einen
fischartigen Schwanz aus, die später wieder verschwinden;
menschliche Embryos sind ab dem sechsten Monat bis etwa einen Monat
vor der Geburt dicht behaart. Inzwischen konnten zahlreiche
Entwicklungen detailliert nachvollzogen werden – ein
Schulbuchbeispiel ist etwa die Entstehung der Gehörknöchelchen
Hammer und Amboss aus dem 1. Kiemenbogen und des Steigbügels aus
dem 2. Kiemenbogen der Fische (über einen “Umweg” von Hammer und
Amboss als Knochen im Unterkiefer von Reptilien und des Steigbügels
als Knochen im Oberkiefer der Fische und Amphibien). Die
Strukturentwicklung im Embryo vollzieht ansatzweise diese
Evolutionsgeschichte nach. Offensichtlich ist ein Teil des
genetischen “Entwicklungsprogramms” unserer Vorfahren noch in uns
aktiv; manche der in der Evolutionsgeschichte umgebildeten
Strukturen müssen sich im Individuum vermutlich erst einmal
ausbilden, bevor sie umgebildet werden können. Die
Embryonalentwicklung und die große Ähnlichkeit bei
Embryonen verwandter Tiergruppen (siehe >> hier)
sind dann sinnvoll zu erklären, wenn man um die Ableitung neuer
Strukturen aus alten Strukturen in der Evolutionsgeschichte weiß,
und daher ebenfalls ein Beleg für die Evolution.
DDie Entstehung neuer aus alten Strukturen beschränkt aber auch die
Möglichkeiten der Evolution und führt zu zahlreichen Kompromissen
(und ist ein Widerspruch zur Vermutung eines “intelligenten
Designs”): Eine S-förmige Wirbelsäule mit Bandscheiben oder unser
Kniegelenk etwa kann man erklären, wenn ein weiß, dass sich hier ein
vierbeiniges Wirbeltier aufgerichtet hat; häufige
Bandscheibenvorfälle und häufige Schäden an Innenmeniskus, Innenband
oder vorderem Kreuzband im Knie zeigen aber, dass sie nicht
“perfekt” sind. Mit der Evolution kann man auch Probleme wie
Schluckauf (eine Folge der Kiemenatmung von Kaulquappen),
Verschlucken (eine Folge der Mundhöhle, die gleichzeitig zum
Sprechen, Schlucken und Atmen dient) und Schlafapnöe (auch eine
Folge der Sprache: der flexible Rachen kann im Schlaf die Luftwege
blockieren) erklären, bei einem “intelligenten Designer” müsste man
aber von Konstruktionsfehlern sprechen.
Schon Charles Darwin war von der geografischen Verbreitung
von Pflanzen und Tieren wesentlich zu seiner Theorie
angeregt worden; im Zusammenspiel mit den seither gewonnen
Erkenntnissen insbesondere zur >>
Plattentektonik ist die Evolution die beste Erklärung für
biogeographische Fragen. Sie erklärt sowohl die Unterschiede – warum
sind sowohl Flora (Eukalyptuswälder ...) als auch Fauna (Beuteltiere
...) von Australien so anders als im Rest der Welt? Weil Australien
sich als erstes von den übrigen Kontinenten abgetrennt hat -, als
auch die Ähnlichkeiten – warum ist die Tierwelt von Nordamerika und
Europa sich ähnlicher als die von Südamerika und Afrika? Weil
letztere schon seit 80 Millionen Jahren voneinander getrennt sind,
erstere aber vor 40 Millionen Jahren durch eine breite Landbrücke
verbunden waren. Interessant ist auch die Frage, wie es kommt, dass
unterschiedliche Arten sich sehr ähnlich entwickeln können, so dass
etwa die Kakteen aus Nord- und Südamerika für den Laien kaum von den
sehr ähnlichen Wolfsmilchgewächsen aus der alten Welt zu
unterscheiden sind oder viele Beuteltiere in Australien den
Säugetieren anderswo ähneln? Die Evolution liefert eine Antwort: Die
Arten waren einer sehr ähnlichen natürlichen Auslese ausgesetzt, die
letztlich zu sehr ähnlichen Ergebnissen führte. Biologen nennen
dieses “konvergente Evolution”. (Aber warum sollte
ein Schöpfer sich die Arbeit machen, zwei unterschiedliche, aber
sehr ähnliche Arten mit sehr ähnlichen ökologischen Vorlieben zu
schaffen?). Einen weiteren Beleg für die Evolution liefert die Tier-
und Pflanzenwelt von ozeanischen Inseln: Auf vielen solcher weit
abgeschiedenen, niemals mit einem Kontinent verbundenen Inseln wie
Hawaii, Galapagos oder Tahiti findet man zahlreiche, oftmals
endemische Pflanzen, Vögel und Insekten, aber keine
Süßwasserfische, Amphibien, Reptilien oder Säugetiere. An
ungeeigneten Lebensräumen kann dies nicht liegen, wie die
erfolgreiche Ansiedlung all dieser Gruppen durch den Menschen zeigt.
Der Unterschied: Pflanzensamen, Vögel und Insekten verbreiten sich
durch die Luft; Süßwasserfische, Amphibien, Reptilien oder
Säugetiere nicht. Sie haben (bevor der Mensch sie dorthin brachte)
diese Inseln schlichtweg nie erreicht. (Aber warum sollte ein
Schöpfer etwa darauf verzichtet haben, Tahiti mit Süßwasserfischen
auszustatten?) Eine ähnlich interessante Entwicklung findet man auf
Inseln, die schon sehr lange vom Festland abgetrennt sind: So konnte
sich etwa auf Madagaskar eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt
entwickeln, die etwa 37 Arten von Lemuren umfasst, eine Tiergruppe,
die anderswo nicht vorkommt (eine solche Aufspaltung einer
ursprünglichen Art in zahlreiche neue Arten nennen die Biologen
“adaptive Radiation” (etwa: Auffächerung als Folge von Anpassungen).
Im Übrigen ähnelt die Tier- und Pflanzenwelt von Inseln immer am
stärksten der der benachbarten Kontinente. Warum? Weil sie von
diesen aus besiedelt wurden, und sich dann dort weiterentwickelt
hat. Ein Beispiel sind die berühmten Darwinfinken; die von Darwin
nur vermutete Verwandtschaft der Finken auf den Galapagos-Inseln
konnte übrigens mit molekularbiologischen Techniken inzwischen
nachgewiesen werden – ebenso ihre Abstammung von dem auf der
Kokos-Insel verbreiteten Kokosfinken.
Ohnehin sind es in letzter Zeit molekulargenetische Belege,
die die Evolution weiter untermauern: Moleküle, etwa Proteine oder
die DNS der Gene, machen wie die
Körperstrukturen eine Evolution durch. Je enger zwei Lebewesen
verwandt sind, desto ähnlicher sind sich ihre Moleküle (und
natürlich ist das universelle Vorkommen der DNS in allen Lebewesen
der beste Beleg für Darwins Idee der gemeinsamen Abstammung).
Molekulargenetischen Untersuchungen konnten viele paläontologische
und morphologisch-anatomische Erkenntnisse bestätigen, und zudem
dort Antworten liefern, wo die klassischen Methoden keine
eindeutigen Erkenntnisse brachten. Ebenso wichtig: viele Moleküle
wandeln sich mit ziemlich konstanter Geschwindigkeit und können
damit – an gut datierten Fossilien geeicht – als
molekulare Uhren dienen, mit denen sich evolutionsbiologische
Ereignisse datieren lassen. So konnte z.B. gezeigt werden, dass sich
Schimpansen und Menschen vor fünf bis acht Millionen Jahren aus
einem gemeinsamen Vorfahren entwickelten (>>
Der Mensch)).
Die natürliche Auslese
Die Idee einer Evolution gab es schon vor Darwin, seine wahrhaft
neue Idee war die der natürlichen Auslese (auch
“natürliche Selektion”) – ein unbewusster Prozess, über den äußere
Faktoren der Umwelt auf den Fortpflanzungserfolg von Individuen
einer Art einwirken und diese so verändern, dass sie sich im Laufe
der Zeit immer besser an die Umwelt anpassen. Dieser Prozess
ersetzte in der Evolution den Schöpfer, der zuvor die einzige
vorstellbare Ursache der in der Natur zu beobachtenden Anpassung an
die Umwelt war; und er ist bis heute bei vielen Laien
missverstanden. Wie kann eine solche Auslese dazu führen, dass es
Tiere gibt, die Pflanzen ähneln (etwa Heuschrecken, die einem Blatt
ähneln) oder Pflanzen, die Tiere ähneln (etwa die Orchideen, deren
Blüten wie Insekten aussehen)?
Für die natürliche Auslese gibt es drei Voraussetzungen: Die
Individuen einer Art müssen sich voneinander unterscheiden,
die Unterschiede müssen vererbbar sein und die
genetischen Unterschiede müssen sich auf den Fortpflanzungserfolg
auswirken. Darwin glaubte an die natürliche Auslese durch die
beeindruckenden Erfolge der künstlichen Auslese bei der Tierzucht,
heute kann sie direkt nachgewiesen werden: An der Golfküste von
Florida leben helle Strandmäuse. Dass dies eine Anpassung ist, lässt
sich zeigen im Versuch zeigen: Auf dem Sandboden werden dunkle Mäuse
öfter von Raubvögeln gefressen als helle Mäuse. Das wirkt sich auf
den Fortpflanzungserfolg aus, da viele dunkle Mäuse vor der
Geschlechtsreife gefressen werden; und der Unterschied ist
vererbbar, er geht auf den Austausch eines einzigen Basenpaars in
der Mäuse-DNS zurück – die Strandmäuse sind also ein Ergebnis der
natürlichen Auslese (siehe auch >> hier).
Die natürliche Auslese ist auch kein zufälliger Prozess: Zufällig
sind nur die ihr zugrundeliegenden genetischen Mutationen – etwa
diejenige, die zum Austausch des Basenpaars bei den Strandmäusen
führte -; die davon verursachten Unterschiede werden dann aber nach
ihrem Anpassungswert “ausgelesen”: Individuen, die besser an ihre
Umwelt angepasst sind, haben Vorteile.
Am leichtesten lässt sich die natürliche Auslese dort nachweisen,
wo Generationen schnell hintereinander vorkommen, etwa bei
Bakterien: Der amerikanische Bakteriologe Richard Lenski und seine
Mitarbeiter untersuchen seit 1988 das Darmbakterium Escherichia
coli, aufgrund der schnellen Generationenfolge (sechs bis sieben pro
Tag) sind sie inzwischen bei 45.000 Generationen angelangt und
konnten unter anderem die Entstehung ganz neuer Stoffwechselwege
nachweisen (die Veröffentlichungen über die Ergebnisse sind unter
http://myxo.css.msu.edu/cgi-bin/lenski/prefman.pl?group=aad
abzurufen). Die Evolution der Bakterien geht nicht nur im Labor
schnell, sondern auch in der Natur: Sie ist eine Ursache für die
schnelle Anpassung von Bakterien an Antibiotika oder Penicillin, die
diese Wunderwaffen der Medizin gut 60 Jahre nach ihrer Einführung
schon wieder stumpf zu machen droht.
Bei größeren Tierarten ist die natürliche Auslese aufgrund der
langen Generationen naturgemäß schwerer zu zeigen: Der
amerikanische Evolutionsbiologe John Endler konnte aber auch bei
Guppies zeigen, dass Männchen bei Anwesenheit von für sie
gefährlichen Raubfischen im Laufe der Zeit immer besser getarnt, bei
deren Abwesenheiten aber immer bunter (was die Weibchen anlockt)
werden. Und Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Schnabelgröße
des Mittel-Grundfinken (Geospiza fortis), eines der Darwinfinken,
sich selbst zwischen trockenen und feuchten Jahren verändert; die
Anpassung an die Umwelt also messbare Auswirkungen hat. (Besonders
spannend für Biologen ist aber, dass das gleiche Gen bei
verschiedenen Tierarten ähnliche, aber unterschiedliche Auswirkungen
haben kann: So bewirkt ein BMP4 genanntes Gen, dass beim
Groß-Grundfink (Geospiza magnirostris, ebenfalls ein Darwinfink) der
Schnabel zu seiner großen Größe heranwächst, mit dem der Fink große
Samen und Nüsse öffnen kann. Das gleiche Gen gewirkt bei
Buntbarschen im afrikanischen Victoriasee die Ausbildung kräftiger
Kiefer, mit denen diese Muschelschalen öffnen. Genauso wird die
Entwicklung von Fischflossen, Vogelflügeln und menschlichen Armen
von demselben Gen gesteuert, und spielt das menschliche “Sprachgen”
FOXP2 eine entscheidende Rolle auch beim Gesang von Finken. Solche
Gene, die sich durch die gesamte Tierwelt wiederfinden, belegen
Darwins Theorie von der gemeinsamen Abstammung.) Die Veränderungen
bei Guppies und Darwinfinken sind zwar klein – in der
Evolutionsgeschichte stand millionenfach mehr Zeit zur Verfügung –
belegen aber, dass die natürliche Auslese tatsächlich wirksam ist.
Im Laufe der Zeit können so sehr komplexe Strukturen, etwa das
sprichwörtliche Adlerauge, entstehen (siehe auch >> hier)).
Auch hier hatte schon Darwin erkannt, und zeigte, dass weniger
komplexe Augen einen möglichen Entstehungsweg aufzeigten: Er
verläuft über lichtempfindliche Hautsegmente (wie bei Plattwürmern
zu finden), über Einbuchtungen dieses Hautsegments (schützt die
lichtempfindlichen Hautsegmente und erleichtert die Bestimmung der
Einfallsrichtung des Lichtes, bei manchen Schnecken zu finden) und
Linsenbildung (Konzentration des Lichtes, bei Meeresschnecken) hin
zum Auge der Säugetiere. Jeder dieser Zwischenstufen hatte für sich
einen Anpassungsvorteil (eine der wichtigsten Konsequenzen der
Evolution, die ja kein “Endziel” kennt, für das zwischendurch Opfer
in Kauf zu nehmen wären.). Die Evolution anderer komplexer
Strukturen muss noch erklärt werden, aber unsere Unwissenheit ist
kein Argument, dass es sie nicht gegeben haben kann, wie die
Anhänger des “intelligenten Designs” glauben: Für
Naturwissenschaftler ist diese Behauptung eine Aufforderung, “die
Hände in den Schoß zu legen, wenn offenkundig ist, dass noch eine
Menge zu tun ist” (Nathalie Angier) und eine Verarmung des
wirklichen Geschehens, das auf nachvollziehbarem Weg zu den
phantastischsten Ergebnissen führt. Sie sind “schlicht ein Zeichen
intellektueller Faulheit” (ein treffender Ausdruck Richard
Dawkins’).
“Intelligentes
Design”
Die Hauptaussage der Evolution – dass die Vielfalt der Lebewesen
auf der Erde als Ergebnis natürlicher Prozesse entstanden ist – ist
nicht nur zu Zeiten Darwins auf Skepsis gestoßen; religiöse
Fundamentalisten fordern immer noch, die biblische Version einer
göttlichen Schöpfung anstelle der Evolution in den Schulen zu
lehren. Die Mehrheit der Christen kann mit der Evolution leben, sie
hat seit der Aufklärung gelernt, dass die Heilige Schrift kein
Tatsachenbericht, sondern im übertragenen Sinne zu verstehen ist.
Auch viele Naturwissenschaftler sind gläubig: Sie glauben daran,
dass Gott die Welt geschaffen hat – und sich in den
Gesetzmäßigkeiten der Natur offenbart. Während sich die
Naturgesetze mit wissenschaftlichen Methoden erforschen lassen, ist
die Frage nach Gott Glaubenssache; Glauben und Wissen müssen sich
also nicht ausschließen.
Man kann aber einen Gegensatz konstruieren: In einigen
US-Bundesstaaten war es über Jahrzehnte verboten, in Schulen eine
“Theorie zu lehren, die der biblischen Geschichte der göttlichen
Schöpfung des Menschen widerspricht” (so die Formulierung in
Tennessee), und daher glauben heute viele Amerikaner, Gott habe den
Menschen in der jetzigen Form geschaffen. Inzwischen sind diese
Verbote zwar abgeschafft, aber dafür stellen Bibelfundamentalisten
der Evolutionstheorie jetzt eine angeblich naturwissenschaftliche
Theorie vom “Intelligenten Design” gegenüber und fordern, dass sie
an Schulen gelehrt wird. Wissenschaftlich kann diese “Theorie” nicht
bestehen, sie besteht vor allem aus Auslassungen und Fehldeutungen
– siehe etwa die fachliche Analyse in der Aussage des
Biologieprofessors Kevin Padian anlässlich des Falles “Kitzmiller
vs. Dover School Area District” >>
hier (englischsprachig), einer der vielen gerichtlichen
Auseinandersetzungen in den USA zum Thema [ein umfassender Überblick
über diese findet sich auf einer (englischsprachigen) Website des
>> National Center for
Science Education].
Die Frage nach einem göttlichen Schöpfer wird
natürlich nicht schon von naturwissenschaftlich fehlerhaft
argumentierenden Unterstützern widerlegt; aber der Glaube an die
Erschaffung der Arten durch einen perfekten Schöpfer wirft einige
Fragen auf, die schon Darwin stellte: Warum etwa hat ein Wal
verkümmerte Handknochen? Wenn man annimmt, dass Wale vom Land ins
Wasser gegangen sind, kann man die Handknochen als Reste ihres
früheren Lebens verstehen, aber warum sollte Gott einen Wal mit
Handknochen versehen? (In diesem Sinne würden einem schon beim
Menschen noch viele weitere Fragen einfallen: nach dem Bau von
Wirbelsäule, Knie (>> hier)
und Leistenkanal etwa, die erklärbar sind, wenn man die
Evolutionsgeschichte ansieht, aber kaum für einen perfekten Schöpfer
sprechen; ebenso wenig wie Schluckauf (eine Spätfolge der
Kiemenatmung von Kaulquappen), Verschlucken (eine Folge der
Mundhöhle, die gleichzeitig zum Sprechen, Schlucken und Atmen dient)
und Schlafapnöe (auch eine Folge der Sprache: der flexible Rachen
kann im Schlaf die Luftwege blockieren). Darwin fragte sich auch,
warum der Schöpfer so hervorragend angepasste Tiere wie Kamele nicht
in alle Wüsten gesetzt hat, und warum mausähnliche Tiere in
Australien eher mit den Kängurus als mit den Mäusen anderswo
verwandt sind. Darwins Theorie konnte hierauf Antworten geben, darum
hat sie sich durchgesetzt. Das Arten sich verändern, ist eine
Tatsache; eine wörtliche Auslegung der Bibel steht mit unserem
Wissen im Widerspruch.
Vermutlich ist aber ohnehin nicht die sachliche Begründung eines
“intelligenten Designs” entscheidend für seine Anhänger, sondern ein
moralisches Unwohlsein: Wenn wir nicht von einem göttlichen Schöpfer
geschaffen wurden, sondern ein Produkt der “egoistischen” Evolution
sind, welche Begründung gibt es dann noch für moralisches Verhalten?
Wenn wir Tiere sind, warum sollen wir uns dann nicht wie welche
verhalten? Zu diesem Unwohlsein tragen Buchtitel wie “Das
egoistische Gen” noch bei – wobei die meisten, die dieses Buch als
Beleg anführen, es kaum gelesen haben dürften. Der Autor, Richard
Dawkins, zeigt in dem Buch nämlich nur, dass Gene, die zu besseren
Anpassungen führen, sich auf Kosten weniger vorteilhafter Gene
durchsetzen, sich also so verhalten, als ob sie egoistisch wären.
Egoistische Gene können aber auch zu uneigennützigem Verhalten
führen, wenn dies die bessere Anpassung ist. Und tatsächlich ist
das, was zur Sonderrolle des Menschen geführt hat, unsere
Kooperationsfähigkeit (>> hier).
Ohnehin ist längst der größte Teil des menschlichen Verhaltens
nicht evolutionär, sondern kulturell bedingt, und sowohl
unmoralisches als auch moralisches Verhalten können sowohl religiös
als auch weltlich begründet sein. Aber zu Zeiten der Römer galt es
noch als angenehme Unterhaltung, zuzusehen, wie Mitmenschen von
wilden Tieren zerfleischt wurden; heute würde dies wohl überall auf
der Welt als barbarisch angesehen. Wir können uns also ändern, und
die Anerkennung der Evolution bedeutet nicht, dass wir hilflos einem
(ohnehin zu Unrecht befürchteten) genetischen Gesetz des Dschungels
ausgeliefert wären.
Die Richtung der natürlichen Auslese wird, wie Darwin richtig
erkannt hatte, von der Umwelt eines Lebewesens bestimmt. Die
entscheidenden Faktoren können dabei sowohl aus der unbelebten
Umwelt (etwa Klimafaktoren) oder von anderen Lebewesen verursacht
sein – kurz: Das gesamte Ökosystem (>>
mehr) beeinflusst die natürliche Auslese. Da aber Ökosysteme
sich voneinander unterscheiden, wirken auf die Lebewesen
verschiedener Ökosysteme unterschiedliche Faktoren ein, die zu
geographischer Variabilität führt – einem wichtigen Faktor für die
Entstehung neuer Arten.
Sexuelle Auslese
Zu den wichtigsten Faktoren der Umwelt, die sich auf den
Fortpflanzungserfolg auswirken, gehören mögliche Geschlechtspartner.
Sie sind so wichtig, dass sie mitunter Ergebnisse hervorbringen, die
auf dem ersten Blick widersinnig scheinen. Ein klassisches Beispiel,
das schon Charles Darwin beschäftigte, ist die prächtige Schleppe
der Pfauenhähne. Es gibt kaum etwas Schöneres in der Natur als einen
Pfau, der bei der Balz ein Rad schlägt (>> Foto);
aber die Schleppe behindert den Pfau beim Fliegen erheblich. Warum
gibt es sie dennoch? Die Antwort ist die sexuelle Auslese: In
Versuchen konnte gezeigt werden, dass Pfauenhähne Hennen Hähne
bevorzugen, die bei der Balz das größte Rad schlagen, und sich damit
dessen Fortpflanzungschancen erhöhen. Ähnliches gilt für viele
andere Tierarten, bei denen die Männchen auffällige Merkmale haben:
Immer werden diese von den Weibchen bevorzugt, oder erhöhen auf
andere Weise die Chance, zur Fortpflanzung zu kommen (etwa das große
Geweih beim Hirschen, mit dem dieser Rivalen aus dem Feld schlägt).
Solche auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern nennen
Biologen “sexuellen Dimorphismus”, und fast immer sind dabei die
Männchen schöner oder größer. Biologen erklären dies mit den
unterschiedlichen Reproduktionsstrategien: Während Weibchen mit
einer begrenzten Zahl von Eizellen und erheblicher Arbeit bei der
Aufzucht des Nachwuchses wählerisch bei der Auswahl des Partners
sein müssen, verfügen die Männchen über derartig viele Spermien und
verschwinden oft nach der Befruchtung wieder, so dass einfach
möglichst viele Weibchen befruchten können und keine Mühe auf die
Auswahl verschwenden müssen. Wenn Weibchen und Männchen hingegen
ihren Nachwuchs gemeinsam aufziehen, gibt es oftmals keine
auffälligen Unterscheide zwischen Männchen und Weibchen. (Und wenn
doch, liegt dies daran, dass die Partner oft “fremdgehen”, wie
genetische Untersuchungen zeigten.) In Einzelfällen sind auch die
Weibchen schöner, etwa bei den Seepferdchen: Hier ziehen die
männlichen Partner die Jungen auf; sind also diejenigen, die mehr in
die Aufzucht investieren und also die Partnerinnen sorgfältig
auswählen sollten – die Ausnahme bestätigt also die Theorie.
Warum aber suchen die (meist) Weibchen ihre Partner nach Schönheit
aus? Hat dieses Verhalten einen Anpassungswert? Ja, glauben viele
Evolutionsbiologen. Wenn etwa ein Pfau eine besonders prächtige
Schleppe hat und trotzdem ins geschlechtsreife Alter kommt, muss er
besonders gute Gene haben – über den Umweg über die Schleppe erkennt
die Henne also die “Genqualität” ihres künftigen Partners. Hennen,
die Hähne bevorzugten, die ein schönes Rad schlagen, wurden in der
Evolution also belohnt, da diese Hähne zugleich bessere Gene hatten.
Am Beispiel des im Osten der USA lebenden Grauen Laubfrosches
konnten Biologen zeigen, dass tatsächlich die Männchen, die länger
rufen (und von den Weibchen bevorzugt werden) bessere Gene besitzen
– sie überlebten als Kaulquappen deutlich besser und brachten mehr
Nachwuchs hervor. Und auch Jungpfauen von Vätern mit langer Schleppe
überleben besser. In anderen Fällen gelang ein solcher Nachweis aber
nicht, und manchmal ist die sexuelle Auslese möglicherweise einfach
ein Ergebnis ganz anderer Vorteile: Wenn eine Tierart etwa rot mag
– was sich entwickeln kann, weil reife Beeren oft rot sind -,
bevorzugen Weibchen möglicherweise auch rot gefärbte Männchen. Bei
australischen Grasfinken erhöhte jedenfalls auch ein künstlich
angebrachter weißer Hahnenkamm den Fortpflanzungserfolg der Männchen
– es kann also nicht ein verstecktes Zeichen für bessere Gene sein,
das die Weibchen hierzu brachte, sondern eine aus einem anderen
Grund bestehende Vorliebe.
Manche Forscher vermuten, dass auch bei der Entwicklung des
Menschen die sexuelle Selektion eine Rolle gespielt habe: Der
aufrechte Gang könnte demnach dadurch entstanden sein, dass unsere
weiblichen Vorfahren Männchen bevorzugten, die besonders gut
aufrecht gehen konnten; und auch das Größenwachstum des Gehirns sei
dadurch beschleunigt worden, dass die Fähigkeiten des Gehirns die
Weibchen beeindruckt hätten. Die bevorzugten Merkmale hätten sich in
größerem Fortpflanzungserfolg ihrer Träger ausgewirkt, und sich so
letztendlich durchgesetzt. Daneben gibt es eine Vielzahl von
Theorien, die eine Anpassung an die Umwelt als treibende Kraft für
aufrechten Gang und Gehirnwachstum sehen (>> mehr);
wie groß welcher Einfluss tatsächlich war, wird noch intensiv
diskutiert.
Die Entstehung neuer Arten
Die Frage, wie neue Arten
entstehen, konnte Darwin mit dem Wissen zu seiner Zeit noch nicht
wirklich beantworten. Da die Art als die Gruppe definiert ist, deren
Individuen fruchtbare Nachkommen miteinander haben können, stellen
die Mitglieder einer Art eine Reproduktionsgemeinschaft dar. Neue
Merkmale, die etwa durch eine Mutation entstanden sind, können sich
innerhalb einer Art ausbreiten. Insofern ist die Art auch die
Einheit der Evolution. Neue Arten entstehen, wenn die
Reproduktionsgemeinschaft geteilt wird, also etwas die Fortpflanzung
von einem Teil der Gruppe mit einem anderen wirksam verhindert.
Einen ersten Hinweis auf mögliche Mechanismen lieferten ähnliche
Arten, die räumlich getrennt waren. Wenn die Vorkommen einer Art
räumlich getrennt sind (wie etwa die Spottdrosseln auf Galapagos),
lernten die Biologen, kann die natürliche Auslese jeweils in
verschiedene Richtungen führen und schließlich auch die gemeinsame
Fortpflanzung unmöglich machen: Im Laufe der Zeit können so
verschiedene Arten entstehen (wie von Darwin auf den
Galapagos-Inseln entdeckt). Die Biologen nennen diesen Vorgang, den
wichtigsten bei der Entstehung neuer Arten, geographische
Artbildung. Die geographische Artbildung verknüpft die
Entstehung der Artenvielfalt auf der Erde eng mit der
Naturgeschichte derselben: Die Trennung von Kontinenten, die
Entstehung von Gebirgen, von Gletschern, von Wüsten etc. isolierte
Teile einer Art von anderen Teilen und führten im Laufe der Zeit zu
den heutigen vielen Millionen Arten. Sie erklärt auch das häufige
Vorkommen endemischer Arten auf abgelegenen Inseln – ist eine Art
erst einmal dort angekommen, war sie in der Regel isoliert vom Rest
der Art.
Aber die räumliche Trennung ist nicht die einzige Möglichkeit, in
verschiedenen Umwelten zu leben: Arten können auch durch Anpassung
an verschiedene ökologische Nischen (>>
mehr) entstehen – Tiere, die sich zufällig in bestimmten
Merkmalen von ihren Konkurrenten unterscheiden und dadurch andere
Ressourcen nutzten können, gedeihen genauso gut wie die
ursprüngliche Art, wodurch sich auf Dauer verwandte Linien
auseinanderentwickeln können. Dieser Vorgang scheint bei Tieren sehr
selten zu sein, da gemeinsame Nachkommen die Unterschiede immer
wieder verwischen. Bei Pflanzen kommt die “sympatrische
Artbildung” (so der Fachausdruck für die Entstehung neuer
Arten ohne geographische Trennung) aufgrund eines besonderen
genetischen Mechanismus (“Polyploidie” – die Verdoppelung der
Chromosomen) aber häufiger vor. Da Biologen von einer neuen Art
sprechen, wenn sich die Individuen nicht mehr fruchtbar miteinander
vermehren können, ist dies natürlich bei Fossilien nicht mehr direkt
zu überprüfen, und sie müssen auf äußerliche Unterschiede
zurückgreifen. Die Veränderungen, die zu neuen Arten führen, sind
also graduell, neue Arten sind über eine direkte Abstammungslinie
aus “Zwischenformen” mit der Vorläuferart verbunden. Diese
Zwischenformen führen bei Fossilien manchmal zu langen Diskussionen
um die “richtige” Einordnung, zumal die Antwort je nach untersuchtem
Merkmal unterschiedlich ausfallen kann. Bei genügend langen
Zeiträumen entstehen durch allmähliche Veränderungen auch ganz
umwälzende evolutionäre Neuigkeiten, wie in der Vergangenheit die
Anpassung der Vierbeiner an das Landleben oder die Flügel der Vögel.
Im Rückblick auf die Evolution lässt sich eine Tendenz zu immer
komplexeren Organismen erkennen – vom einfachen Bakterium bis hin
zum Menschen mit dem komplexesten Organ überhaupt, dem menschlichen
Gehirn (mehr darüber >>
hier). Biologen sehen diese Entwicklung nicht als
“zielgerichtete Höherentwicklung”, sondern als eine Folge der immer
feineren Anpassung an ökologische Nischen – die Nischen der kleinen,
einfachen Lebewesen waren eben zuerst besetzt. Die Fossilienfunde
stützen diese Theorie, denn sie zeigen, dass die meisten früheren
Arten heute ausgestorben sind: Die Anpassung an enge ökologische
Nischen ist zunächst ein Vorteil, da sie die Konkurrenz reduziert;
wenn sich die Umwelt aber ändert, sind gerade ökologische
Spezialisten oft zum Aussterben verurteilt. In der Evolution zählt
eben nur der augenblickliche Vorteil. Was im Nachhinein wie eine
geradlinige Entwicklung scheint, ist eher ein ziellosen Suchen,
wenn man die ausgestorbenen Arten einbezieht. (Was die
“Höherentwicklung” angeht, ist auch keineswegs klar, dass die
komplexen Organismen “besser” sind: Sowohl was Biomasse und
Artenvielfalt angeht, sind etwa die Bakterien den Menschen
überlegen, und sie leben auch schon viel länger auf der Erde.)
Koevolution und Kooperation
Da zu den Umweltfaktoren und zur “ökologischen Nische” eines
Lebenswesens immer auch andere Lebewesen gehören (die Beute für den
Räuber, die Blüte für das bestäubende Insekt), ist die Veränderung
eines jedes Lebewesens durch die natürliche Auslese immer auch eine
Veränderung der Umwelt anderer Lebewesen: Wenn Strandmäuse heller
werden (siehe oben), heißt dies für die Raubvögel, dass ihre Nahrung
schwerer zu finden ist. Und dies bedeutet entweder weniger Futter
oder, wenn die Variabilität der Raubvögel eine Basis dafür bietet,
eine natürliche Auslese besser sehender Vögel.
Die Evolution
– Leichen pflastern ihren Weg
Gelingt einer Gruppe von Lebewesen die Anpassung an
veränderte Umweltfaktoren nicht, stirbt sie aus: Alle nur noch als
Fossilien bekannte Arten haben dieses Schicksal erlitten; der
weitaus größte Anteil aller Arten, die jemals auf der Erde gelebt
haben, ist heute ausgestorben. Ein besonderer Fall sind sehr
schnelle, katastrophale Umweltveränderungen, die in der
Vergangenheit zu mehreren >> Massenaussterben
geführt haben; für solche Ereignisse ist die Evolution blind,
wodurch der Zufall seine Chance bekommt (>> unten).
Die Veränderung einer Art als Folge der
Veränderung einer anderen Art wird Koevolution
genannt. Schon Darwin hat die Anpassung von Orchideen an die
Bestäubung untersucht; und heute weiß man, dass viele der chemischen
Stoffe, die in Pflanzen zu finden sind, eine Abwehr gegen
Fressfeinde, zum Beispiel Schmetterlingsraupen, sind – und viele
Schmetterlinge wiederum Anpassungen an bestimmte Gifte entwickelt
haben, die es ihnen erlauben, von bestimmten Pflanzen doch zu leben
(mit dem Vorteil, dass dort keine anderen Arten fressen). Ganze
Ökosysteme können das Ergebnis von Koevolution sein: So sind etwa
die Grassteppen eine Anpassung an die Herden von Pflanzenfressern
(>>
hier); und die Einlagerung von Silikatstrukturen in Blätter
(als Fraßschutz) führte bei manchen Pflanzenfressern zur Ausbildung
dicker, abnutzungsresistenter Zähne. Eine
extreme Form der Koevolution ist die Entstehung von Symbiosen. Die Entstehung der Eukaryoten durch
Endosymbiose (>> hier)
ist ein Beispiel dafür. Viele weitere Symbiosen prägen heute das
Leben: Schwämme bauen mit Hilfe von Algen Korallenriffe auf, Bäume
leben in Symbiose mit zahlreichen Pilzen in ihren Wurzeln und
gelangen so an Nährstoffe, die ihnen alleine nicht zugänglich wären,
Kühe können die Cellulose in ihrer Nahrung nur mit Hilfe von
Bakterien und Protisten im Pansen zerlegen. Auch wir Menschen
beherbergen Milliarden Bakterien im Darm, die dort bei der Verdauung
helfen.
Und schließlich kann die Evolution auch Kooperation
fördern: Diese wird sich durchsetzen, wann immer Individuen
gemeinsam bessere Chancen im “Kampf ums Dasein” haben als alleine.
Eine extreme Ausprägung, die zeigen, wie weit dies führen kann, sind
die sogenannten Superorganismen: Arten, bei denen
einzelne Individuen Rollen übernehmen, die zu einer Leistung führen,
die wesentlich größer ist, als es ohne diese Spezialisierung möglich
wäre. Beispiele sind Termiten oder Blattschneiderameisen: bei den
letzteren zerkleinern die nach der Königin größten Tiere die Blätter
auf den Bäumen, andere Tiere tragen diese ins Lager, von dort wieder
andere ins Nest, wo sie von jeweils einer Gruppe weiter zerkleinert,
zu Kugeln geformt und mit Pilzen bepflanzt werden. Die kleinsten
Ameisen kümmern sich um die Pilze. Daneben gibt es
"Müllarbeiterinnen", die Abfälle beseitigen, "Bestatterinnen", die
tote Ameisen begraben und "Kriegerinnen", die das Nest verteidigen.
Das alles geschieht ohne zentrale Steuerung; die "Ameisensprache"
besteht aus einer Gruppe von Chemikalien, den Pheromonen, die die
Zusammenarbeit steuern: Indem jede Gruppe in bestimmter Weise
Pheromone freisetzt oder auf bestimmte Pheromone reagiert, entsteht
scheinbar "intelligentes" Verhalten.
Ein anderes Beispiel ist der >> Mensch,
der sich in der Gruppe besser gegen große Tiere verteidigen und
diese nur gemeinsam erlegen konnte: Daher sind beim Menschen nicht
nur ein Streben nach eigenem Nutzen, sondern auch ein tief
verankerter Sinn für Fairness und Gerechtigkeit zu finden. Diese
Anlage ermöglichte dem Menschen, immer komplexere Gesellschaften
aufzubauen (>> mehr),
die ohne Vertrauen in andere gar nicht möglich gewesen wären, bis
hin zu heutigen globalen Marktwirtschaft (>>
mehr). Adam Smiths Arbeitsteilung hätte er auch von den
Blattschneiderameisen abgucken können. Bilder wie das vom
“egoistischen Gen” widersprechen dem nicht, denn Prozess und Produkt
sind nicht das gleiche (siehe >>
Beethoven-Fehler): der “Kampf ums Dasein” kann auch zu einer
friedlichen Kooperation führen und hat dies in vielen Fällen auch
getan. Entscheidend ist der Erfolg, und komplexe, arbeitsteilige
(kooperative) Gesellschaften haben historisch beim
Aufeinandertreffen mit einfacheren Gesellschaften zumeist gesiegt,
weshalb sie heute vorherrschen.
Natürlich hat auch das Leben in einem Superorganismus (und man kann
ja auch die menschliche Zivilisation als einen solchen verstehen)
Folgen für die Evolution: Da jedes einzelne Individuum eine
spezialisierte Rolle übernimmt, werden nicht mehr benötigte
Fähigkeiten auch immer weniger ausgebildet. So haben Haustiere
kleinere Gehirne und weniger scharfe Sinne als ihre wilden
Vorfahren; und auch die einzelnen Menschen werden immer
inkompetenter: die meisten von uns könnten sich längst nicht mehr
selbst ernähren (ohne gekaufte Werkzeuge!), beschützen oder
behausen. Es gibt Untersuchungen, nach denen das menschliche Gehirn
seit Erfindung der Landwirtschaft schrumpft: wir haben uns selbst
zum Haustier gemacht.
Zufall und Notwendigkeit
Eine weitere Antwort der modernen Evolutionsforschung ist die auf
die alte Frage nach Zufall oder Notwendigkeit als Antrieb der
Evolution. Zu Beginn hielten viele Darwinisten die Anpassung (also
die Notwendigkeit) für die treibende Kraft der Evolution; mit der
Entdeckung der Mutationen als Quelle der Vielfalt und der Rolle
katastrophaler Einschnitte (>> Massenaussterben)
wurde klar, das auch der Zufall eine gewaltige Rolle spielt: Er
beherrscht die Entstehung der Variabilität. Zufall und
Notwendigkeit beeinflussen also die Evolution. Würde man die Uhr
zurückstellen und die Evolution noch einmal ablaufen lassen, würde
das Leben aufgrund des Einflusses zufälliger Ereignisse ganz anders
aussehen – dies glauben jedenfalls die meisten Biologen; eine
überzeugende Darstellung findet sich etwa in Stephen Jay Goulds Buch
“Zufall Mensch”. Andere, etwa Simon Conway Morris (“Jenseits des
Zufalls”), aber glauben, aufgrund der Gesetzmäßigkeiten der
Anpassung an die ökologischen Nischen der Erde würde sich das Leben
wieder in eine ähnliche Richtung entwickeln, dafür würde die
natürliche Auslese sorgen. Unabhängig von dieser Frage, ist die
natürliche Auslese als solche nicht zufällig: Sie wählt immer die
Organismen aus, die am besten überleben können. Damit hat sie auch
dazu beigetragen, dass die Kette des Lebens seit über drei
Milliarden Jahren niemals abgerissen ist.
Literatur:
Eine aktuelle Darstellung der Evolution bietet >>
Ernst Mayr: Das ist Evolution; eine gute Einführung Richard
Dawkins’ “Die Schöpfungslüge. Warum Darwin Recht hat.” (Ullstein TB,
2012). (Der schönere Originaltitel lautet: “The Greatest Show on
Earth. The Evidence for Evolution”.)
Weiter mit:
>> Die
Geschichte des Lebens auf der Erde