Das Leben
Biodiversität:
Die Vielfalt des Lebens
Die Gesamtheit des Lebens auf der Erde wird
auch “Biosphäre” genannt; sie bildet eine dünne Schicht, die die
Erde von der tiefsten bis zur höchsten Stelle überzieht. Überall, wo
es flüssiges Wasser, organische Stoffe und eine Energiequelle gibt,
gibt es Leben. Ein Merkmal des Lebens ist die Anzahl, die Vielfalt
und die Verschiedenartigkeit der Lebewesen, biologische Vielfalt
oder Biodiversität genannt. Die biologische Vielfalt ist Grundlage
für die zahlreichen Dienstleistungen des Ökosystems Erde, ohne die
auch menschliche Gesellschaften unvorstellbar wären.
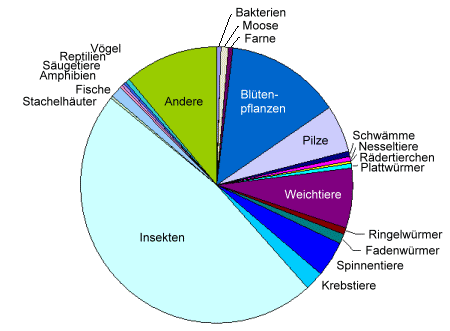
Heute sind etwa 1,75 Millionen
Arten bekannt, davon sind fast die Hälfte
Insekten.
Eigene Abbildung nach Zahlen von I. Harrison, M. Laverty und E.
Sterling:
Species Diversity (2004):
http://cnx.org/content/m12174/1.3/.
Das Leben auf der Erde
Das Leben auf der Erde hat diese geprägt: Es hat zum Beispiel vor
Milliarden Jahren verhindert, dass der Wasserstoff auf der Erde ins
Weltall entweicht (siehe >>
hier), es beeinflusst den Wasserkreislauf der Erde (siehe
>>
hier) und es hat den Sauerstoff in unserer Atemluft
erzeugt (siehe >>
hier). Dabei ist – nicht ohne Rückschläge (siehe die Seite
>> Massenaussterben) – im
Laufe der Zeit eine außerordentliche Vielfalt an Lebensformen
entstanden, die immer mehr Lebensräume besiedeln konnten (siehe die
Seite >> Die
Geschichte des Lebens auf der Erde). Organische Stoffe und
Energie sind als Voraussetzungen für das Leben auf der Erde fast
überall zu finden; daher ist >> Wasser
das begrenzende Element. Wie sehr die Verfügbarkeit von Wasser das
Leben und damit das Bild der Erde prägt, zeigen die
sonnenbeschienenen Tropen: Ist Wasser knapp, entstehen Wüsten. Ist
Wasser reichlich, entstehen tropische Regenwälder, der Inbegriff
üppig wuchernden Lebens.
Wie verbreitet das Leben auf der Erde ist, hat man erst in den
letzten Jahren verstanden. Als der britische Polarforscher Robert
Scott im Jahr 1903 während seiner Südpolarexpedition mit der
“Discovery” die antarktischen Trockentäler erkundete, berichtete er:
“Wir haben nichts Lebendiges entdeckt, nicht einmal Moos oder
Flechten.” Tatsächlich sind diese Trockentäler extrem unwirtlich: Im
Winter wird es unter 50 Grad Celsius kalt, es fällt weniger
Niederschlag als in der Sahara, die Böden bestehen aus rotem Staub
auf blankem Gestein, die Winde sind so stark, das sie Felsen
spalten. Aber heute wissen wir: Es gibt hier artenreiches Leben
– Bakterien und Algen, die Sonnenenergie nutzen; Tiere, die
von diesen Bakterien und Algen leben; Fadenwürmer, die Bakterien,
Algen und Tiere fressen; Pilze, die abgestorbene Lebewesen
zersetzten. Nur sind selbst die größten Arten so klein, dass sie
ohne Mikroskop kaum zu entdecken sind: daher konnte Scott sie leicht
übersehen.
Lebensgemeinschaften finden sich auch in so unwahrscheinlichen
Lebensräumen wie überfrorenen Salzwasserlaken im antarktischen
Meereis, in den Wänden vulkanischer Heißwasserschlote der Tiefsee
und in den heißen Schwefelquellen des Yellowstone-Nationalparks in
den USA. Das Bakterium Deinococcus radiodurans übersteht
das Tausendfache der Radioaktivität, die beim Abwurf der Atombomben
von Hiroshima und Nagasaki freigesetzt wurde. Selbst im
Tiefengestein der Erde bis in eine Tiefe von über 3.000 Metern leben
Bakterien und Pilze; sie beziehen ihre Energie aus anorganischen
chemischen Stoffen und sind vom Leben auf der Erdoberfläche völlig
unabhängig. Diese Entdeckungen haben unser Bild vom Leben verändert,
vor allem aber haben sie uns vor Augen geführt, wie wenig wir über
das Leben wissen: Es fällt uns nicht nur schwer, zu sagen, was Leben
eigentlich ist (>> mehr),
es ist viel weiter verbreitet als noch vor kurzem geglaubt, und es
ist der Wissenschaft zum größten Teil noch unbekannt (>>
siehe unten).
Heute wissen wir aber: Leben gibt es auf der Erde überall, wo es
Wasser, Nährstoffe und eine Energiequelle gibt. Bakterien und
>> Archaeen
kommen überall vor, wo es Leben gibt. Sobald ein wenig mehr Platz da
ist, kommen Einzeller und Wirbellose dazu, die die Mikroben und ihre
eigenen Artgenossen jagen. Je mehr Platz zur Verfügung steht, desto
größer werden die Tiere; die größten Tiere leben in den Savannen
oder den Weltmeeren. Die Vielfalt der Lebewesen nimmt mit hoher
Sonneneinstrahlung, vielseitigen Geländeformen und klimatischer
Stabilität zu: Daher findet sich die größte Vielfalt in den Tropen
(>>
mehr).
Einige ökologische Grundbegriffe
Alle Lebewesen beeinflussen andere Arten: Tiere fressen etwa
Pflanzen, oder verbreiten mit ihrem Kot deren Samen. Diese
Beziehungen sind äußert vielfältig und auch (je nach Lebewesen mehr
oder weniger) flexibel. Jedes Lebewesen ist aber mit anderen
Lebewesen – der eigenen Art, mit denen es eine Population bildet, und anderer Arten –
vernetzt: Sie leben in einer Lebensgemeinschaft
(Biologen nennen sie “Biozönose”) und spielen darin eine bestimmte
Rolle. Diese wird beschrieben, indem man untersucht, wer von wem
gefressen wird oder wer wen frisst, wer mit wem konkurriert oder
kooperiert – wie also Stoffe und Energie fließen. Die
Lebensgemeinschaften bilden zusammen mit ihrer unbelebten
Umwelt ein Ökosystem.
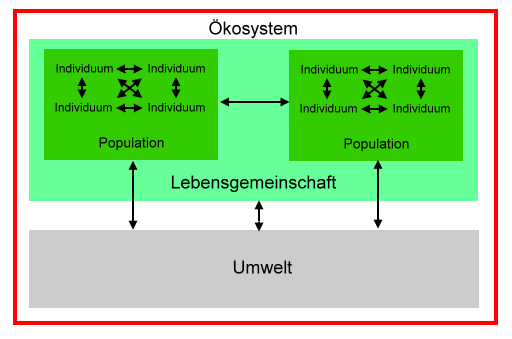
Wechselbeziehungen in einem
Ökosystem. Eigene Abbildung, verändert nach
Friedrich-Karl
Holtmeier, Tiere in der Landschaft, 2. Aufl. 2002, S. 12. Zur
“Umwelt” siehe auch >> hier.
Die Größe eines Ökosystems ist nicht vorgegeben und wird je nach
Untersuchungszweck festgelegt; ein Ökosystem kann also
beispielsweise ein Teich oder auch die Gewässer insgesamt sein. Auf
der obersten Ebene kann die Erde selbst als ein >> riesiges
Ökosystem verstanden werden. Die Position einer Art in ihrem
Ökosystem nennen die Biologen ihre ökologische Nische.
Diese hängt damit ab von den Eigenschaften der Art, ihrer Beziehung
zu anderen Arten der Lebensgemeinschaft und den Ressourcen der
unbelebten Umwelt. Ökologische Nischen können sich ändern, etwa wenn
sich die Umwelt durch geologische oder klimatische Ereignisse
ändern; die dadurch angestoßenen Verschiebungen gelten als wichtige
Triebkraft für die Evolution der Arten.
Biologische Vielfalt: Die Arten
Baustein der Lebensgemeinschaften sind die Arten. Arten sind für Biologen die
grundlegende Einheit, in die sie Lebewesen einteilen. Auch
Naturvölker teilten die Lebewesen in Gruppen ein, die eigene Namen
bekamen und die oft den heutigen Arten entsprachen: eine Studie
ergab kürzlich zum Beispiel, dass die Matses-Indianer im
peruanischen Amazonasgebiet Fledermäuse ähnlich einteilen wie die
moderne Wissenschaft. Die moderne Naturwissenschaft hat ihre Wurzeln
bei Aristoteles, der alle Lebewesen der Welt katalogisieren wollte:
ein bis heute unerfüllter Traum, aber er beschrieb etwa 500 Arten.
Das heute verwendete System zur Beschreibung von Arten geht auf den
Schweden Carl Linnaeus – 1761 zu Carl von Linné geadelt – zurück. Er
führte 1753 die heute in der Wissenschaft übliche lateinische
Doppelbenennung (“binäre Nomenklatur”) für die Arten ein.
Eine Art ist etwa die Weiße Seerose; ihr wissenschaftlicher Name
ist Nymphaea alba L. (das “L.” steht für Linnaeus, der
diese Art als erster beschrieb). Der erste Teil des Namens
(Nymphaea) steht für die Gattung, der nächsthöheren Kategorie über
den Arten. Die weitere Einordnung ist in der Tabelle unten
dargestellt; die Blütenpflanzen gehören schließlich, wie etwa auch
die Nadelbäume, zu den Samenpflanzen, die wiederum mit den Farn- und
Moospflanzen das Reich der Pflanzen bilden; und die gehören mit
Tieren und Pilzen zu den Eukaryoten – womit wir am Ende der Kette
angekommen wären. (Eukaryoten, Lebewesen mit Zellkern, bilden
gemeinsam mit Archaeen und Echten Bakterien die drei “Domänen”, zu
denen alle Lebewesen gehören, siehe >> Die
Entfaltung des Lebens.) Jedes Lebewesen kann auf diese Art in
das System eingeordnet werden (siehe auch die >>
Webtipps).
| Domäne |
Eukaryoten |
| Reich |
Pflanzen |
| Abteilung |
Blütenpflanzen |
| Klasse |
Einfurchenpollen-Zweikeim- blättrige (Magnoliopsida) |
| Ordnung |
Seerosenartige (Nymphaeales) |
| Familie |
Seerosengewächse (Nymphaeaceae) |
| Gattung |
Seerosen (Nymphaea) |
| Art |
Nymphaea alba L. |
Vieles von dem, was wir heute
wissen, konnte Linnaeus noch nicht ahnen. Die Naturforscher begannen
mit dem Erkennen und Benennen verschiedenartiger Lebewesen (Taxonomie); seit Charles Darwin entdeckte,
dass die Lebewesen durch natürliche Prozesse entstanden sind
(>> mehr),
bemüht man sich, mit diesem System auch die natürlichen
Verwandtschaftsverhältnisse abbilden ( Systematik). Heute helfen auch genetische
Unterschiede bei einer genauen Einordnung. Grundlage hierfür sind
Erbinformationen (>> Was ist
Leben?) in Form der DNS. Diese Erbinformation ist weitgehend
stabil – so stabil, dass sie noch heute belegt, dass alle Formen des
Lebens auf der Erde miteinander verwandt sind. Im Laufe der Zeit
aber kommt es aber doch zu Veränderungen: So entsteht >>
genetische Vielfalt, und auf der Basis mehr oder weniger
großer genetischer Ähnlichkeit können die Systematiker
Verwandtschaften ablesen.
Aber allen modernen Technik zum Trotz: Das Erkennen einer Art ist
nicht einfach. Eine Art gilt immer dann als bekannt, wenn eine kurze
wissenschaftliche Beschreibung in einer Fachzeitschrift
veröffentlicht wurde. Dort steht dann auch, wo (meist in einem
Museum) der “Typus” hinterlegt ist, der die Grundlage für die
Beschreibung war. Ein Biologe, der etwa auf einer Expedition ein ihn
unbekanntes Lebewesen findet, muss dieses mit den bisher bekannten
Lebewesen vergleichen. Dieses ist nicht immer einfach: Vielleicht
hat er einfach ein anders gefärbtes Jungtier einer längst bekannten
Art gefunden, oder ein besonders mickrig gewachsenes Exemplar. Die
richtige Einschätzung verlangt eine Menge Erfahrung, und dennoch
kommen immer wieder Fehler vor – irgendwann entdeckt dann ein
anderer Biologe, dass eine neue Art längst unter einem anderen Namen
beschrieben war (es gilt dann der ältere Name; und der spätere Name
wird, falls er schon gebräuchlich war, als Synonym geführt).
Manchmal sind die Entscheidungen objektiv schwierig: Ist etwa die
anders gefärbte Variante eines Vogels im Westen eines Kontinents
eine lokale Variante oder eine eigene Art? An solchen Fragen
schieden (und scheiden) sich oft die Geister; heute kann jedoch die
Molekulargenetik oft Antworten geben.
Und bei der Systematik auf höherer Ebene gibt es noch viel
unterschiedlichere Vorstellungen; so können die drei oben genannten
Domänen (Archaeen, Echte Bakterien und Eukaryoten) als höchste
Einheit gesehen werden, oder aber fünf Reiche: Bakterien
(Prokaryoten, mit Archaeen und Echten Bakterien), Pilze, Pflanzen,
Tiere und Protoctisten (ein Sammelbegriff für alle Eukaryoten, die
nicht Pilze, Pflanzen oder Tiere sind – etwa die Algen). Das Problem
ist, dass die Kategorien oberhalb der Art noch ungenauer zu
definieren sind als diese, so dass die Zuordnung oftmals mehr oder
weniger willkürlich ist. Daher gibt es Überlegungen, diese
Kategorien ganz aufzugeben.
Wie auch immer: In der maßgeblichen und bis heute als Basis für die
Benennung geltenden zehnten Auflage seiner „Systema Naturae“
von 1758 hat Linnaeus 4387 Arten beschrieben; heute wird die Anzahl
der wissenschaftlich beschriebenen Arten auf 1,75 Millionen
geschätzt – geschätzt, denn ein zentrales Register der Arten
befindet sich erst im Aufbau. Die bisher beschriebenen Arten sind
aber wohl nur ein kleiner Teil aller vorkommenden Arten (siehe
Kasten).
Wie viele Arten gibt es auf
der Erde?
Im Computerzeitalter und angesichts anderer Projekte wie zentraler
DNS-Sequenz- Datenbanken mag es unglaublich erscheinen, aber eine
Datenbank, die Arten, die Grundlage der biologischen Vielfalt auf
der Erde (und der DNS-Sequenzen), erfasst, befindet sich erst seit
dem Jahr 2007 im Aufbau. Noch unglaublicher: Die Anzahl der Arten
ist völlig unbekannt. Sie wird – je nach Methode – auf drei bis 100
Millionen geschätzt, wobei der Mittelwert der Schätzungen bei 10 bis
20 Millionen Arten liegt. Diese Unsicherheit liegt zum einen daran,
dass viele Arten sehr klein sind: Die Ozeane und das Land etwa
wimmeln nur so von noch unbekannten Bakterien, Archaeen und
Protisten. Dabei können sie eine bedeutende Rolle bei der oben
beschriebenen Erhaltung der Energie- und Stoffkreisläufe spielen:
Bakterien der Gattung Prochlorococcus produzieren einen
Großteil der Biomasse im Meer – und sind der Wissenschaft erst seit
1988 überhaupt bekannt. Im Jahr 2007 wurden winzige Eukaryoten
entdeckt, die in kalten Küstenmeeren reichlich vorkommen, die
“Picobiliphyta” – ihre Verwandtschaft zu anderen Lebewesen ist noch
völlig ungeklärt. In Norwegen wurden zwei Proben von je 1 Gramm
Waldboden und Küstensediment untersucht: beide enthielten etwa 5000
voneinander verschiedene und unbekannte Bakterienarten.
Aber selbst ohne die winzigen Bakterien wissen wir wenig: Auch
heute noch sind große Gebiete der Erde nur für die auffälligsten
Arten einigermaßen erforscht. Dazu gehören die Böden. Möglicherweise
sind vier Fünftel aller Tierarten auf der Erde Fadenwürmer, die eine
wichtige Rolle beim Abbau organischer Stoffe im Boden spielen. Aber
erst etwa 15.000 Arten sind beschreiben. Ähnlich ist es bei den
Pilzen: Zwar sind hier 100.000 Arten beschreiben, aber vermutlich
gibt es 1,5 Millionen Arten. Zu den unerforschten Lebensräumen
gehören auch die tropischen Regenwälder. Dass hier über die Hälfte
aller Arten vorkommen, ist daher eine Hochrechnung aus den wenigen
genauen Untersuchungen. Der Biologe Edward O. Wilson, ein
Ameisenspezialist, schätzt, dass die Zahl der bekannten Ameisenarten
(ca. 10.000) leicht verdoppelt werden kann, wenn erst die tropischen
Gebiete genauer erforscht sind. Er selbst hat unter dem Krondach
eines einzigen Baumes in Peru 43 Ameisenarten identifiziert; etwa so
viele, wie auf den gesamten Britischen Inseln vorkommen. Berühmt
unter Biologen ist die Untersuchung des Biologen Terry Erwin, der
die Krone von Bäumen im Regenwald mit Insektizid besprühte, die
herabgefallenen Tiere untersuchte und dann die Anzahl alleine der
Insektenarten auf 30 Millionen schätzte. Diese Hochrechnung ist
naturgemäß umstritten – von ein paar Bäumen auf die ganze Welt
hochzurechnen muss ungenau sein. Andere Forscher rechnen daher mit
“nur” 8 Millionen Insektenarten. Zu den unerforschten Lebensräumen
gehört auch die >>
Tiefsee, wo ebenfalls Millionen unbekannte Arten vermutet
werden.
Aber selbst von den hervorragend erforschten Blütenpflanzen werden
jedes Jahr noch ca. 2.000 neue Arten entdeckt! Die Welt der lebenden
Organismen ist also, global gesehen und vor allem unter
Berücksichtigung der Mikroorganismen, noch weitgehend unbekannt.
Angesichts der enormen Bedeutung, die die Biosphäre als Grundlage
unseres Lebens hat, ist dies eigentlich ein Skandal.
Die unbekannte Vielfalt der Arten
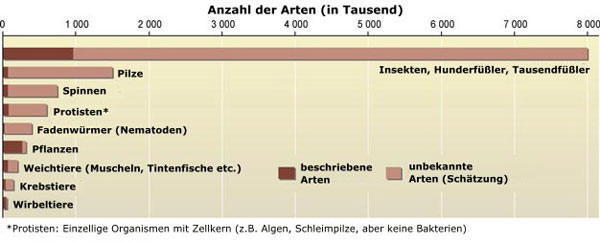
Schätzung des Anteils der bereits
beschriebenen (der Wissenschaft bekannten) Arten an der gesamten
Artenzahl für verschiedene Gruppen von Lebewesen. Abb.
aus Millennium Ecosystem Assessment: Biodiversity Synthesis, eigene
Übersetzung.
Biologische Vielfalt: Genetische
Vielfalt/Populationen
Arten sind aber keineswegs der einzige Ausdruck der biologischen
Vielfalt auf der Erde: So wie jeder Mensch sich von anderen Menschen
unterscheidet, so sind auch die anderen Lebewesen jeweils
einzigartig. Grundlage dieser Unterschiede ist eine jeweils
einzigartige Ausstattung mit Erbanlagen: Dieser Aspekt wird als genetische
Vielfalt innerhalb einer Art bezeichnet. Genetische
Vielfalt ist die Grundlage der >> Evolution.
Sie gilt auch als Voraussetzung dafür, dass Lebewesen sich an sich
ändernde Umweltbedingungen anpassen können. Wenn die Anzahl der
Individuen einer Art zurückgeht, nehmen oftmals auch die genetische
Vielfalt und damit die Zukunftschancen einer Art ab. Daher ist
bereits der Rückgang der Individuenzahl ein Warnsignal für den
Verlust an biologischer Vielfalt.
Ein weiteres Kriterium ist die Anzahl an Populationen:
Unter Population verstehen die Biologen Individuen, die ein
gemeinsames Verbreitungsgebiet haben. Arten können ein großes,
gemeinsames Verbreitungsgebiet haben oder aber mehrere nicht
zusammenhängende Verbreitungsgebiete – gerade in solchen Gebieten
findet sich oftmals ein großer Teil der genetischen Vielfalt; der
Verlust an Populationen kann daher ebenfalls mit einem Rückgang der
genetischen Vielfalt verbunden sein.
Biologische Vielfalt und
Ökosysteme
Biologische Vielfalt und Ökosysteme (siehe die Darstellung der
>> großen
Ökosysteme der Erde) sind untrennbar miteinander verknüpft:
Einerseits sind die verschiedenen Ökosysteme Grundlage für die in
ihnen vorkommende biologische Vielfalt, andererseits ist die
biologische Vielfalt Basis für viele Dienstleistungen der
Ökosysteme.
Die Ökosysteme sind zum einen die Umwelt, an die Lebewesen sich
anpassen müssen; und eine große Verschiedenheit von Ökosystemen
führt auch zu großer biologischer Vielfalt – in einer Wüste leben
andere Organismen als in einem See. Andererseits tragen die
Lebewesen zu den Dienstleistungen des Ökosystems bei: Es sind die
Bäume, die die Kraft der herabfallenden Regens brechen und so den
Boden vor Erosion schützen, es sind Moose, die Wasser speichern und
so dazu beitragen, dass Wälder die Wasserversorgung stabilisieren.
Die Funktionen der Ökosysteme und die biologische Vielfalt
beeinflussen sich also gegenseitig. Um die biologische Vielfalt zu
erhalten, muss daher auch die Vielfalt der Ökosysteme erhalten
bleiben – wobei die biologische Vielfalt wiederum die
Widerstandskraft der Ökosysteme gegen Veränderungen ausmacht.
Welchen Wert hat die biologische
Vielfalt?
Wir Menschen sind Bestandteil und eingebettet in die Ökosysteme der
Erde: Wir leben von den verschiedenen Dienstleistungen, die diese
uns zur Verfügung stellen – saubere Luft, frisches Wasser, Boden und
Nährstoffe für die Erzeugung unserer Nahrung, organische Rohstoffe
für unsere Wirtschaft... Wie jedes Tier ernähren wir Menschen uns
von anderen Lebewesen; im Unterschied zu den Tieren sind die
Ökosysteme auch Bestandteil unserer Kultur: Sie lieferten schon den
Steinzeitjägern Kleidung in Form von Fellen und Behausung, etwa
Häuser aus Mammutzähnen und -fellen. Und noch heute stammt ein guter
Teil unserer Kleidung aus Naturstoffen wie Baumwolle, Leinen oder
Leder. Seit jeher nutzten Menschen Arzneipflanzen; manche sind auch
heute noch unverzichtbar, andere lieferten die Inspiration für
Medikamente (zum Beispiel stammt Salicylsäure, der Wirkstoff in
Aspirin, ursprünglich aus der Rinde von Weiden). Die >>
Industrielle Revolution beruhte auf der Nutzung des fossilen
Brennstoffs Kohle – entstanden über die Jahrtausende aus Pflanzen.
Heute liefert die Natur Ideen für technische Erfindungen – die
bekannteste ist der Klettverschluss, abgeguckt von der Klette.
Diese Dienstleistungen der Ökosysteme entstehen durch die
vielfältigen Wechselwirkungen der Organismen in den Ökosystemen
– sie sind unser Naturkapital. Ähnlich wie
in ökonomischen System sichert Vielfalt die Leistungsfähigkeit
dieses Kapitals. Man kann Arten als das gespeicherte “Wissen der
Evolution” ansehen; Wissen, von dem wir schon oft profitiert haben:
So gingen alle unsere Nutzpflanzen und -tiere aus den genetischen
Anlagen ihrer wilden Vorläufer hervor, und diese stellen eine
genetische Ressource etwa beim Auftreten neuartiger
Krankheitserreger dar. Ebenso mag noch so manche unerkannte Arznei
in unerforschten oder gar unbekannten Organismen schlummern.
Daneben hat die biologische Vielfalt auch einen Wert an sich.
Naturerleben kann erholsam sein und einen Wert für Lebensqualität
und Ästhetik haben; nicht umsonst verbringen viele Menschen gerne
einen Teil ihrer Freizeit in der Natur. Der “Vater der
Biodiversität”, der amerikanische Biologe Edward Wilson, hält die
Liebe zur Natur geradezu für angeboren, dargestellt in seinem Buch
“Biophilia”. Diese Neigung kann sich natürlich auch durch indirektes
Naturerleben ausdrücken, so sind Naturfilme anhaltend beliebt. (Für
Bücherleser ein persönlicher Tipp: Lesen Sie einmal ein Buch von
Peter Matthiessen – etwa sein “Die Könige der Lüfte” über Kraniche
– und sie verstehen, was gemeint ist.)
Siehe auch: >>
Warum uns die biologische Vielfalt interessieren muss
Die Verteilung der Vielfalt
Auch wenn die Entfaltung des Lebens immer wieder von >> Rückschlägen
geprägt war, führte sie letztendlich zu >>
zunehmender Vielfalt. Die so entstandene Vielfalt ist nicht
gleichmäßig über die Erde verteilt, und es gibt deutliche
Unterschiede zwischen Land und Meer. Auf dem Festland leben
78 Prozent der bekannten Arten. Die Verteilung ist aber
von der geografischen Breite abhängig: an den Polen ist die
biologische Vielfalt am niedrigsten, in den Tropen am höchsten
(Fachleute nennen das "Breitengradient des Artenreichtums"). Die
artenreichsten Lebensräume des Festlands sind die >> tropischen
Regenwälder; sie nehmen etwa 1/16 der Landoberfläche ein,
beherbergen aber über die Hälfte aller Arten. Warum das so ist,
wissen wir nicht – viele Theorien versuchen, den Breitengradienten
zu erklären.
Eine verbreitete Theorie glaubt, dass das höhere Alter der
Lebensräume in den niedrigen Breiten, die in den letzten 2,6
Millionen Jahren weniger als in höheren Breiten von den
>> Eiszeiten
des Pleistozän gestört wurden, die Ursache ist – die
biologischen Vielfalt in den Regionen mit Eiszeiten geht zum großen
Teil auf Arten zurück, die nach den Eiszeiten wieder einwandern
mussten. Andere Theorien vermuten, dass in den Tropen aufgrund der
schnelleren Generationenfolge und/oder der höheren
Sonneneinstrahlung eine höhere Evolutionsrate zur schnelleren
Artenbildung führt; oder dass die an vergleichsweise weniger
schwankende Temperaturen gewöhnten Organismen niedriger Breiten
empfindlicher und daher höher spezialisiert sind, was wiederum die
Artenbildung fördert. Diesen Theorien ist gemein, dass die Ursache
des Breitengradienten in einer erhöhten Artenbildung (nicht etwa
einer geringeren Aussterberate) gesehen wird. Als wichtigster
Mechanismus der Artbildung gilt die geografische Artbildung:
Populationen, die räumlich getrennt werden, entwickeln sich
unterschiedlich weiter, so dass schließlich getrennte Arten
entstehen. Die hohe Spezialisierung führt dazu, dass etwa Bergpässe
für manche Organismen schon unüberwindliche Hindernisse darstellen.
(Die Spezialisierung führt auch dazu, dass diese Arten bei
Änderungen des Lebensraums besonders empfindlich reagieren, zumal
hohe Spezialisierung mit geringerer Populationsdichte einhergeht;
eine Aspekt, der die Auswirkungen des >> Klimawandels
in den Tropen verstärken könnte.) Auch die Vergangenheit könnte eine
Rolle spielen: In den Tropenwäldern, so eine Theorie, wurden während
der Eiszeiten des Pleistozän die Wälder mehrfach
zurückgedrängt und bildeten kleinere, voneinander isolierte Bestände
– in diesen könnten sich Populationen ebenfalls unterschiedlich
entwickelt haben und neue Arten entstanden sein. Die biologische
Vielfalt hängt aber nicht alleine von der geografischen Breite ab
– auch innerhalb der Tropen etwa gibt es große Unterschiede.
Manche Gebiete sind besonders artenreich, und in diesen Gebieten
kommen auch besonders viele Arten vor, die nur dort vorkommen
(sogenannte Endemiten). Diese Gebiete scheinen die
Zentren der Artentstehung zu sein – warum dies so ist, darüber gibt
es viele Ideen, aber keine allgemein akzeptierte Theorie.
Im >> Meer sieht die
Vielfalt anders aus als an Land: Trotzt der größeren Fläche findet
man hier weniger Arten (etwa 15 % der bekannten Arten; was nur zum
Teil mit der schlechteren Kenntnis zu tun hat), aber eine größere
Vielfalt auf höherer systematischer Ebene: Alle 36
bekannten Tierstämme kommen im Meer vor, aber nur 12 an Land. Dies
hat vermutlich damit zu tun, dass das Leben im Meer entstanden ist,
und nicht alle Stämme den Übergang an Land geschafft haben. Aber
auch sonst sind die Lebensräume im Meer ganz anders als an Land: In
den artenreichsten Land-Ökosystemen, den tropischen Regenwäldern,
sind Tiere eher unauffällig, während ihr Gegenstück in den Meeren,
die >> Korallenriffe,
vor bunten tierischem Leben nur so wimmeln. Warum dies so ist, kann
niemand sagen.
Fünf Prozent aller bekannten Arten leben außerdem als Parasiten
oder Symbionten in anderen Lebewesen (Parasiten leben von ihren
Wirtsorganismen, während Symbiose ein Zusammenleben zum
beiderseitigen Vorteil ist).
Webtipps
>> Tree of Life
– Darstellung des “Stammbaums des Lebens” und der
Verwandtschaftsverhältnisses aller Lebewesen mit Nennung der
zugrundeliegenden Informationsquellen
>> Encyclopedia of Life
– Enzyklopädie, in der sämtliche Arten der Erde beschrieben
werden sollen (englischsprachig)
>>
Botanik online: Methoden und Regeln zur Klassifikation der
Pflanzen
Zum Thema Biodiversität siehe auch:
>>
Das große Aussterben – die Vielfalt des Lebens geht verloren
Weiter mit:
>> Ökosystem
Erde
Zurück zur Übersicht:
>> Das
Leben
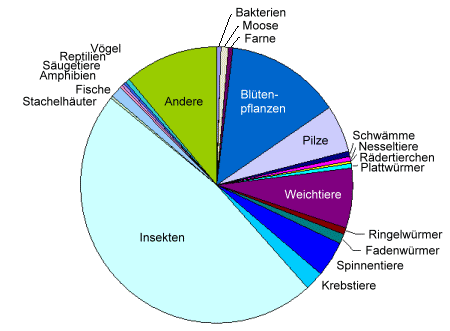
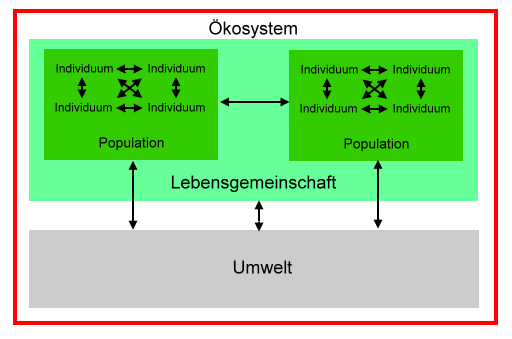


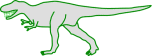
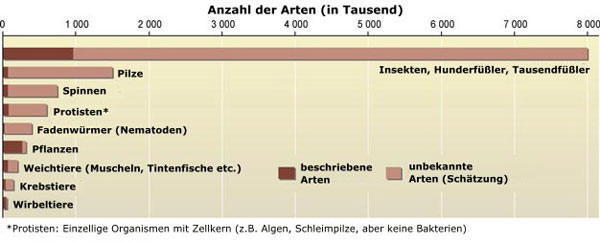
 erdachte die noch
heute übliche zweiteilige lateinische Bezeichnung der Arten in
seinem 1753 erschienenen Species plantarum. Startpunkt für
die Benennung der Tierarten ist die 10. Auflage seiner Systema
naturae aus dem Jahr 1758.
erdachte die noch
heute übliche zweiteilige lateinische Bezeichnung der Arten in
seinem 1753 erschienenen Species plantarum. Startpunkt für
die Benennung der Tierarten ist die 10. Auflage seiner Systema
naturae aus dem Jahr 1758.