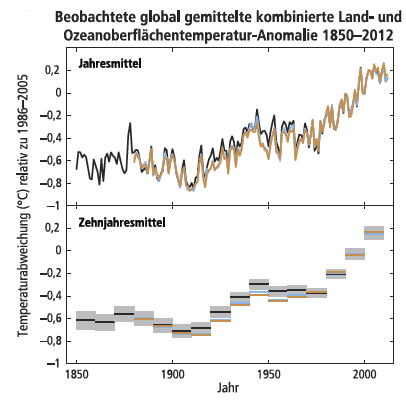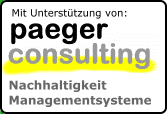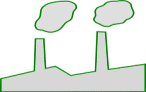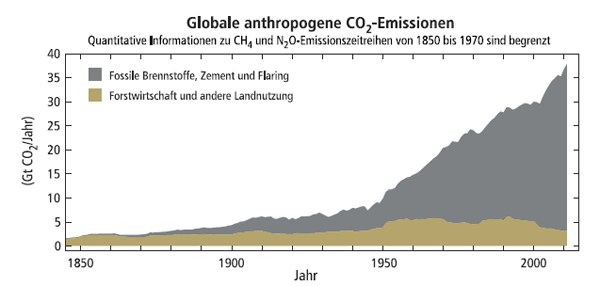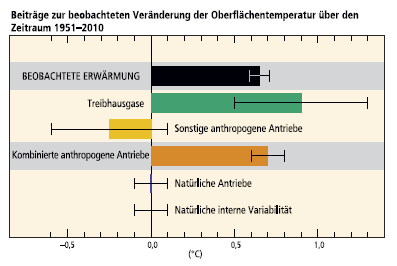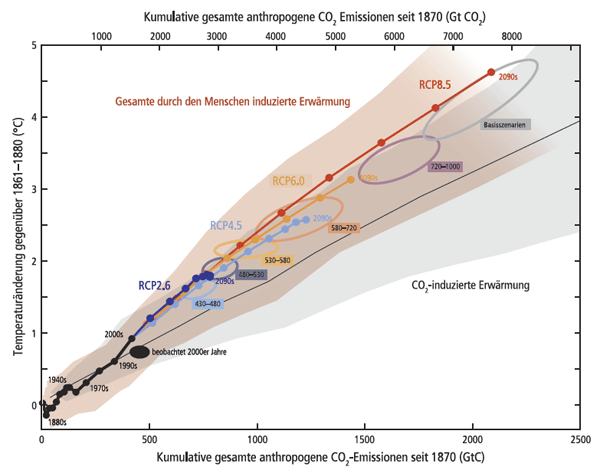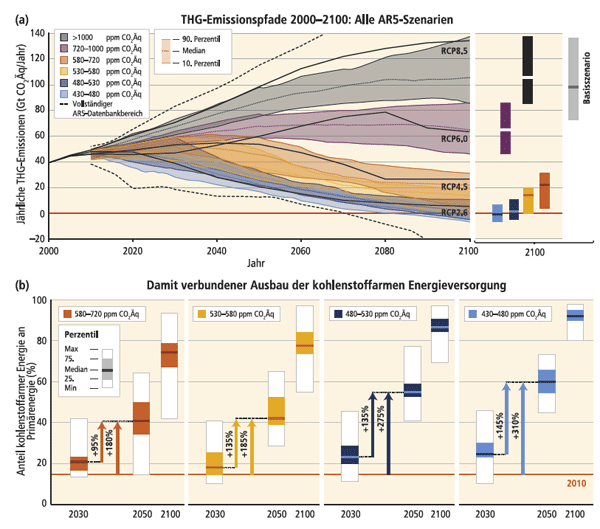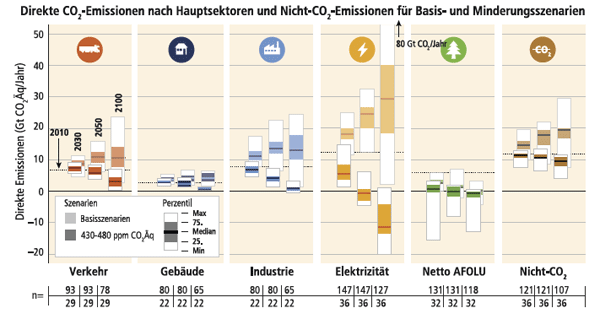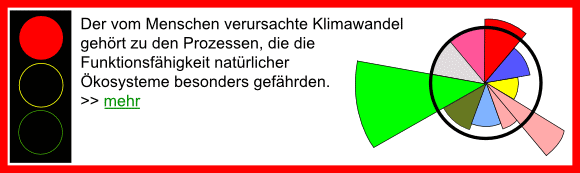Das Zeitalter der Industrie
Der 5. UN-Klimareport
Synthesebericht 2014
Im Jahr 2013 hat der Klimarat der Vereinten
Nationen (IPCC)
begonnen, seinen fünften Klimareport zu veröffentlichen. Der
Klimareport fasst regelmäßig den Stand der weltweiten
Klimaforschung zusammen. Mit dem Synthesebericht vom
November 2014, der die Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen vereint
und integriert, wurde der Bericht abgeschlossen. Die wesentlichen
Inhalte sind im Folgenden dargestellt.
Beobachtete Änderungen und deren Ursachen
Die Erde hat sich an der Erdoberfläche von 1880 bis 2012 um 0,85
Grad Celsius erwärmt, die letzten drei Jahrzehnte
waren jeweils wärmer als alle vorangegangenen Jahrzehnte.
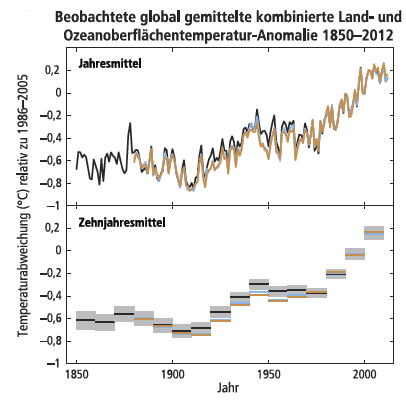
Beobachtete Entwicklung der
Oberflächentemperatur der Erde. Dargestellt sind die
Jahresmittel (oben) und die Durchschnittswerte für das jeweilige
Jahrzehnt; die Skala zeigt die Abweichung vom Durchschnittswert des
Zeitraums 1986 bis 2005. Quelle der Abbildung: Abbildung 1.1 (a) aus
IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht.
Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn,
2016.
Die Erwärmung der Erdatmosphäre wurde von 1971 bis 2010 von nur 1
Prozent der gesamten aufgenommenen Energie
verursacht; über 90 Prozent der Energie wurde im Ozean gespeichert.

Energieaufnahme im Klimasystem der
Erde von 1971 bis 2010. Schätzung in Millionen Petajoule.
Der obere Ozean ist der Ozean oberhalb von 700 m Wassertiefe,
Tiefsee der Ozean darunter; Eis steht für Eisabschmelzung und Land
für die kontinentale (Land-)Erwärmung. Quelle der Abbildung:
Abbildung 1.2 aus IPCC: Klimaänderung 2014:
Synthesebericht. Deutsche Übersetzung durch Deutsche
IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016.
Seit Beginn der industriellen Zeit hat durch die Aufnahme von
Kohlendioxid der Säuregehalt des Ozeans um 26
Prozent zugenommen; der globale Wasserkreislauf
über dem Ozean hat sich verändert: Regionen mit hohem Salzgehalt (in
denen Verdunstung überwiegt), sind salziger geworden; Regionen mit
niedrigem Salzgehalt (in denen Niederschläge überwiegen), sind
weniger salzig geworden: in den ohnehin trockenen Regionen ist des
trockener geworden, in den feuchten Regionen feuchter.
Das arktische Meereis hat seit 1979 um 730.000
bis 1.070.000 Quadratkilometer pro Jahrzehnt abgenommen; in der
Antarktis gibt es große regionale Unterschiede, hier hat
es aber um 130.000 bis 200.000 Quadratkilometer zugenommen. Die Schneebedeckung
der Nordhalbkugel der Erde ging zurück, ebenso wie die Permafrosttemperaturen und in
der Folge in einigen Regionen Dicke und Ausdehnung des Permafrosts.
Der Meeresspiegel ist von 1901 bis 2010 im 19
Zentimeter angestiegen, die Geschwindigkeit des Anstiegs nimmt zu:
zuletzt lag sie bei 3,2 mm pro Jahr. Der Anstieg liegt an der
thermischen Ausdehnung des wärmeren Wassers und dem Abschmelzen der
Gletscher und Eisschilde.
Wichtigste Ursache dieser Veränderungen sind vom
Menschen verursachte Emissionen von Treibhausgasen, vor allem von
Kohlendioxid. Dessen Konzentration in der Atmosphäre ist so hoch wie
seit mindestens 800.000 Jahren nicht mehr; die Hälfte der gesamten
vom Menschen verursachten Kohlendioxid-Emissionen des Zeitraum von
1750 bis 2011 erfolgten in den letzten 40 Jahren.
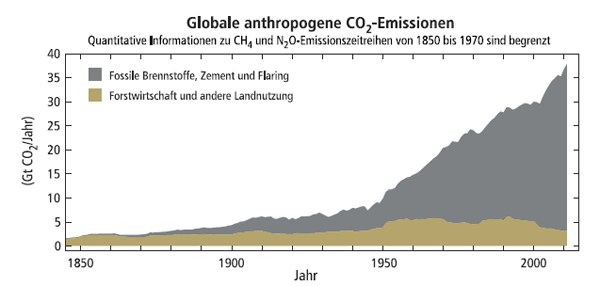
Jährliche vom Menschen verursachte
Kohlendioxid-Emissionen in Milliarden Tonnen
Kohlendioxid/Jahr. "Flaring" bezeichnet das Abfackeln von Gas
z.B. bei der Ölförderung. Quelle der Abbildung: Abbildung 1.5 aus IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht.
Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn,
2016.
Etwa 40 Prozent der Kohlendioxid-Emissionen sind in der
Erdatmosphäre geblieben, der Rest wurde zu etwa gleichen Teilen von
dem Ozean (der hierdurch saurer wurde, siehe oben) sowie
Landvegetation und Böden aufgenommen. Die in der Luft gebliebenen
Treibhausgase haben zu Veränderungen der Energie des Erdsystems
beigetragen, die als Strahlungsantrieb bezeichnet
werden. Der auf menschliche Aktivitäten zurückgehende
Strahlungsantrieb von 1750 bis 2011 betrug insgesamt 2,3 (1,1 bis
3,3) Watt/m². Er setzt sich zusammen den (erwärmenden)
Treibhausgasen und (abkühlenden) Aerosolen
(ohne die der Strahlungsantrieb noch stärker ausgefallen wäre). Der
Einfluss des natürlichen Strahlungsantriebs ist dagegen gering;
Veränderungen der Sonneneinstrahlungen betrugen 2011 gegenüber 1750
nur zwei Prozent des gesamten Strahlungsantriebs.
Die vom Menschen verursachten Emissionen steigen, allen
Minderungsaktivitäten zum Trotz, weiter, von 2000 bis 2010 um ca. 1
Milliarde Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent
pro Jahr; Kohlendioxid hatte daran einen Anteil von 78 Prozent,
Methan von 16 Prozent, den Rest teilen sich andere
Treibhausgase. Der Trend zur Dekarbonisierung (zurückgehende
Kohlenstoffintensität der weltweiten Energieversorgung) hat sich von
2000 bis 2010 durch gestiegene Kohlenutzung umgekehrt. Es ist
äußerst wahrscheinlich, dass mehr als die Hälfte des beobachteten
Temperaturanstiegs seit 1951 auf diese vom Menschen verursachten
Emissionen von Treibhausgasen zurückgehen.
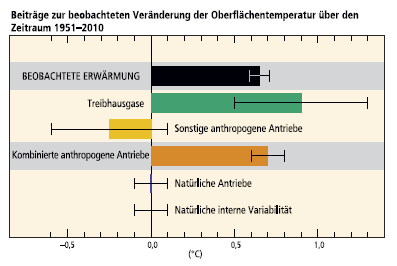
Wahrscheinliche Bandbreiten der
Erwärmung und der Beiträge verschiedener Ursachen mit
Unsicherheitsbereich von 5 bis 95 Prozent. Quelle der Abbildung:
Abbildung 1.9 aus IPCC: Klimaänderung 2014:
Synthesebericht. Deutsche Übersetzung durch Deutsche
IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016.
Damit hat der Mensch mit seinen Aktivitäten auch zum Rückgang des
arktischen Meereises seit 1979 beigetragen und die steigende
Feuchtigkeit in der (wärmeren) Erdatmosphäre und die damit
einhergehenden intensiveren Starkregen über Landregionen
beeinflusst. Die Klimaänderungen beeinflussen weiter (mittleres
Vertrauen) Quantität und Qualität von Wasserressourcen,
die Veränderung von geographischer Verbreitung und
Wanderungsmuster vieler Arten von Lebewesen (so etwa die
Verlagerung der Verbreitungsgebiete von Meeresfischen polwärts
und/oder in tiefere/kühlere Gewässer; Verlust von Warmwasserkorallen
und deren Riffe) und häufigere/intensivere Ökosystemstörungen
durch Dürren, Stürme, Brände oder Schädlingsausbrüche. Auch
menschliche Systeme leiden: So hat der Klimawandel global
die Erträge von Weizen und Mais negativ
beeinflusst und (mittleres Vertrauen) zu einigen Phasen des raschen
Anstiegs von Lebensmittel- und Getreidepreisen
beigetragen. Die Eintrittswahrscheinlichkeit von Hitzewellen
hat sich in einigen Regionen durch den Klimawandel mehr als
verdoppelt; in Nordamerika und Europa hat die Häufigkeit
und Intensität von Starkregen zugenommen. Extreme
Meeresspiegel, z.B. bei Sturmfluten, haben seit 1970
zugenommen. Vor allem fehlende Daten (etwa im Fall von Dürren) oder
komplexe Wechselwirkungen mit anderen Einflüssen (etwa im Fall von
Überschwemmungen, die auch durch andere Aktivitäten des Menschen
beeinflusst werden) führen nur zu geringem Vertrauen in Aussagen
über die Auswirkungen des Klimawandels hierbei.
Besonders betroffen vom Klimawandel sind ohnehin (sozial,
wirtschaftlich oder anderweitig) ausgegrenzte Menschen;
klimabedingte Gefährdungen verschärfen andere Faktoren, vor allem
für Menschen, die in Armut leben und haben dann
negative Folgen für die Existenzgrundlagen dieser
Menschen. Anpassungsmaßnahmen werden (vor allem bei bestehenden
Programmen zum Katastrophenmanagement und der Wasserwirtschaft)
geplant, global bleibt die Umsetzung bisher aber eher begrenzt.
Zukünftige Klimaänderungen, Risiken und Folgen
Wie sich der Klimawandel zukünftig entwickelt, hängt ganz
wesentlich von den künftigen Emissionen von Treibhausgasen ab,
insbesondere dem Treibhausgas Kohlendioxid. Im Klimareport wurden
vier unterschiedliche Entwicklungen ("repräsentative
Konzentrationspfade", RCP) betrachtet, die von konsequenten
Verringerungen der Emissionen von Treibhausgasen bis hin zu
ungebremsten Emissionen reichen. Risiken ergeben sich aus den
Veränderungen im Erdsystem, die nach den Modellen der Klimaforscher
mit den jeweiligen Emissionen verbunden sind, und den
Verwundbarkeiten von Ökosystemen und menschlichen Gesellschaften.
Die Temperatur der Erdoberfläche wird in jedem Fall weiter
ansteigen; dabei hängt die Temperaturerhöhung von der
gesamten Kohlendioxid-Emission durch menschliche Aktivitäten ab. Nur
bei dem Emissionsszenario mit konsequenten Verringerungen der
Emissionen (RCP 2.6) wird sie am Ende des 21. Jahrhunderts
wahrscheinlich weniger als 2 Grad Celsius betragen. Um die Erwärmung
wahrscheinlich auf weniger als 2 Grad Celsius zu begrenzen, dürfen
insgesamt nicht mehr als ca. 2.900 Milliarden Tonnen Kohlendioxid
aus menschlichen Aktivitäten freigesetzt werden; bis 2011 waren
bereit ca. 1.900 Milliarden Tonnen freigesetzt, so dass max. weitere
1.000 Milliarden Tonnen Kohlendioxid freigesetzt werden dürfen.
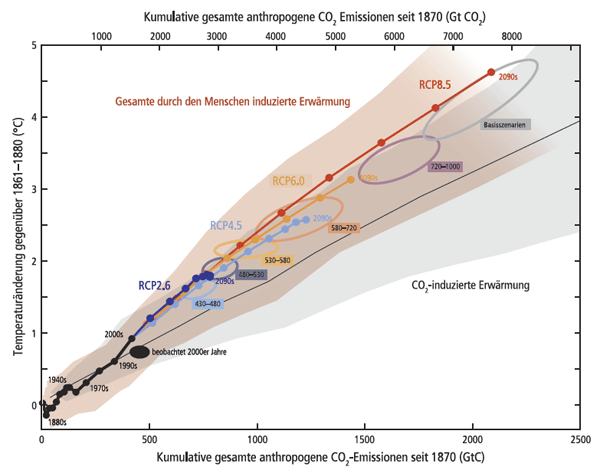
Anstieg der mittleren
Erdoberflächentemperatur in Abhängigkeit von der Gesamtmenge an
Kohlendioxid, das durch menschliche Aktivitäten in die
Atmosphäre freigesetzt wurde/wird. Schwarz dargestellt sind
Messwerte, farbig dargestellt die Freisetzung, die aus den vier
Emissionsszenarien folgt. Die farbige Fläche gibt den
Unsicherheitsbereich an. Quelle der Abbildung: Abbildung 2.3 aus IPCC: Klimaänderung 2014: Synthesebericht.
Deutsche Übersetzung durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn,
2016.
Es ist praktisch sicher, dass heiße Temperaturextreme zunehmen
werden. Die Erwärmung wird über mehrere Jahrhunderte anhalten, es
sei denn, Kohlendioxid wird aus der Atmosphäre entnommen. Mit
ansteigender Temperatur werden extreme
Niederschlagsereignisse wahrscheinlich intensiver
und häufiger, die mit dem El Niño in Zusammenhang
stehende Variabilität der Niederschläge wird sich wahrscheinlich
intensivieren. Der Ozean wird sich weiter erwärmen; und damit wird
der globale Meeresspiegel weiter ansteigen, sehr
wahrscheinlich sogar mit steigender Geschwindigkeit. Ebenfalls sehr
wahrscheinlich wird das atlantische Förderband im 21. Jahrhundert
schwächer werden – je nach Emissionsszenario zwischen 11 und 34
Prozent. Werden die Emissionen nicht gebremst, wird der
Arktische Ozean vor der Jahrhundertmitte im September
wahrscheinlich eisfrei sein. Die Aufnahme von
Kohlendioxid, das vom Menschen freigesetzt wird, in den Ozean wird
bis zum Jahr 2100 weitergehen, dadurch wird die Versauerung
des Ozeans weiter ansteigen. Nur bei konsequenter
Verringerung der Emissionen stellt sich nach der Jahrhundertmitte
eine leichte Erholung ein.
Die Zunahme der Erwärmung erhöht das Risiko schwerwiegender Folgen.
Zu den besonders schwerwiegenden Schlüsselrisiken gehören zerstörte
Existenzgrundlagen durch Sturmfluten, Meeresspiegelanstieg und
Küstenüberschwemmungen sowie durch extreme Hitzeperioden.
Insbesondere niedrig gelegene Entwicklungsländer und einige Inseln
werden mit sehr starken Auswirkungen konfrontiert sein. Auch
Flusshochwasser werden zunehmen. Extremwetterereignisse können zudem
Infrastruktur zerstören; der Klimawandel durch Ernährungs- und
Wasserunsicherheit (in trockenen Regionen könnten Dürren zunehmen)
ländliche Existenzen (insbesondere der Armen in diesen Regionen)
gefährden. Die könnte eine zunehmende Vertreibung von Menschen aus
ihrer Heimat zur Folge haben. Der Klimawandel kann zudem durch den
Verlust von Ökosystemen zum Verlust von biologischer
Vielfalt, Ökosystemfunktionen und -dienstleistungen
beitragen. So löst Klimawandel Ökosystemverschiebungen und
Artensterben aus; Korallenriffe sind etwa von der Versauerung des
Ozeans betroffen, Verschiebungen der Vorkommen von Meeresfischen
könnte die Produktivität der Meeresfischerei in tropischen Breiten
verringern. Hohe Temperaturen, Dürren und Stürme können Ökosysteme
an Land zerstören, und in diesen gespeicherten Kohlenstoff
freisetzen, was den Klimawandel weiter antreibt.
Wenn die Emissionen nicht konsequent verringert werden, wird
der Klimawandel über das Jahr 2100 hinaus andauern. Die
hiervon ausgelösten Veränderungen haben ihre eigene Zeitskala, und
können noch lange anhalten, nachdem die Oberflächentemperatur ein
neues Gleichgewicht gefunden hat: so wird der Meeresspiegelanstieg
praktisch sicher noch viele Jahrhunderte andauern. Da das Verhalten
des Antarktischen Eisschildes noch zu wenig bekannt ist, wird
wahrscheinlich der langfristige Meeresspiegelanstieg unterschätzt.
Abrupter und unwiederbringlicher Eisverlust beim Grönländischen
Eisschild und in der Antarktis mit erheblichem Anstieg des
Meeresspiegels ist möglich, die Wahrscheinlichkeit kann aber nicht
abgeschätzt werden.
Zukünftige Pfade für Anpassung, Minderung und nachhaltige
Entwicklung
Die beiden wesentlichen Antworten auf den Klimawandel heißen
Anpassung und Minderung: Anpassung bedeutet,
Verwundbarkeit und Exposition gegenüber dem Klimawandel zu
verringern; Minderung bedeutet, die Emissionen an
Treibhausgasen zu verringern und/oder Senken (Aktivitäten, die
Treibhausgase aus der Atmosphäre entfernen, wie z.B. Aufforstung) zu
fördern. Beide können sich ergänzen: Anpassung wirkt schneller als
die Minderung, kann alleine aber die Folgen des Klimawandels nicht
abfangen, langfristig ist die Minderung wesentlich wirksamer. Bei
der Entscheidung über die richtigen Maßnahmen ist zu beachten, dass
diejenigen, die durch den Klimawandel am stärksten
gefährdet werden, wenig zu den Treibhausgas-Emissionen beigetragen
haben und beitragen: wenn die wichtigsten Verursachen nur
ihre eigenen Interessen berücksichtigen, wird keine wirksame
Minderung erfolgen. Die Verteilungseffekte, die der Klimawandel mit
sich bringt, stellen auch ethische Fragen. Auch Anpassung und
Minderung bringen Risiken mit sich, etwa der Fehlanpassung oder
negative Nebeneffekte und wirtschaftliche Kosten kohlenstoffarmer
Energieerzeugung (etwa zurückgehende Erträge aus dem Export fossiler
Brennstoffe); im Unterschied zu den irreversiblen (unwiderruflichen)
Folgen des Klimawandels sind diese aber geringer und durch Anpassung
der Strategie beim Erkennen der Folgen leichter zu vermeiden;
außerdem haben sie auch bedeutsame positive Nebeneffekte (bei
kohlenstoffarmer Energieerzeugung etwa verminderte
Luftverschmutzung).
Maßnahmen zur Anpassung (siehe auch Thema 4: Anpassung und
Minderung) sind orts- und kontextspezifisch, es gibt also keine
überall geeigneten Ansätze. Ohne Minderung ist ein weiteres
Ansteigen der globalen Emissionen von Treibhausgasen zu erwarten,
die meisten Szenarien gegen von 75 bis fast 140 Milliarden Tonnen
Kohlendioxid-Äquivalent im Jahr 2100 aus (was etwa den Szenarien
RCP6.0 und RCP8.5 in der Abbildung oben
entspricht), was einer Temperaturerhöhung gegenüber der
vorindustriellen Erde von 2,5 bis 7,8 Grad Celsius entspricht. Soll
der Temperaturanstieg wahrscheinlich auf 2 Grad Celsius begrenzt
werden, darf die Kohlendioxid-Äquivalenzkonzentration im Jahr 2100
nicht mehr als 450 ppm betragen (sollen 1,5 Grad Celsius nicht
überschritten werden, dürfen 430 ppm nicht überschritten werden).
Das erfordert eine Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen
um 40 bis 70 Prozent bis zum Jahr 2050, und auf nahe Null
bis 2100 (das 1,5 Grad-Ziel erfordert eine Verringerung um
70 bis 95 Prozent bis 2050). Das bedeutet erhebliche
technische, wirtschaftliche und institutionelle Herausforderungen.
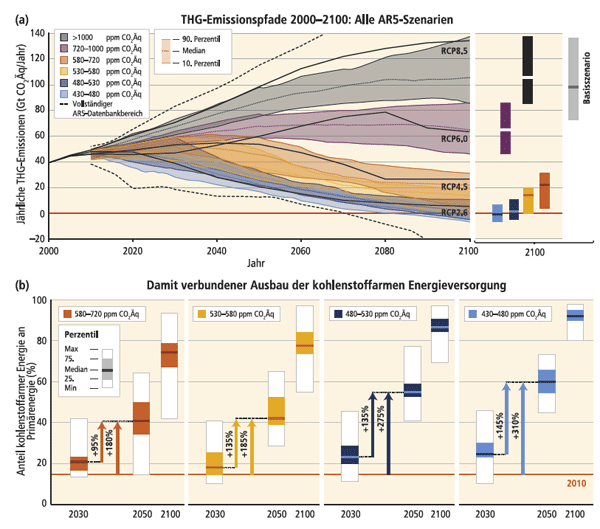
Globale Treibhausgasemissionen
(im Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent/Jahr) für
unterschiedliche Konzentrationsniveaus und notwendiger Ausbau der
kohlenstoffarmen Energieversorgung (in Prozent der
Primärenergie) bei den Minderungsszenarien. Quelle
der Abbildung: Abbildung 3.2 aus IPCC:
Klimaänderung 2014: Synthesebericht. Deutsche Übersetzung
durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016.
In vielen Szenarien wird vorübergehend eine Konzentration von
500 ppm überschritten, dann ist in der Regel die Verfügbarkeit und
der verbreitete Einsatz von Bioenergie mit Kohlenstoffabscheidung
und anderen CDR(Kohlendioxidentnahme, engl. Carbon Dioxide
Removal)-Technologien nötig, um die Erwärmung auf maximal 2
Grad zu begrenzen, deren Verfügbarkeit ungewiss und deren Nutzung
mit Risiken (das abgeschiedene Kohlendioxid muss sicher aus dem
Kreislauf entfernt werden) verbunden ist. Die Kosten der Maßnahmen,
die die Erderwärmung auf unter 2 Grad begrenzen, verringern das
(zwischen 1,6 bis 3 Prozent pro Jahr angenommene) Wachstum um 0,06
(0,04 bis 0,14) Prozent pro Jahr. Verzögert sich der Beginn der
Maßnahmen bis zum Jahr 2030, sind zwischen 2030 und 2050 wesentlich
höhere Emissionsminderungen nötig, um die 2-Grad-Grenze nicht zu
überschreiten, dazu kommen eine größere Abhängigkeit von
CDR-Technologien und höhere Kosten. Die bisherigen
Selbstverpflichtungen zur Emissionsminderung reichen nicht aus,
die Temperaturerhöhung auf 2 Grad zu begrenzen.
Der Klimawandel bedroht natürliche Systeme und belastet
insbesondere die Armen, damit ist er eine Bedrohung für
eine gerechte und nachhaltige Entwicklung. Anpassung
und Minderung sind daher auch für eine nachhaltige
Entwicklung wichtig, können aber auch negative Nebeneffekte
haben (z. B. Rückgang der biologischen Vielfalt und der
Ernährungsvielfalt). Richtig geplant, haben sie aber
erhebliche positive Nebeneffekte, etwa verbesserte
Luftqualität, erhöhte Energiesicherheit, nachhaltige Forst- und
Landwirtschaft und Schutz von Ökosystemen als Kohlenstoffspeicher
und Lieferanten anderer Ökosystem-Dienstleistungen.
Anpassung und Minderung
Mit Anpassungs- und Minderungsmaßnahmen können die Folgen des
Klimawandels gemindert werden, sie brauchen aber ein förderliches
Umfeld. Wenn etwa energieintensive Lebensstile zunehmen oder Städte
sich in gefährdeten Lebensräumen wie Küsten ausbreiten, kann die
Verwundbarkeit auch zunehmen. Vor allem in Entwicklungsländern
werden aufgrund fehlender finanzieller, technologischer und
institutioneller Fähigkeiten notwendige Anpassungsmaßnahmen nicht
ausreichend umgesetzt.
Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Anpassung gehört etwa das
Wassermanagement mit Einführung wassersparender
Technologien, ein integriertes Küstenzonenmanagement
und der Schutz von Lebensräumen, die vom
Klimawandel gefährdet werden, vor nicht-klimatischen Faktoren wie
Lebensraumveränderung oder Verschmutzung oder die Züchtung
von Pflanzensorten, die an höhere Temperaturen und Dürren
angepasst sind sowie die Verbesserung der Fähigkeit zur
Katastrophenvorsorge. Bei den Maßnahmen zur Anpassung
kann es positive wie auch negative Nebeneffekte geben, so schützt
ein integriertes Küstenzonenmanagement gleichzeitig vor Tsunamis
oder hilft ein verbessertes Gesundheitssystem nicht nur bei der
Bewältigung von Hitzewellen, sondern auch von anderen
Herausforderungen. Andererseits kann etwa der vermehrte Eintrag von
Düngern und Pestiziden, um klimabedingte Ertragsrückgänge zu
kompensieren, den Eintrag von Düngern und Pestiziden in die Umwelt
erhöhen oder können Maßnahmen des Küstenzonenmanagements
Küstenfeuchtgebiete zerstören.
Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Minderung gehört der Ausstieg
aus der Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen: alle
Szenarien zur Begrenzung der Erderwärmung auf höchstens 2 Grad
Celsius gehen von einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen aus
der Energieversorgung um 90 Prozent oder mehr zwischen 2040 und 2070
aus. Hinzu kommen Effizienzsteigerungen und Verhaltensänderungen,
die den Energieverbrauch verringern, die Zeit für den
Umstieg schaffen. Auch im Verkehr muss der Energieverbrauch deutlich
sinken (hier stellen die Energiespeicherung und die geringe
Energiedichte alternativer Energieträger eine Herausforderung für
die Dekarbonisierung dar); im Gebäudesektor muss der globale
Energieverbrauch stabilisiert werden und auch die Industrie muss
Energie effizienter nutzen. Auch bei den Minderungsmaßnahmen gibt es
mögliche positive und negative Nebeneffekte: Der Ausstieg aus
fossilen Energieträgern mindert Luftverschmutzung und die
Umweltfolgen des Kohlebergbaus, aber die Nutzung der Atomenergie
bringt die Möglichkeit von Atomunfällen, die ungeklärte Entsorgung
radioaktiver Abfälle mit sich, die Nutzung von Bioenergie kann zum
Aufbau von großflächigen Monokulturen führen und damit
Ökosystemdienstleistungen gefährden, außerdem sind negative Folgen
für die Welternährung möglich. Neben der Energieversorgung und
-nutzung können insbesondere Land- und Forstwirtschaft relevante
Beiträge zur Minderung des Klimawandels leisten, etwa durch Aufforstung
und nachhaltige Forstwirtschaft.
Da Treibhausgase sind in der Atmosphäre verteilen und lange dort
verbleiben, ist eine internationale Zusammenarbeit
zur Bekämpfung des Klimawandels notwendig. Das wichtigste Forum ist
das UN-Rahmenübereinkommen über
Klimaänderungen, das durch koordinierte nationale, regionale
und lokale Aktivitäten ergänzt werden muss. Im Jahr 2012 unterlagen
67 Prozent der globalen Emissionen an Treibhausgasen nationalen
Gesetzen oder Strategien, die haben aber bisher nicht zu
einem substanziellen Rückgang der Emissionen geführt. So
scheiterten etwa viele Bemühungen, Kohlendioxidemissionen über ein
Emissionshandelssystem zu begrenzen, an zu lockeren Obergrenzen.
Erfolgreich waren Subventionen für erneuerbare Energien,
aber auch fossile Brennstoffe werden subventioniert, ihr Wegfall
dürfte weitere Emissionsminderungen bewirken. Umweltwirksam sind
auch die Einführung von Energieeffizienzstandards.
Auch in Ländern ohne Klimaschutzprogramme gibt es subnationale
Aktivitäten, etwa Netzwerke von Städten, die eine
kohlenstoffarme Entwicklung anstreben. Zur Unterstützung der
besonders betroffenen Entwicklungsländer sind die
Übertragung von Technologien und Management-Verfahren
wünschenswert.
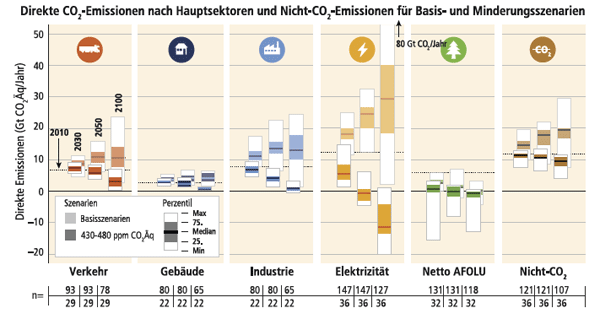
Kohlendioxid-Emissionen nach
Sektoren und andere Treibhausgase sektorengreifend in
den Jahren 2010 und Projektion für die Jahre 2030, 2050 und 2100 für
Basisszenarien und Szenarien, die zu einer Stabilisierung der
Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre bei 430-480 ppm führen
würden. Quelle der Abbildung: Abbildung SPM. 14 aus IPCC:
Klimaänderung 2014: Synthesebericht. Deutsche Übersetzung
durch Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016.
Insgesamt wäre für eine wirksame Verringerung der Emissionen ein
geändertes Investitionsmuster notwendig: Soll die
atmosphärische Kohlendioxid-Konzentration nicht weiter ansteigen,
darf weniger Geld in fossile Brennstofftechnologien fließen (-20
Prozent pro Jahrzehnt), die Investitionen in kohlenstofffreie
Stromversorgung müssen sich verdoppeln. Auch die Investitionen in
Energieeffizienz müssen deutlich ansteigen. Um negative Nebeneffekte
möglichst zu vermeiden, sollte die nachhaltige Entwicklung als
übergreifendes Konzept der Klimapolitik verstanden werden, damit
diese nicht zu Lasten etwa der Umweltqualität oder der
Ernährungssicherheit geht, sondern die positiven Nebeneffekte zur
Verbesserung auch der sozialen und ökologischen Bedingungen nutzt.
Weitere Informationen
Die deutsche Übersetzung des Syntheseberichts
ist auf der Webseite der deutschen IPCC-Koordinierungsstelle zum
Download verfügbar: IPCC:
Klimaänderung 2014: Synthesebericht. Deutsche Übersetzung durch
Deutsche IPCC-Koordinierungsstelle, Bonn, 2016 (pdf, 10 MB).
Die offizielle englischsprachige Fassung kann auf der Website des
IPCC hier
heruntergeladen werden (pdf, 10 MB).
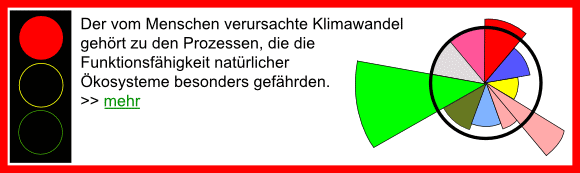
Weitere Seiten zum
Klimawandel (Ökosystem Erde)
Zur Energiewende
und zu den Strategien für die zukünftige
Energieversorgung
Zurück zu:
Übersicht
Industriezeitalter