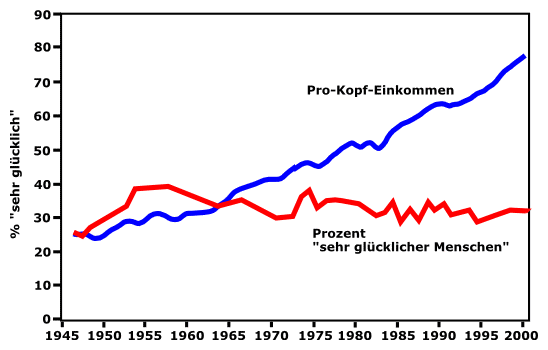Strategien für die Zukunft
Was macht Menschen
wirklich glücklich?
Der materielle Reichtum durch die industrielle
Revolution hat die Menschen nicht glücklicher gemacht. Heute wissen
wir: zum Glück trägt die Herstellung von Gütern nur bei, solange sie
der Grundversorgung dienen. ist diese gesichert, werden andere
Bedürfnisse wie gute soziale Beziehungen wichtiger – die aber durch
das Wirtschaftswachstum gefährdet werden. Das Ende des
Wirtschaftswachstums kann also eine Chance sein, glücklicher zu
werden.
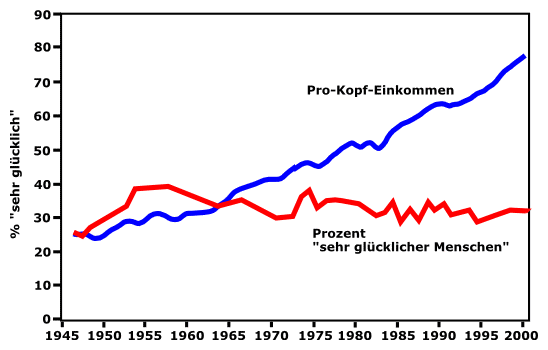
Das Einkommen steigt, das Glück
nicht: Das Beispiel USA. (Einkommen nach US Department of
Commerce, Bureau of Economic Analysis, Glück bis 1971 American
Institute of Public Opinion (AiPO), ab 1972 US-General Social Survey
(GSS); nach >> Layard
2005.)
Als die Wirtschaftswissenschaften entstanden, war das Glück noch
ein Thema: Der englische Philosoph Jeremy Bentham
(1748 – 1832) etwa begründete die Theorie vom Nutzenprinzip
(Utilitarismus), nach der bei jeder Handlung der Nutzen im
Vordergrund stehen sollte. Nutzen war für Bentham die “Schaffung von
Wohlergehen, Vorteil, Freude, Gutem oder Glück”, anzustreben das
“größtmögliche Maß an Glück”. Benthams Schüler John Stuart
Mill entwickelte die Theorie weiter: gut war für ihn eine
Handlung, die das Glück befördert; schlecht eine, die zu Leiden
führt. Mill wies auch darauf hin, dass damit nicht das Luststreben
gefördert wurde (wie den Utilitaristen oft vorgeworfen), sondern in
erster Linie geistige Erfüllung und “happiness”
(dauerhaftes Glück im Sinne von Lebenszufriedenheit, im Gegensatz
zur körperlichen “pleasure”) gemeint sei. Dieses Glück war
aber als psychologische Größe nicht objektiv messbar; und daher
setzte sich in den Wirtschaftswissenschaften eine andere Definition
des “Nutzens” durch: Als Maß für die Fähigkeit, die Bedürfnisse
eines wirtschaftlichen Akteurs zu befriedigen. Dem Nutzen stehen die
Kosten entgegen. Entscheidet sich also jemand, 150 Euro für ein Paar
Schuhe auszugeben, ist ihr Nutzen damit objektiv in einer leicht
vergleichbaren Einheit festgelegt. Was dem Menschen gut tut, konnte
man messen, indem man zusammenzählte, wofür er Geld ausgab. Heute
wird aber immer deutlicher, dass rein finanzielle Messinstrumente
uns in die Irre führen (mehr);
und inzwischen glauben Wissenschaften wie die Psychologie und die
Hirnforschung Zufriedenheit und Glück ausreichend genau messen zu
können, um bedeutungsvolle Aussagen ermöglichen zu können.
Wachstum ist nicht gleich Glück, und der Mensch kein Homo
oeconomicus
Subjektive Werte wie Zufriedenheit und Glück werden am einfachsten
gemessen, indem man die Menschen – mit verschieden komplexen
Methoden – selber fragt. Dass diese Aussagen ziemlich verlässlich
sind, legen Vergleiche der Ergebnisse mit anderen Messgrößen nahe,
etwa der Aussage von Ehepartnern oder Freunden oder von
Stressanzeigern wie Frequenz des Herzschlags oder Blutdruck. In
jüngster Zeit kommen Untersuchungen der Hirnaktivität dazu: Aussagen
über Zufriedenheit und Glück stimmen recht gut mit EEG-Messungen der
Gehirnaktivitäten in Regionen überein, die bei angenehmen
Erlebnissen tätig werden. Vor allem zwei Ergebnisse dieser Forschung
widersprechen den Annahmen der klassischen
Wirtschaftswissenschaft. Erstens: die Befriedung von
Bedürfnissen führt keineswegs immer zu höherer Zufriedenheit und
mehr Glück; und zweitens: der Mensch weiß nicht immer, was ihn
glücklich macht, kann also gar nicht objektiv handeln (was zudem ein
Grund ist, den objektiven Charakter der modernen Nutzendefinition zu
hinterfragen).
- Zu 1: Fragt man die Menschen, wie glücklich sie sind, zeigen
beispielsweise die Ergebnisse in den USA seit den 1950er Jahren
keine Steigerung, obwohl das Pro-Kopf-Einkommen sich seither
verdreifachte, siehe Abbildung oben. (Diese Stagnation wurde
erstmals in einem 1974 von Richard Easterlin
veröffentlichten Aufsatz gezeigt; seine Untersuchung gilt heute
als der Auslöser einer ganzen Serie von Nachfolgeuntersuchungen.)
In anderen reichen Industriestaaten sieht es ähnlich aus; in
Deutschland stieg die Zufriedenheit seit 1975 nicht mehr. Zwar
sind solche Befragungen heikel, man soll ja in Minuten (die das
Interview dauert) die Bilanz von Jahrzehnten Leben ziehen, aber
Tendenzen dürften wohl stimmen – zumal sich im Vergleich armer und
reicher Staaten ein anderer Verlauf zeigt. In armen Staaten steigt
das Wohlbefinden mit steigendem Einkommen – bis die
Grundversorgung gesichert ist. Ab einem Jahreseinkommen von 10.000
US-$ knickt die Kurve ab, der Zusammenhang ist nicht mehr
eindeutig; ab einem Jahreseinkommen von etwa 20.000 US-$ gibt es
keinen Zusammenhang mehr zwischen Wohlbefinden und Einkommen.
Solange materielle Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnung, Kleidung
nicht befriedigt sind, ist eine wachsende Wirtschaft für das
menschliche Wohlbefinden hilfreich; danach aber wird bald eine
Grenze erreicht, an der die negativen Seiten (siehe unten)
den Einfluss auf Zufriedenheit und Glück übertreffen (ähnlich dem
“unwirtschaftlichen Wachstum, siehe
hier). Daher finden sich die glücklichsten Menschen nach
verschiedenen Untersuchungen auch nicht in den reichsten Ländern,
sondern etwa in der Karibik und in Skandinavien.
- Zu 2: Seit längerem bestehen Zweifel, ob der Mensch wirklich der
rationale, auf der Grundlage vollständiger Informationen objektive
Entscheidungen treffende Homo oeconomicus ist, von dem die
klassischen Ökonomen ausgehen. In Experimenten zeigte sich, dass
der Mensch nicht immer rational entscheidet: So fürchten Menschen
etwa Verluste mehr, als sie auf Gewinne hoffen; auch beeinflussen
verzerrte Wahrnehmungen ihre (Kauf-)Entscheidungen. Für diese
Einbeziehung psychologischer Erkenntnis in die Ökonomie erhielt
der israelisch-amerikanische Psychologe Daniel Kahneman
im Jahr 2002 gemeinsam mit dem amerikanischen Ökonomen Vernon L.
Smith den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Kahneman
beschäftigte sich auch mit dem Glück, und fand heraus, dass auch
unsere Glückserwartungen nicht objektiv sind. Fragt man Menschen,
überschätzen sie vor allem den Nutzen von materiellen Gütern. So
wird das Glück überschätzt, das ein höheres Gehalt oder ein
Lottogewinn, ein größeres Haus oder ein größeres Auto mit sich
bringen. Umgekehrt wird der Nutzen sozialer Beziehungen
unterschätzt. Auch bei den Glückserwartungen haben wir also
verzerrte Wahrnehmungen. Außerdem fanden Kahneman und Kollegen
heraus, dass Kaufentscheidungen oftmals überschlägig – ohne
sorgfältige Abwägung aller Alternativen – getroffen werden. Der
rationale Homo oeconomicus war wohl eine Fiktion.
Was macht uns glücklich?
Zum einen müssen, siehe oben, die materiellen Grundbedürfnisse
erfüllt sein: Ohne ein Dach über dem Kopf, Kleidung, Nahrung und
Wasser sind Menschen messbar unglücklicher. Sind diese
sichergestellt, sind Aktivitäten wichtiger als Dinge,
wirken sich Erlebnisse positiver aus als Anschaffungen. Dann
bestimmen die “psychischen Grundbedürfnisse” unser Wohlbefinden: Das
wichtigste ist Liebe und Freundschaft – Menschen
müssen in soziale Beziehungen eingebunden sein, brauchen den
Austausch und Vertrautheit oder Freundschaft mit anderen Menschen.
Danach kommen Selbstbestimmung und das Gefühl,
etwas sinnvolles zu tun. Damit in Zusammenhang stehen
Selbstwirksamkeit – Menschen wollen sich selbst als erfolgreich und
wirksam erleben – und Autonomie – Menschen müssen in Übereinstimmung
mit eigenen Werten und Einstellungen leben können. Daher sind
Menschen in Ländern mit hoher Toleranz und
Mitbestimmungsmöglichkeiten glücklicher als in Ländern, wo beides
weniger verbreitet ist. Arbeitslosigkeit zum Beispiel macht
unglücklich, da bei der Arbeit soziale Kontakte gepflegt und das
Selbstwertgefühl gestärkt werden können – auch dies übrigens ein
Widerspruch zu den Annahmen vieler klassischer Ökonomen, die die
Arbeit nur als Last sehen, die man gegen angemessene Entschädigung
(Bezahlung) auf sich nimmt. Was bei Aktivitäten – auch bei der
Arbeit – ebenfalls glücklich machen kann, ist der von Mihaly
Csikszentmihalyi “Flow” genannte Zustand, bei dem man völlig in
seiner Tätigkeit aufgeht.
Was braucht der Mensch?
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 steht:
“Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und
seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden einschließlich Nahrung,
Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und der notwendigen
Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet...” – Wasser in diese
Liste aufzunehmen, darum wird seit den 1990er Jahren gekämpft. Was
aber für das Wohlbefinden sonst noch nötig ist und zu den
notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gehört, hängt auch von
der Kultur ab, in der man lebt: Der Mensch vergleicht sich immer mit
seinen Mitmenschen, und in Konsumgesellschaften bestimmen materielle
Güter den Status. In Deutschland etwa gehören Telefon, Fernseher und
Internet längst zu den materiellen Grundbedürfnissen. Da es um
Status geht, sind materielle Bedürfnisse nicht zu stillen, macht
ihre Befriedigung nicht wirklich froh. Oder sie sollen – aber können
nicht – etwas ersetzen, das wirklich fehlt.
Einer der ersten, der diese These vertrat, war im Jahr
1976 Erich Fromm mit seinem Buch “Haben oder
Sein”. Fromm vertrat die Ansicht, dass die wahren Bedürfnisse des
Menschen nur durch produktives Tätigsein zu erfüllen wären, und ist
damit ein Vorläufer von heutigen Philosophen wie Martha
Nussbaum, für die zu einem gelingenden Leben (und damit
Wohlergehen) in erster Linie die Entfaltung von Fähigkeiten gehören,
die in der menschlichen Natur angelegt sind. Zu diesen Fähigkeiten
gehören unter anderem die Fähigkeit, seine Sinne und seine Phantasie
zu gebrauchen, Beziehungen zu Dingen und Menschen außerhalb unser
selbst einzugehen, andere Menschen zu verstehen und Anteil an ihrem
Leben zu nehmen, zu lachen, zu spielen und sein eigenes Leben zu
leben (Martha Nussbaum 1999: Gerechtigkeit oder Das Gute Leben).
Warum Wirtschaftswachstum uns nicht glücklich machen kann – und
sein Ende uns nicht unglücklich machen muss
Die zahlreichen Güter, die uns die Industriegesellschaft zur
Verfügung stellt, machen uns aus zwei Gründen nicht glücklicher:
Erstens gewöhnen wir uns an sie. Was vor zwei oder drei Jahrzehnten
noch ein Luxus für wenige war, ist heute für alle mehr oder weniger
selbstverständlich – man vergleiche nur die Ausstattung heutiger
Kleinwagen mit der Oberklasse von 1970. (Gewöhnung ist hilfreich,
wenn sich unsere Situation verschlechtert – sie ist eine Art
Versicherung gegen Unglücklichsein.) Zweitens sind manche Dinge, die
tatsächlich dauerhaft das Wohlbefinden erhöhen, von Natur aus knapp:
Eine höhere Position im Beruf etwa kann nicht jeder haben – sie ist
relativ zu den anderen Positionen und kann nicht vermehrt werden.
Auch ein größeres Auto ist nicht dauerhaft – haben meine Nachbarn
und Kollegen gleichgezogen, ist das größere Auto “normal” – auf zur
nächsten Runde! Alle anderen brauchen das größere Auto dann aber
nicht, um ihr Glück zu steigern, sondern um in der sozialen
Hierarchie nicht zurückzufallen und sich dadurch schlechter zu
fühlen.
Es gibt Forscher, z.B. Richard Layard, Direktor an der London
School of Economics, die aus den oben genannten Gründen eine
Umorientierung der Politik fordern: Nicht Wirtschaftswachstum,
sondern das größtmögliche Glück für alle sollten zum obersten Ziel
der Politik werden (siehe sein Buch Die
glückliche Gesellschaft). In armen Ländern könnte dieses
Wirtschaftswachstum bedeuten, bis die materiellen Grundbedürfnisse
gedeckt sind; in reichen Ländern stünden aber andere Maßnahmen an:
Etwa Steuern auf Arbeit, damit sich diese weniger lohnt – dieses
würde den Statuswettlauf beenden und die Familien stärken.
Diese Vorstellung ist durchaus umstritten. Wie könnte ein solcher
Staat im internationalen Wettbewerb bestehen? (Waren nicht immer in
der Weltgeschichte fanatische, militante Verächter des größten
Glücks der größten Zahl den Reichen und Zufriedenen überlegen, wie Wolf
Schneider sagt?) Was ist mit anderen Staatszielen, wie
Solidarität und Verantwortung? Wie lässt sich verhindern, dass nach
Glück für alle strebende Politiker sich irren? Gar eine Diktatur des
Glücks entsteht? (“Von allen politischen Idealen ist der Wunsch, die
Menschen glücklich zu machen, vielleicht der gefährlichste.” – Karl
Popper). Aber in den Diskussionsprozess einfließen und die bisherige
einseitige Orientierung am Wirtschaftswachstum ergänzen sollten
diese Erkenntnisse in jedem Fall. Für das Thema dieser Webseite sind
sie insofern aufschlussreich, dass eine zukunftsfähige, nicht auf
unendliches Wachstum basierende Wirtschaft nicht heißen muss, dass
es uns anschließend schlechter geht – im Gegenteil, sie wäre eine
Chance, uns wieder mehr auf solche Aktivitäten zu konzentrieren, die
wirklich zu unserem Glück beitragen.
Die Erfüllung der psychischen Grundbedürfnisse
steht nämlich oft in Konflikt mit den Anforderungen des materiellen
Wohlstands: Wie soll man Freundschaften pflegen, wenn im Beruf
Mobilität gefragt ist? Wie kann man sich selbst als wirksam erleben,
wenn man ein kleines Rad in einem globalen Konzern ist? Außerdem
sind viele Menschen im Beruf in etwas gefangen, das die
Glücksökonomen “Statustretmühle” nennen: Um auch
nur mithalten zu können, müssen sie immer mehr arbeiten – und werden
immer gestresster und unfähiger, das Leben zu genießen. Und so kommt
es, dass Menschen, die ihr Leben vor allem dem Gelderwerb gewidmet
haben, in besonderem Maße an Angstzuständen und Depressionen leiden.
Die Autoren einer kürzlich erschienen Studie, die Psychologen
Richard Ryan und Tim Kasser, nannten ihre erste Studie zum Thema
“die Kehrseite des amerikanischen Traums”. Sie gilt nicht nur in
Amerika, sondern die Ergebnisse bestätigten sich auch in 11 anderen
Ländern. Und allen Anstrengungen zum Trotz nimmt die soziale
Ungleichheit zu: In den USA besitzen die reichen 5 Prozent der
Bevölkerung mehr als die übrigen 95 Prozent zusammen; verdienen
Unternehmenschef über 500-mal soviel wie ihre Mitarbeiter. Eines
haben aber alle von diesem Fortschritt: das Leben wird immer weiter
beschleunigt, es fehlen Ruhe und Zeit für Geselligkeit und
Kreativität. Beides trägt dazu bei, dass soziale Indikatoren in
vielen Industriestaaten ein Anwachsen der Probleme anzeigen: der
Zahl der Selbstmorde, die Häufigkeit von Depressionen, des Ausmaßes
des legalen und illegalen Drogenkonsums.
Wir brauchen eine kulturelle Revolution
Wenn dies so ist, warum ändern wir dann unser Verhalten nicht?
Warum tun wir nicht das, was uns glücklich macht? Wer das Verhalten
von uns Menschen verstehen will, muss sich unsere
Entwicklungsgeschichte (hier)
in Erinnerung rufen. Unser wichtigster Vorteil gegenüber anderen
Tieren war unser Gehirn, unser “Überlebensorgan” (mehr).
Das Gehirn ist auch der Entstehungsort positiver Gefühle: Mit
positiven Gefühlen wird Verhalten belohnt, das im Laufe der
Evolution unser Überleben sicherte. Ein Beispiel: zur Fortpflanzung
des Menschen braucht es Sex – also wird Sex mit intensiven
Glücksgefühlen “belohnt”. Der Mensch konnte große Tiere nur erlegen,
wenn er sie nicht alleine jagte, sondern in der Gruppe – und daher
können Psychologen heute soziale Beziehungen als psychisches
Grundbedürfnis entdecken. Der Mensch entwickelte sich aber in einer
Zeit, in der mit konkurrierenden Sippen und knappen Ressourcen leben
musste – nehmen, war zu kriegen war, war eine gute
Überlebensstrategie. Instinktiv essen wir daher gerne – in einer
Zeit des Überangebots kann dieses aber zu epidemischer Fettsucht
führen. Und so gilt “mehr ist besser” fast immer – und hat fast
immer negative Folgen. Die Evolution bietet dafür keine Lösung; der
Mensch kannte während seiner Evolution eben kaum Situationen, wo die
Gefahr eines Zuviel bestanden hätten. 250 Jahre Industrielle
Revolution sind nur ein Augenblick für die Evolution, sie konnten
kaum Spuren hinterlassen.
Dazu kommt: Unser Gehirn arbeitet äußerst ökonomisch. Psychologen
wissen längst, dass die menschliche Informationsverarbeitung nicht
nur bei Kaufentscheidungen (siehe oben), sondern eigentlich immer
nur auf ausgewählten, verzerrten Wahrnehmungen beruht. Das Gehirn
vermeidet etwa, bereits gelernte Inhalte in Frage zu stellen – das
spart Arbeit, und hat sich in der Evolution offenbar bewährt. Das
führt dazu, dass wir Unsicherheiten – etwa bei den
wissenschaftlichen Erkenntnissen über Umweltveränderungen – gerne so
interpretieren, dass sie zu unseren Voreinstellungen passen: Wer die
Situation ohnehin verharmlost, fühlt sich bestätigt – und wer
dramatisiert, auch! Diese Tendenz führt aber insgesamt dazu, dass
wir Veränderungen (die ja unser bisheriges Wissen in Frage stellen)
eher ablehnen; wir ziehen ein bekanntes Übel dem Unbekannten in der
Regel vor. Selbst wenn es besser wäre. (Schon unser Urteil über das
Glück vergangener Zeiten ist meist unzutreffend, da von heutigen
Werten beeinflusst – Jacob Burckhardt: Über Glück und Unglück in der
Weltgeschichte). Auch die Furcht vor Verlusten, die größer ist als
die Hoffnung auf Gewinne, hält uns von Veränderungen ab.
So gesehen ist unsere biologische Ausstattung eher konservativ.
Aber andererseits: Unsere Stärke ist die Flexibilität, die das
Gehirn möglich macht. Der aus den Savannen Afrikas kommende Mensch
hat so gelernt, Auto zu fahren und Flugzeuge zu fliegen. Die
Geschichte hat gezeigt, dass wir sogar Opfer bringen, wenn wir die
Gründe verstehen und wenn die Einschränkungen gerecht verteilt
werden. So wurden in England die Einkommensverluste während des
zweiten Weltkriegs akzeptiert. (Aber wie George Orwell schrieb,
“eine Lady im Rolls-Royce kann schlechter für die Moral sein als
Görings Bomber” – diese Akzeptanz gilt nur, solange alle
gleichermaßen betroffen sind.) Wir sollten also auch in der Lage
sein, “natürliche” Verhaltensweisen wie das “immer mehr” als aus
anderen Zeiten kommend zu erkennen und mittels unserer Kultur unter
Kontrolle zu bringen (siehe auch >>
hier). Genauso wie wir lernen können, dass zuviel Zucker nicht
gut für unsere Gesundheit ist, können wir lernen, dass noch mehr
Dinge uns nicht glücklich machen, aber unsere Lebensgrundlagen
zerstören können – und unsere politischen Zielsysteme diesen
Erkenntnissen anpassen. Dabei können wir nur gewinnen – weniger
unliebsame Überraschungen durch die Zerstörung der Grundlagen
unseres Lebens zum einen; ein besseres Leben zum anderen – und das
gute Gefühl, das wir so die Bedürfnisse aller Menschen anerkennen,
unsere gegenseitigen Abhängigkeiten verstehen und wirklich zu einer
Menschheit werden, gibt es noch dazu.
Weiter mit:
Handeln
für eine bessere Zukunft