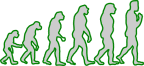Achtung! Diese Seite wird nicht weiter gepflegt. Die aktuelle Fassung finden Sie auf >> www.oekosystem-erde/html/mensch_gehirn.html. Bitte aktualisieren Sie eventuelle Lesezeichen.
Der Mensch
Hintergrundinformation
Was den Menschen
besonders macht:
Das Gehirn und die Sprache
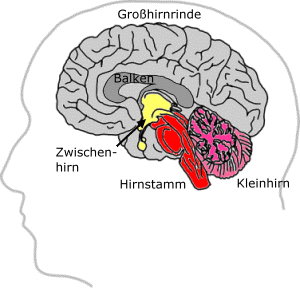
Das menschliche Gehirn zeichnet sich vor allem durch den großen stirnnahen Teil der Großhirnrinde aus, hier laufen höhere geistige Prozesse ab. Eigene Zeichnung (Zwischenhirn, Hirnstamm und Kleinhirn sowie der die beiden Großhirnhälften verbindende Balken im Schnitt).
Das Gehirn
Schon bei den ältesten Arten von Homo ist das Gehirn fast doppelt so groß wie bei den Australopithecinen; beim Neandertaler und bei Homo sapiens etwa drei Mal so groß. Nichts erklärt den Erfolg des modernen Menschen auf der Erde (>> mehr) besser als das Gehirn: Es ermöglichte, dass eine Art ohne besondere körperliche Stärken durch flexibles Verhalten nahezu alle Lebensräume der Erde besiedelte. Und doch stellt das Wachstum des Gehirns während der Evolution des Menschen die Wissenschaftler vor offene Fragen. Ein großes Gehirn hat nämlich auch Nachteile: Zum einen einen hohen Energieverbrauch - das Gehirn macht beim Menschen keine drei Prozent des Körpergewichts aus, braucht aber schon in Ruhe 20 Prozent der Energie, bei Gebrauch noch mehr. Der hohe Protein- und Energiebedarf für Aufbau und Erhalt des Gehirns wurde durch den Übergang zu enem höheren Anteil an Fleisch in der Nahrung sichergestellt. Zum anderen schuf es das Gehirn ein anatomisches Dilemma - ein großes Gehirn braucht einen großen Kopf, ein größerer Kopf hätte zur Geburt eigentlich ein breiteres Becken erfordert; das ist aber mit dem aufrechten Gang nicht vereinbar. Die Lösung für dieses zweite Dilemma war die frühere Geburt – Menschenkinder kommen in einem früheren Entwicklungsstadium auf die Welt als Schimpansenbabys und entwickeln sich außerhalb des Mutterleibes weiter. Im Vergleich zum Schimpansenbaby ist vor allem der Körper im Vergleich zum Kopf unterentwickelt; und menschliche Babys erreichen erst im 17. Monat die Geschicklichkeit gerade geborener Schimpansen. Es dauert nach der Geburt etwa ein Jahr, bis es stehen kann und laufen lernt. Dabei half nun der aufrechte Gang wieder: Menschliche Mütter (oder andere Mitglieder des Clans) können Babys in den Armen halten, während sich Schimpansenbabys am Rücken der Mütter festklammern. Der unterentwickelte Körper der Menschenbabys führt also zu einer langen nachgeburtlichen Entwicklungsphase, Schimpansen erreichen die Pubertät viel früher als Menschenkinder.
Aber womöglich hat gerade die lange Phase, in der die Menschenbabys von der Fürsorge ihrer Gruppe abhängig sind, das menschliche Fürsorge- und Sozialverhalten gestärkt: Nach dieser Ansicht hat die gemeinsame Fürsorge für die Kinder bei der Gattung Homo zu einem weiteren Wachstum des Gehirns geführt, da diese verbesserte Formen der Kooperation erforderte. Das Leben in sozialen Gruppen gilt aber ohnehin als wesentliche Ursache für das große Gehirn der Menschenaffen (siehe nächster Abschnitt), und daher sollte verbesserte Kooperation ein weiteres Wachstum des Gehirns bewirken. Auf jeden Fall hat die gemeinsame Fürsorge unser Sexualverhalten geändert: Um über die lange Zeit der Abhängigkeit hin den Vater (anders als bei den Schimpansen) in die Sorge um das Kind einzubinden, sind Menschenfrauen ständig liebesbereit, nicht mehr nur zur Paarungszeit - die Väter werden mit Sex bei der Stange gehalten. Die lange Entwicklungszeit der Kinder sollte dem Menschen noch aus einem weiteren Grund zum Vorteil gereichen: Sein Gehirn war früher und länger als das seiner äffischen Vorfahren den Reizen der Außenwelt ausgesetzt, es hatte also mehr Zeit, während der Individualentwicklung die genetisch angelegten Verknüpfungen zu überformen und an die realen Gegebenheiten seiner Umwelt anzupassen (>> hier) und so seine in der Größe angelegte geistige Überlegenheit voll entfalten. Aber das große Gehirn des Menschen hat noch einen Nachteil: Es ist sehr empfindlich und kann leicht verletzt werden. Da es sich trotzdem in der Evolution durchgesetzt hat, müssen seinen Nachteilen aber jederzeit entsprechende Vorteile gegenüberstehen.
Welche Vorteile hat ein großes Gehirn?
Offensichtlich war der wesentliche Vorteil zunächst nicht hauptsächlich der technische oder kulturelle Fortschritt, etwa bei der Herstellung oder dem Gebrauch von Werkzeugen: Da gab es über eine Millionen Jahre bis hin zum Neandertaler nur graduelle Fortschritte, die weit hinter der Zunahme der Gehirngröße zurückbleiben. Daher suchen Forscher heute die Antwort eher im komplexen Sozialleben des frühen Menschen. Der Erforschung der Menschenaffen zeigt immer deutlicher, dass auch diese den größten Teil ihrer Intelligenz für ihr Sozialleben brauchen (>> hier); und so scheint es auch beim Menschen gewesen zu sein. Hier könnte ein sich selbst verstärkender Regelkreis in Gang gesetzt worden sein: Ein komplexes Sozialleben bedeutete eine Überlebensvorteil für den als Einzelwesen seinen Konkurrenten körperlich unterlegenen Menschen, brauchte aber Intelligenz, die auf ein komplexeres Gehirn zurückging; und Intelligenz ermöglichte wiederum ein komplexeres Sozialleben (siehe hierzu auch unten: >> Die Sprache). Wenn man das Verhältnis zwischen Gehirngröße und Größe der typischen sozialen Gruppe von Menschenaffen auf Menschen hochrechnet, können Menschen intensivere soziale Beziehungen zu 150 Individuen pflegen: Und tatsächlich ist dies die durchschnittliche Gruppengröße bei Jäger- und Sammler-Clans. Weitere Faktoren mögen hinzugekommen sein, etwa die oben erwähnte frühe Geburt der Menschenkinder: Gruppen, in denen die Mitglieder die Mütter unterstützen, zogen erfolgreicher Nachwuchs groß - auch diese Konsequenz des größeren Gehirns förderte letztendlich ein komplexes Sozialleben. Auf jeden Fall entstand im Laufe der Zeit ein einzigartiges Organ, die komplexeste bekannte Struktur im Universum: Das menschliche Gehirn, das aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen besteht, von denen jede mit Hunderten oder gar Tausenden von anderen Nervenzellen verknüpft ist - insgesamt bis zu 500 Billionen (500.000 Milliarden) Verknüpfungen. Diese Verknüpfungen und die damit möglichen elektrischen Schaltkreise führen irgendwie zu Intelligenz und Bewusstsein (siehe auch >> Kasten) - wie dieses genau geschieht, versucht die moderne Hirnforschung zur Zeit zu erkunden; hier verläuft eine der Grenzen unseres Wissens.
Das Gehirn
Schon einfache Einzeller können auf Reize aus der Umgebung reagieren:
Rezeptoren genannte Moleküle werden dabei gereizt und erzeugen chemische
Signale, die eine Reaktion auslösen - beispielsweise eine Bewegung hin zur
Nahrung oder weg von der Hitzequelle. Bei vielzelligen Lebewesen müssen
diese Reize zusammengeführt und eine koordinierte Reaktion ausgelöst werden
- die Fortleitung der Informationen übernahmen Nervenzellen, ebenso die
zentrale Auswertung und das Auslösen einer Reaktion. Die Nerven- und
Sinneszellen konzentrierten sich im Laufe der Evolution am vorderen Ende des
Tieres: das Gehirn war entstanden. Das Gehirn des Menschen besteht aus den
gleichen Bausteinen wie das einfacher Tiere - den Nervenzellen. Den
Unterschied machen vor allem die Zahl der Nervenzellen und die Anzahl und
Flexibilität ihrer Verknüpfungen aus.

Nervenzelle: Eine Nervenzelle
besteht aus einem Zellkörper, den Dendriten, die Informationen von
Sinneszellen oder anderen Nervenzellen aufnehmen und in elektrische Impulse
umwandeln, die über das Axon fortgeleitet werden, an dessen Ende es an die
nächste Nervenzelle oder das Erfolgsorgan (z.B. einen Muskel) übertragen
wird. Die Übertragung der Information erfolgt an Synapsen meist über
Chemikalien, sogenannte Neurotransmitter, die von Rezeptoren an der
gegenüberliegenden Nervenzelle aufgenommen werden. Die Aufnahme von
Neurotransmittern kann elektrische Impulse in der aufnehmenden Nervenzelle
auslösen oder deren Auslösung hemmen. Abb.: Mariana Ruiz Villarreal, >>
wikipedia commons, abgerufen 5.8.2008, eigene Beschriftung.
Reize aus der Außenwelt werden beim Menschen über Sinneszellen in Augen,
Ohren, Nase, Zunge und Haut aufgenommen und in elektrische Impulse
verwandelt. Über die Nervenzellen gelangen diese Signale ins Gehirn, wo sie
verarbeitet werden. In der Großhirnrinde gibt es “assoziative Areale”, in
denen unterschiedliche Informationen zu einem Eindruck zusammengefügt
werden. (Die Aktivität bestimmter Areale kann man unter anderem untersuchen,
indem man die elektrische Aktivität von Nervenzellen mit Elektroden an der
Kopfhaut misst, diese Methode heißt Elektroenzephalographie, EEG.) Ergibt
sich bei der Bewertung Handlungsbedarf, werden vom Motorkortex - einem
weiteren Bereich der Großhirnrinde - Signale an motorische Nervenzellen
ausgesendet, die zu Muskelzellen führen, die die entsprechende Handlung
ausführen.
Die meisten Informationen und Handlungen erreichen nie das
Bewusstsein, sie werden “automatisch” ausgeführt. Aber wenn wir auf etwas
Neues, Schwieriges oder Interessantes stoßen, wird das Bewusstsein
eingeschaltet. Forscher sehen dieses schon bei Tieren am Werk: Frösche
zögern etwa, wenn Ihnen unbekannte Beutetiere vorgesetzt werden, und
entscheiden, ob sie zuschnappen oder nicht. Wie das Bewusstsein entsteht und
die damit einhergehenen subjektiven Empfindungen (die Forscher nennen diese
“Qualia”) entstehen, ist eine der großen Fragestellungen der Wissenschaft.
Und was ist “Neu, Schwierig oder Interessant”? Das Zusammenspiel zwischen
Unbewusstem und Bewusstsein ist seit Sigmund Freud ebenfalls im Fokus der
Forschung; das Unbewusste, Freunds “Es”, gilt vielen Forschern heute als der
eigentliche “Regisseur” unseres Lebens. Im Unterschied zu früher, als man im
Unbewussten eine gefährlichen Abgrund sah, in dem die Triebe regierten,
sehen es die Forscher heute eher als “kondensiertes Wissen”, das im Laufe
des Lebens mit seinen Erfahrungen gesammelt wird und ermöglicht,
Routinesituationen im “Autopilot” zu bewältigen. Stimmt aber etwas Wichtiges
nicht mit dieser unbewussten Welt im Kopf überein, wird das aufwändigere und
langsamere Bewusstsein eingeschaltet, um das Problem zu lösen und das Bild
im Kopf zu aktualisieren. Eine wichtige Rolle spielen dabei die - früher
ebenfalls von Wissenschaftlern eher gefürchteten - Gefühle, die dafür
sorgen, dass wir gefährliche Situationen vermeiden (Angst, ...) oder
angenehme Situation suchen (Lust, ...). Sie orientieren unter anderem unsere
Aufmerksamkeit, und die wiederum unsere bewusste Wahrnehmung.
Aus den
komplexen Schaltkreisen ergibt sich irgendwie auch Wissen um das eigene
Denken und die eigene Existenz - also Selbst-Bewusstsein und
Ich-Bewusstsein. ”Ich denke, also bin ich”, hatte der französische
Mathematiker und Philosoph René Descartes bereits im 17. Jahrhundert diesen
Zusammenhang formuliert. Ich-Bewusstsein scheint es auch schon im Tierreich
zu geben, jedenfalls erkennen Schimpansen, Delfine, Elefanten, Raben und
Papageien sich im Spiegel. Biologen vermuten, dass es Tieren, die in einer
Gruppe leben, hilft, sich in andere Gruppenmitglieder hineinzuversetzen: Was
würde ich wohl in seiner Situation tun? Bei höheren Affen und beim Menschen
scheinen hierfür spezielle Nervenzellen, die “Spiegelneuronen” zuständig zu
sein: Beim bloßen Sehen einer Handlung werden hier die gleichen Signale
ausgelöst, als würde die Handlung selbst durchgeführt. Manche Forscher
glauben, hier das “Bauteil” des Mitgefühls gefunden zu haben.
Selbst-
und Ich-Bewusstsein führen aber auch zu Erkennen der Endlichkeit der eigenen
Existenz. Bei den Neandertalern gibt es Anzeichen für rituelle Begräbnisse;
sie hatten also vermutlich bereits diese Erkenntnis. Wann genau der Mensch
sich erstmals seiner Sterblichkeit bewusst wurde und wann er begann, über
die Entstehung der Welt und des Menschen nachzudenken, wird wohl für alle
Zeiten ein Rätsel bleiben – aber vermutlich ist es lange vor dem Homo
sapiens geschehen. (Die Todesfurcht, die aus dieser Erkenntnis hervorging,
führte zur Entstehung psychologischer Schutzmechanismen, etwa dem
Zugehörigkeitsgefühl zu größeren Grummen und dem Ersinnen übernatürlicher
Welten mit schützenden Göttern, in denen der Tod nicht das Ende ist - der
Ursprung sowohl einer gemeinsamen Kultur als auch der Entstehung der
Religion.) Bei Fragen nach der Entstehung der Welt stellt sich auch gleich
das Problem der Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit: Das menschliche Gehirn
ist als Produkt einer evolutionären Anpassung entstanden; es musste zu
Überleben und Fortpflanzung seines Trägers beizutragen; eine
“objektive Wahrheit” hat für die Evolution keinen Wert. So erfasst es nur
einen engen, für das Überleben relevanten Ausschnitt aus der Welt; anderes
nicht - Stickstoff und Sauerstoff etwa, die 99 Prozent der Luft ausmachen,
können wir nicht wahrnehmen. Sie sind allgegenwärtig, und das Wissen über
ihr Vorhandensein spielt daher für unser Überleben keine Rolle. Ebenso
unbedeutend sind Vorgänge in sehr kleinen oder sehr großen Dimensionen, und
daher helfen uns unsere Alltagserfahrungen nicht, Ereignisse in der
Quantenmechanik (>>
mehr) oder
die Ergebnisse der Relativitätstheorie (>>
mehr) zu
verstehen. Aus der kleinen Auswahl der Informationen, die unsere
Sinnesorgane erfassen und dem im Gehirn gespeicherten Vorwissen (siehe
oberen Kasten rechts) wird stattdessen vom Gehirn eine Realität konstruiert
(siehe unteren Kasten rechts) und eine Entscheidung getroffen, die uns
hilft, pragmatisch und schnell etwa auf unmittelbare Gefahren zu reagieren.
Diese Konstruktion muss nicht “objektiv” stimmen: So “sehen” wir immer noch
ein Sternenzelt am Himmel, auch wenn wir längst viel über die Weite des
Weltraums wissen. Für das Thema dieser Seiten besonders relevant ist, dass
uns auch ein Sinn für Gefahren fehlt, die uns nicht unmittelbar bedrohen,
wie etwa schleichende Vergiftungen und Klimaänderungen. Aber unsere Grenzen
setzen schon viel früher ein: Wenn alle unsere Erkenntnisse über die Welt
auf subjektiven Konstruktionen basieren; wie objektiv können sie dann sein?
Wann ist eine Behauptung “wahr”? (Mit solchen Fragen beschäftigt sich die
Erkenntnistheorie.)
Und das Gedächtnis?
Das
Nervensystem kann Informationen nicht nur leiten und verarbeiten, sondern
auch behalten und wieder abrufen - diese Fähigkeit kennen wir als
Gedächtnis. Auch wie dieses geschieht, wird gerade erst erforscht. Eine
wichtige Rolle scheinen hierbei die Synapsen zwischen den Nervenzellen zu
spielen, die einerseits beim Lernen effizienter werden können und dann das
Kurzzeitgedächtnis bilden; zum anderen aber auch zahlreicher werden und so
dauerhafte neue Verbindungen bilden - dann ensteht das Langzeitgedächtnis.
Lernen führt also dazu, dass sich das Verknüpfungsmuster der Nervenzellen im
Gehirn ändert, dabei sind für verschiedene Gedächtnisarten (Hirnforscher
unterscheiden das sensorische Gedächtnis für Sinneseindrücke, das
prozedurale Gedächtnis für Bewegungsabläufe, das episodische Gedächtnis, das
uns erlaubt, unsere Vergangenheit zu rekonstruieren, und das
Faktengedächtnis) unterschiedliche Hirnregionen beteiligt. An der Ausbildung
der neuen Verknüpfungsmuster sind zahlreiche Proteine und Signalstoffe
beteiligt, deren Rolle noch lange nicht verstanden ist.
Wenn auch das Gehirn noch viele Rätsel stellt: Was es möglich gemacht hat, wissen wir. Die Natur des Menschen nahm kulturelle Gestalt an. Es ging - zunächst in bescheidenem Umfang mit der Herstellung von Werkzeugen - spätestens mit dem Homo erectus los; es gibt auch Anzeichen, dass sich bereits Homo erectus um ältere Mitmenschen gekümmert hat: In Georgien wurde ein Kieferknochen gefunden, der bereits Jahre vor dem Tod die Zähne verloren hatte – vermutlich musste dieser Mensch gefüttert werden.
Die Sprache
Die kulturelle Entwicklung der Menschheit machte noch einmal einen großen Schritt, als im Laufe der Menschheitsgeschichte die Sprache entstand. Wie dies geschah, beginnen die Wissenschaftler allmählich wenigstens zu ahnen: Am Anfang stand die Kommunikation mittels Gesten und Rufen, wie bei den heutigen Primaten. Bei dieser Art der Kommunikation stehen Zeichen und Gegenstand immer in einer einfachen Beziehung: Grüne Meerkatzen, eine Affenart, produzieren unterschiedliche Schreie, um Schlangen, Adler oder Leoparden anzukündigen. Sprache setzt aber Denken in Symbolen voraus: Mehr in Dingen sehen zu können, als zunächst erkennbar ist - in einer Muschel mit Loch etwa ein Schmuckstück. Die nächste Voraussetzung neben symbolischem Denken ist anatomisch: der nach unten wandernde Kehlkopf, der durch den aufrechten Gang möglich wurde - die Symbole konnten nun mit Lauten verbunden werden. Gehirnwachstum und Sprachentwicklung dürften sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ebenfalls gegenseitig bedingt und gefördert haben: Symbolisches Denken braucht viel ”Rechenkapazität”, ermöglicht aber eine bessere Planung der Jagd und bessere Waffen. Der dadurch mögliche bessere Jagderfolg führte zu mehr Protein in der Nahrung, was wiederum ein weiter wachsendes Gehirn ermöglichte. Dadurch konnte die Sprache sich weiter entwickeln, und der Regelkreis wird von neuem durchlaufen. Als eine mögliche Triebkraft der Sprachentwicklung wird neben der Jagd auch die Pflege des sozialen Zusammenhalts gesehen: Schimpansen etwa kämpfen nach erfolgreicher Jagd oft um die Aufteilung der Beute, wodurch die Stärkeren einen größeren Anteil kriegen. Gruppen menschlicher Jäger aber handeln die Aufteilung aus, und vermeiden damit körperliche Auseinandersetzungen. In vielen traditionellen Gemeinschaften war und ist das Erzählen von Geschichten ein gemeinschaftsbildender Vorgang. Den sozialen Fortschritt, den Sprache ermöglicht, zeigt auch eine weitere Untersuchung: Alle sozial lebenden Primaten haben Rituale, um die Bindungen in der Gruppe zu pflegen, etwa die gegenseitige Fellpflege (”Grooming”) bei Schimpansen. Die Fellpflege kostet aber viel Zeit; erst als sprachliche Äußerungen diese ergänzen konnte, wurde die für Jäger und Sammler typische Gruppengröße von 150 Menschen möglich (Schimpansen leben typischerweise in Gruppen von 55 Tieren).
Ab wann man von Sprache reden kann, ist umstritten – die Sprache ist nicht plötzlich entstanden, sondern hat sich über immer artikuliertere Laute langsam entwickelt. Da wir die Sprache unserer Vorfahren nicht mehr hören können, schließen die Forscher ihre Entwicklung über andere Zeichen symbolhaften Denkens, etwa aufwändig verarbeitete Klingen, die vermutlich rituelle Bedeutung hatten, da sie nicht so fein ausgearbeitet werden müssten, um “nur” Tiere damit zu erlegen; die Nutzung von Mahlsteinen und Pigmenten, um den Körper oder Felswände zu bemalen; oder den Fischfang, bei dem Fische in felsige Buchten gelockt worden (was Planung und Voraussicht erfordert). Daraus kann man natürlich nicht schließen, wann sich eine Grammatik entwickelte - aber vor etwa 70.000 Jahren gab es so etwas wie einen “großen Sprung” in der Menschheitsgeschichte (>> mehr); als eine mögliche Ursache wird die Sprache diskutiert, die zu dieser Zeit “fertig” gewesen sein könnte. Eins ist klar: Je weiter die Sprache sich entwickelte, desto mehr erweiterte sie die Möglichkeiten des Menschen. Er konnte Erfahrungen in ganz neuem Umfang weitergeben, Verabredungen treffen und gemeinsam Pläne entwerfen.
Die Grundlage der kulturellen Evolution des Menschen
Mit der Sprache nahm also der Mensch zunehmend sein Schicksal selber in die Hand, die kulturelle Evolution wurde für unser Leben wichtiger als die Kräfte unserer Umwelt. Die Tendenz ist bereits beim Neandertaler (>> hier) erkennbar: Behausungen, Feuer und vermutlich auch einfache Kleidung - die Neandertaler begannen, sich eine eigene, künstliche Umwelt zu schaffen. Wie konnte die Entstehung einer Sprache derartige Veränderungen auslösen? Eine Sprache, die mit Symbolen arbeitete, ermöglichte einen abstrakten Informationsaustausch (im Unterschied zum Nachahmen, mit dem Tiere lernen). Die Menschheit war nicht mehr auf das Wissen eines einzelnen Menschen angewiesen, sondern die Inhalte vieler Köpfe verbanden sich - auch über die Generation hinweg - zu einem gemeinsamen Wissen; sie vernetzt in gewissermaßen die einzelnen Gehirne. Wie groß das neue, vernetzte Wissen war, hing freilich von der Menge und der Vielfalt des geteilten Wissens ab, und von der Effizienz und Geschwindigkeit des Informationsaustausches. Effizienz und Geschwindigkeit hingen von den sprachlichen Fähigkeiten ab; Menge und Vielfalt des Wissens von der Anzahl und Verschiedenartigkeit der Menschen, die in Kontakt traten - und die war in dieser Phase der Menschheitsentwicklung noch beschränkt. Am Anfang entstanden so “große regionale Gehirne” (ein Ausdruck des amerikanischen Bestsellerautors Robert Wright); sie sollten im Laufe der menschlichen Geschichte immer größer werden (>> mehr). Der Erfolg des Menschen beruht letztendlich nur auf diesem Austausch und der Kooperation: Der einzelne Mensch ist dem einzelnen Schimpansen ja nicht sonderlich - wenn überhaupt - überlegen; die Menschheit als Ganze den Schimpansen sehr wohl. Mit Intelligenz und Sprache kann Wissen erzeugt und kontinuierlich weiterentwickelt werden, dies ist die Triebkraft einer kulturellen Revolution, die das Leben des Menschen wesentlich schneller verändern sollte als die biologische Evolution - die großen Meilensteine waren die >> Erfindung der Landwirtschaft und die >> Industrielle Revolution. Heute ist die Menschheit auf dem Weg, zu einer Art “kulturellem Superorganismus” zusammenzuwachsen: Bei diesem steht allen Menschen alles Wissen der Menschheit zur Verfügung. Die Bedeutung der kulturellen Evolution lässt sich an vielen Werken, von den Werken Shakespeares über die Musik von Bach oder die Werke von Wissenschaft und Technik verstehen, oder an einer einzigen Zahl: Als Jäger und Sammler lebten 4 bis 8 Millionen Menschen auf der Erde (>> mehr), heute fast 7 Milliarden (>> mehr) - etwa 1000 mal so viele.
Unbestritten ist, dass die biologische Evolution mit dem Gehirn die Grundlage für unsere kulturelle Evolution schuf (siehe auch >> hier). Umstritten ist, ob dies bedeutet, dass auch die Kultur letztlich ein Ergebnis der menschlichen Natur ist (die menschliche Geschichte also nur ein Unterkapitel der Naturgeschichte des Menschen wäre und grundsätzlich mit biologischen Erklärungsansätzen beschreiben werden könnte), oder aber ob die biologische Evolution in dem komplexen Gehirn etwas neues hervorgebracht hat: ein offenes, prinzipiell nicht durch biologische Vorgaben festgelegtes menschliches Verhalten. Unabhängig hiervon stellen die Ergebnisse der Hirnforschung die Frage nach der “Freiheit des menschlichen Willens”: Da Prozesse im Gehirn, auch das Treffen von bewussten Entscheidungen, immer das Ergebnis von Aktivitäten der Nervenzellen sind, und diese den Naturgesetzen und daher festgelegten Abläufen unterliegen, vertreten Hirnforscher wie Gerhard Roth oder Wolf Singer die Ansicht, dass diese Freiheit letztlich eine Illusion sei. Bei Experimenten mit bildgebenden Verfahren wissen Hirnforscher heute oft schon vor den Versuchsteilnehmern, wie diese sich entscheiden werden! Die “guten Gründe” für unsere Entscheidung erfindet das Gehirn dann zur Not anschließend, um die Illusion der freien Entscheidung aufrecht zu erhalten. Unser - vom Gehirn konstruiertes - Menschenbild wird durch diese Ergebnisse der Hirnforschung in Frage gestellt, erfahren wir uns doch als Urheber der Entscheidungen, die wir getroffen haben. Da aber irren wir uns, sagen die Hirnforscher, denn die bewussten Gründe für eine Entscheidung müssen a) keinesfalls die entscheidenden gewesen sein - nur kennen wir die unbewussten eben nicht - und b) unterliegen diese genau wie unbewusste Entscheidungen vorherbestimmten Abläufen in den Nervenzellen. Falsch ist aber auch die Behauptung, dass diese Hypothese bedeutet, wir wären für unsere Entscheidungen dann nicht mehr verantwortlich: Das Gehirn unterscheidet nicht zwischen genetisch geprägtem und kulturell erworbenem (erlerntem) Wissen, und daher wird keine Gesellschaft darauf verzichten, das Verhalten ihrer Mitglieder über Erziehung, Belohnungen und Sanktionen zu beeinflussen.
Zu tüchtig zum Überleben?
Die Fähigkeiten unseres Gehirns und die dadurch möglich gewordene
kulturelle Evolution haben nicht nur den einzigartigen Erfolg des Homo
sapiens möglich gemacht, sondern auch Weltkriege und die Gefährdung der
ökologischen Grundlage unseres eigenen Überlebens (>>
hier).
Gewaltbereitschaft, Eigennutz und Zukunftsblindheit gehören zu unserer
genetischen Ausstattung; die kulturelle Evolution stellt sie auf eine neue
Stufe. Auch Schimpansen töten Artgenossen zielgerichtet und vorsätzlich;
aber so etwas furchterregendes wie gut gedrillte Armeen, die zur
systematischen und geplanten Kriegsführung gehalten werden, gibt es nur beim
Menschen. Ebenso stellen wir aber auch die Kontrollmechanismen auf eine neue
Stufe, so etwas wie auf der ebenfalls evolutionär entstandenen Moral (>>
hier)
aufbauende Rechtsordnungen gibt es ebenfalls nur beim Menschen. Sie haben
Kriege nicht verhindern können (daran ist zu arbeiten, siehe das
Einstein-Zitat unten); aber wenn kein Krieg war, ist unser Leben in den
vergangenen 500 Jahren immer sicherer und gewaltärmer geworden. Die
Rechtsordnungen setzen mit staatlichem Gewaltmonopol und Strafen der
Gewaltbereitschaft Grenzen; wir können also grundsätzlich lernen, mit
unserem genetischen Erbe zivilisiert umzugehen.
Das Gehirn macht uns
nicht nur die Endlichkeit unserer individuellen Existenz bewusst, es macht
es auch möglich, Vorsorge für die Zukunft zu treffen. Menschen können nach
einer Güterabwägung sogar die Befriedigung dringender Triebe zugunsten
künftiger Bedürfnisse zurückstellen, man denke nur an Bausparen oder
Hungerstreik. Das bedeutet: auch wenn wir von der Natur nicht dazu
ausgestattet sind, komplexe zukünftige Gefährdungen (>>
hier) intuitiv zu erfassen und angemessen darauf zu reagieren, so können
wir grundsätzlich diese Schwäche doch erkennen und kulturell korrigieren,
also die Gefahren mit einem vom Verstand bestimmten Kurs bekämpfen -
genauso, wie die Schwäche unserer Sinnesorgane mit technischen Instrumenten
ausgeglichen haben. Wie beim Umgang mit Gewalt müssen wir die biologischen
Tatsachen wie unsere Neigung zum Eigennutz anerkennen - alle Versuche, einen
“neuen Menschen” hervorzubringen, sind bisher gescheitert, und zudem oft in
Unmenschlichkeit geendet - und auf dieser Basis und den ebenfalls
vorhandenen hilfreichen Bausteinen unserer genetischen Ausstattung
kulturelle Regelungen zum Schutz unserer ökologischen Grundlage schaffen
(siehe >> hier).
Kann das ausreichen, unsere auf einer steinzeitlichen genetischen
Ausstattung aufsetzenden technischen Fähigkeiten so einzusetzen, dass sie
der Menschheit nutzen und sie nicht zerstören? Wir haben keine andere Wahl,
als es zu probieren. Aber eins ist absehbar: Da wir als flexible Wesen immer
zwischen kurzfristigem Eigennutz und langfristigem Nutzen aller schwanken
werden, wird es nicht eine ein für allemal alle Probleme lösende Regelung
geben, sondern die kulturellen Regelungen für eine ökologisch verträglichen
Zukunft werden immer wieder verteidigt und neu ausgehandelt werden müssen.
“Ich weiß nicht, mit was für Waffen der
Dritte Weltkrieg geführt wird, aber der Vierte wird
mit Stöcken und Steinen
ausgetragen” Albert Einstein
Gibt es andere intelligente Zivilisationen im Weltall?
Auch wenn wir noch nicht wissen, ob es außerhalb der Erde Leben gibt (>> mehr), stellen sich Wissenschaftler seit langem die Frage, ob dieses Leben intelligente Zivilisationen entwickelt haben könnte. Bereits im Jahr 1960 entwickelte eine Gruppe um den amerikanischen Astronomen Frank Drake eine als Drake-Gleichung berühmt gewordene Formel, mit der die Zahl möglicher intelligenter Zivilisationen abgeschätzt werden kann. In diese Formel fließen die Zahl der mit der Sonne vergleichbaren Sterne, die mittlere Zahl der Planeten im Bereich der Lebenszone (>> mehr), die Wahrscheinlichkeit der Entstehung von Leben, die Wahrscheinlichkeit der Weiterentwicklung zu intelligentem Leben, die Wahrscheinlichkeit technischer Kommunikation in diesen Zivilisationen und ihre Lebensdauer ein. Da die meisten Faktoren nur sehr grob abgeschätzt werden können, gibt es kein allgemein akzeptiertes Ergebnis - die ersten Einschätzungen lagen zwischen einer und 4 Millionen intelligenter Zivilisationen in unserer Milchstraße. Seit 1960 wird auch systematisch nach außerirdischem intelligentem Leben gesucht; die Programme sind als SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) bekannt. Bisher haben sie nichts gefunden, was auf technische Zivilisationen im Weltall hindeutet. Manche Beobachter fragen sich aber, ob wir Zivilisationen, die viel weiter entwickelt wären als unsere auf der Erde, überhaupt erkennen könnten. Wären Elefanten intelligent, würden Sie vielleicht glauben, dass die höchstentwickelten Lebewesen an der Länge ihres Rüssels erkennbar wären; vielleicht irren wir ähnlich und suchen den falschen Merkmalen... Einen praktischen Nutzen hätte die Entdeckung jedoch kaum, im Mittel lägen wohl ein paar Tausend Lichtjahre zwischen den einzelnen Vorkommen intelligenten Lebens. Jede Frage an eine andere Zivilisation würde also nach zweimal ein paar Tausend Jahren beantwortet werden - falls wir die Frage nicht vergessen haben, haben wir möglicherweise die Antwort bis dahin selber gefunden. Andererseits - wie bei jeder Fahrt in der Bahn deutlich wird, hindert offensichtliche Sinnlosigkeit von Botschaften viele Zeitgenossen auch nicht, trotzdem ihr Handy zu benutzen. So gesehen, können wir auch ruhig ins All telefonieren ...
Webtipp:
>> SETI
Institute, zentrale Anlaufstelle für die Suche nach außerirdischem Leben
(englischsprachig)
Vorige Seiten:
>>
Übersicht Der
Mensch
>> Vom
Affen zum Menschen
Nächste Seiten:
>>
Der moderne
Mensch - Homo sapiens
>>
Jäger und Sammler und ihre Umwelt
© Jürgen Paeger 2006 - 2012