Vom Urknall zum Planeten Erde
Wie alles begann ...
Alle Materie auf der Erde stammt aus viel älteren kosmischen Prozessen, und ein Stern, die Sonne, liefert die Energie für das Leben auf der Erde. Schon immer hat die Menschheit nach der Entstehung der Welt gefragt – Schöpfungsmythen waren die erste Antwort, aber in der Folge trug die Suche nach einer Antwort wesentlich zur Entstehung der heutigen Naturwissenschaften bei.
Bild des Weltraumteleskops Hubble von einem Bereich der Kleinen Magellan’schen Wolke, in dem sich zahlreiche junge Sterne befinden. Abbildung: NASA, ESA and the Hubble Heritage Team, siehe >> hier.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde ...
... mit diesen Worten beginnt die Bibel, und gibt damit eine mögliche Erklärung für die Entstehung des Kosmos, in dem wir leben. Der Blick in den Sternenhimmel faszinierte die Menschen schon immer; der Sternenhimmel hat schon unsere frühesten Vorfahren angeregt, mythologische Gestalten erkennen zu wollen und Fragen nach seiner Entstehung ausgelöst.
Die älteste überlieferte Antwort der Menschheit auf die Frage nach der Entstehung der Welt sind die verschiedenen Schöpfungsmythen. In diesen sind es übernatürliche, oftmals göttliche Mächte, die die Welt erschufen. Dabei spielte oft der Nachthimmel eine besondere Rolle [002]: In vielen Kulten wurden Götter mit Himmelskörpern verbunden, wie ja noch die Benennung der Planeten nach römischen Göttern zeigt. Die Beobachtung des Nachthimmels mit seinen Sternen und Planeten führte aber auch zur Entdeckung von Gesetzmäßigkeiten, die dann mit Beginn des Ackerbaus für die Berechnung von Kalendern genutzt werden konnten (die wiederum die Planung der Aussaat erleichterten). Die Babylonier erstellten etwa auf Grundlage ihrer (auf Tontafeln aufgezeichneten [004]) Himmelsbeobachtungen mathematische Reihen, die es erlaubten, Himmelserscheinungen vorherzusagen; sie kannten einige Himmelszyklen mit großer Genauigkeit – und das war eine Voraussetzung für die Erstellung genauer Kalender. So ging mit der Himmelsbeobachtung die Entwicklung der Astronomie einher und machte diese zu einer Wurzel der Naturwissenschaften: zum ersten Mal in der Geschichte ist hier in großem Umfang die methodische Sammlung von Daten zur Erforschung der Natur zu finden.
Die babylonischen Astronomen versuchten aber auch, Beziehungen zwischen himmlischen Phänomenen und Ereignissen auf der Erde, die für den Menschen von Bedeutung waren, etwa den Tod eines Herrschers oder den Beginn eines Krieges, herzustellen – also das zu tun, was man später als Astrologie bezeichnen sollte (und was nichts mit Naturwissenschaft zu tun hat). Übernatürliche/göttliche Erklärungen für die Geschicke der Welt und des Menschen blieben vorherrschend, bis im 5. Jahrhundert v.u.Z. in Milet, einer im 11. Jh. v.u.Z. von griechischen Kolonisten an der ionischen Küste Kleinasiens (wieder)gegründeten Stadt, die später "ionische Naturphilosophen" (oder "Vorsokratiker") genannten Denker um Thales, Anaximander und anderen damit begannen, gedanklich einen neuen Weg zu gehen: Sie suchten nach natürlichen Ursachen für die Geschicke der Welt und des Menschen. So vermutete Anaximander, dass der Regen aus dem Dampf entsteht, der von der Erde aufsteigt, wenn sie von der Sonne erhitzt wird (also nicht, wie die Griechen bis dahin glauben, von Zeus hervorgebracht wird) [006]. Anaximander versuchte sich aber nicht nur an einer Erklärung meteorologischer Erscheinungen mit natürlichen Ursachen, sondern auch an der Erklärung der Entstehung der Welt und ihrer Entwicklung [008]). Seine größte Leistung war es aber, zu erkennen, dass die Erde im Raum schwebte. Bis dahin hatte man geglaubt, dass die Erde auf etwas ruhen müsse (etwa in der indischen Mythologie auf dem Rücken von vier Elefanten, die wiederum auf dem Rücken einer Riesen-Schildkröte standen); dies war der Alltagserfahrung geschuldet, dass alles, was nicht auf irgendetwas anderem lag, nach unten fiel – was die Erde ja offensichtlich nicht tat. Anaximander erkannte, dass die Erde auf nichts ruht, sondern im Raum schwebt. Auch diese Erkenntnis ließ sich aus Beobachtungen ableiten: Die Sonne ging im Westen unter, und im Osten wieder auf. Wie kam sie dorthin? Eine naheliegende Erklärung wäre es, wenn unter der Erde ebenfalls "Himmel" wäre, dann könnte die Sonne unter der Erde entlangziehen. Das konnten vermutlich damals schon viele nachvollziehen – das Problem an dieser Erklärung war nur, dass die Erde dann ja nach unten fallen müsste. Und für dieses Problem fand Anaximander die Lösung: er erklärte, dass die Erde nicht fallen würde, weil sie ihren "Sitz in der Mitte hat und überall den gleichen Abstand zu den Enden" (wie Aristoteles in seinem "Über den Himmel" erläuterte). Mit anderen Worten, es gibt keine bevorzugte Richtung, daher fällt die Erde nicht. Anders auf der Erde: hier gibt es eine bevorzugte Richtung – die Dinge fallen immer zur Erde. Oben und unten sind für Anaximander also nicht absolut, sondern relativ: unten ist immer da, wo die Erde ist. Im Raum gibt es aber kein absolutes Unten, daher fällt die Erde nicht, sondern schwebt im Raum [010]).
Einer der Schüler Anaximanders [012], der später nach Süditalien ausgewanderte Pythagoras, erkannte, dass der Schlüssel zum Verständnis der Gesetze, die die Welt bestimmen, die Mathematik ist; er erkannte auch, dass die Erde (wie wir heute wissen: nur annähernd) eine Kugel ist [014] – nur so ist zu erklären, dass sie bei Mondfinsternissen immer kreisförmige Schatten wirft und von Schiffen am Horizont zuerst die Segel zu sehen sind. Pythagoras Idee von der Bedeutung der Mathematik wurde von Sokrates' Schüler Platon aufgegriffen [016]; er warf die Frage auf, nach welchen mathematischen Gesetzen die Himmelskörper ihre Bahnen um die Erde ziehen. An der Beantwortung scheiterte er: für die Griechen war Mathematik im wesentlichen Geometrie; Platon erkannte nicht, dass die Bahnen der Himmelskörper die Beziehung zwischen Zeit und Ort beschreiben, was erst Johannes Kepler erkennen sollte. Die mathematische Berechnung der Schleifenbewegungen der Planeten versuchte zuerst der Mathematiker Eudoxos in der ersten Hälfte des 4. Jh. v.u.Z.. Dazu nahm er an, dass Sonne, Mond und die Planeten jeweils am Äquator einer Hohlkugel befestigt seien, die um ihre eigenen Achsen rotierten. Die Drehachsen stecken in der nächsten Hohlkugel, die mit einer anderen Geschwindigkeit und auf einer Achse, die nicht parallel zu der der inneren Hohlkugel ist rotiert. Mit 26 Hohlkugeln konnte er die Planetenbewegungen so (in grober Näherung) erfassen.
Platons Schüler Aristoteles verfasste um 340 v.u.Z. seine Schrift „Vom Himmel“. Er folgte Pythagoras bei der Idee einer kugelförmigen Erde, glaubte aber wie die meisten Griechen, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums darstellt: so erklärte sich, dass schwere Objekte zu Boden fielen – für Aristoteles war die Ruhe im Mittelpunkt des Universums der natürliche Zustand der schweren Objekte auf der Erde, und die Erdoberfläche damit ihr "natürlicher Ort" [018]. Bei seinen Vorstellung nach dem Aufbau des Kosmos folgte Aristoteles im Wesentlichen Eudoxos' Modell der konzentrischen rotierenden Hohlkugeln. Die Frage Platons nach der mathematischen Beschreibung der Bahnen der Himmelskörper beantwortete schließlich der im (damals römischen) Alexandria lebende griechische Mathematiker und Astronom Ptolemäus im 2. Jahrhundert n.Chr. in seinen 13 Bücher umfassenden "Mathematischen Zusammenstellungen". Ptolemäus knüpfte bei seinem Modell an die Hohlkugel-Vorstellung Eudoxons an: die Erde bildete den Mittelpunkt von acht Sphären, die die Himmelskörper trugen. Die Sterne waren in dem Modell fest auf der äußersten Sphäre angeordnet; die Planeten bewegten sich in der Tradition Platons auf einfachen (nämlich gleichförmigen Kreis-)Bahnen in ihren jeweiligen Sphären aus. Diese waren aber deutlich komplexer als bei Eudoxon: Um etwa die Schleifenbewegungen der Planeten zu erklären, griff Ptolemäus auf die Epizykeltheorie des Apollonius von Perge zurück: Bei diesem ist ein Trägerkreis (Deferent) der Mittelpunkt eines aufgesetzten Kreises (des Epizykels), den der Planet mit seiner eigenen Geschwindigkeit umläuft. Durch die Kombination dieser beiden Kreisbewegungen entstehen die jeweiligen Planetenschleifen (wie die gestrichelte rote Linie in der folgenden Abb. zeigt).
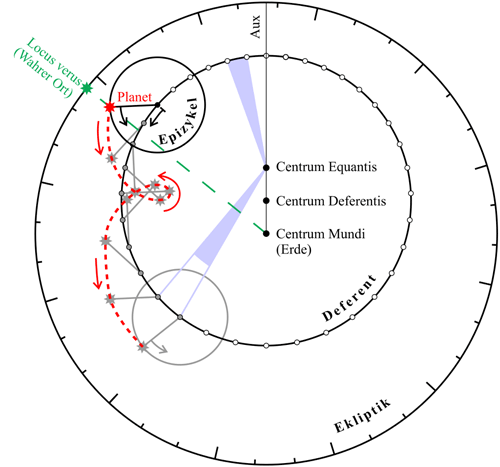
Die epizyklische Bewegung der Planeten nach Ptolemäus. Die Erde befindet sich im Mittelpunkt der Welt (Centrum Mundi), die Planeten kreisen auf dem Epizykel, der an einem Trägerkreis (Deferent) befestigt ist, der wiederum um seinen eigenen, vom Centrum Mundi verschobenen Mittelpunkt (Centrum Deferentis) kreist. Mit dieser Verschiebung (Exzenterhypothese) hat Ptolemäus die Schwankungen im Rhythmus der Planetenperioden erklärt. Zugleich bewegt sich der Epizykel-Mittelpunkt nicht gleichförmig auf seinem Trägerkreis (Deferent), sondern mit konstanter Winkelgeschwindigkeit (blaue Flächen [020]). Abbildung: wikipedia commons, Joerg-ks / CC BY-SA.
Auch für die Bewegung des Mondes und des Merkur fand Ptolemäus mit seinem Modell (hier nicht dargestellte) Lösungen. Das Modell war kompliziert, insgesamt 55 Kreise waren nötig, aber mit ihm konnten die Bahnen der (mit bloßem Auge) sichtbaren Himmelskörper deutlich genauer als Eudoxon berechnet und für die Zukunft vorausgesagt werden. Das war eine geniale Leistung, und der Grund dafür, dass dieses Modell über 1.400 Jahre lang unser Bild des Universums bestimmen sollte.
Die Grundlagen dieses Wissen wurden mit der Christianisierung des oströmischen Reiches aber unterdrückt: die Schulen der antiken Philosophie wurden geschlossen; Schriften, die mit dem christlichen Denken für unvereinbar gehalten wurden, vernichtet [021]. Die wenigen erhaltenen Werke wurden kaum mehr verstanden. Gelesen und verstanden wurden sie aber weiterhin in Indien, wohin das griechische Wissen mit dem Handelsaustausch gelangt war. Von hier wurde erhielten es persische und arabische Gelehrte, und so blieben auch Abschriften von Ptolemäus' "Mathematischen Zusammenstellungen" in arabischen Übersetzungen erhalten und wurden als "Almagest" (der lateinisierten Übersetzung des arabischen Titels "al-madschisti") im Renaissance-Humanismus wiederentdeckt. Einer, der den Almagest intensiv las, war ein junger Pole, der in Italien studiert hatte: Nikolaus Kopernikus. Er wollte dem großen Ptolemäus nacheifern und erarbeitete nach seiner Rückkehr nach Frauenburg unter dem Einfluss der Astronomen-Schule von Maragha im heutigen Nordiran (die Ptolemäus in einer Debatte unter den islamischen Astronomen um das richtige Weltbild gegen die Aristoteles-Anhänger mit Averroës an ihrer Spitze verteidigte, ihn aber physikalisch vereinfachen wollte) zur Deutung des ptolemäischen Kreisgewirrs ein revolutionäres Modell – er rückte die Sonne in den Mittelpunkt des Planetensystems und der Planetenkreise; ließ also die Erde die Sonne umkreisen. Erst kurz vor seinem Tod 1543 veröffentlichte er sein Werk (022). Zunächst glaubt kaum jemand an die Idee einer Erde, die sich bewegte: schließlich merkte man nichts von einer Bewegung; und die Berechnungen von Kopernikus waren zwar einfacher als die von Ptolemäus, aber nicht genauer. Auch soll Martin Luther die These persönlich abgelehnt haben (023). Aber einige Astronomen überzeugte der Ansatz. Zu diesen gehörten Johannes Kepler und Galileo Galilei (025). Johannes Kepler analysierte die genauen Beobachtungen, die der dänische Astronom Tycho Brahe von den Planetenbahnen gemacht hatte; dieser hatte über Jahrzehnte die damals besten Instrumente – die noch ohne Linsen auskommen mussten – zur Beobachtung der Planetenbahnen und erstmals mechanische Uhren eingesetzt (030). Im Jahr 1600 kam der deutsche Mathematiker Johannes Kepler, der als Protestant aus Graz, wo er als Lehrer gearbeitet hatte, fliehen musste, als Mitarbeiter zu Brahe, der mittlerweile als Hofmathematiker in Prag tätig war. Als Brahe 1601 starb, wurde Kepler sein Nachfolger und sollte Brahes unvollendete Arbeiten abschließen. Das betraf vor allem die Herausgabe der "Rudolfinischen Tafeln" (Tafeln, die auf Grundlage von Brahes Messungen die Position der Planeten wesentlich genauer als bis dahin beschrieben), die sich bis 1627 hinzog. Daneben verfolgte er seine eigene Forschung: Anders als Brahe sah er wie Kopernikus die Sonne im Zentrum des Planetensystems, zumal die Umlaufgeschwindigkeiten der Planeten umso größer wird, je näher sie der Sonne kommen: offenbar erhalten sie irgendwie ihren Schwung von der Sonne – Kepler vermutete, dass eine Kraft ähnlich der magnetischen Anziehung, über die William Gilbert im Jahr 1600 berichtet hatte (032), wirksam sei.
Kepler erkannte aber auch, dass die Bahn des Mars mit dem Modell von Kopernikus nicht ganz übereinstimmte, und kam nach "unendlich komplizierten" Berechnungen auf die Idee, dass diese nicht genau kreisförmig ist, sondern eine Ellipsenbahn beschreibt. Damit konnte er auch die seit jeher rätselhafte Schleifenbewegung, die der Mars zeigte, erklären. Die elliptische Bahn mit der Sonne im Brennpunkt galt, wie Keppler erkannte, für alle Planeten. Er erkannte auch, wie die Geschwindigkeit der Planeten auf ihrer Bahn sich mit dem Abstand von der Sonne veränderte: proportional zur Fläche, die die Linien zwischen Planet und Sonne überstrich. Diese ersten beiden Keplerschen Gesetze veröffentlichte er 1609 (034); damit formulierte er erstmals mathematische Regeln, die die Planetenbahnen beschrieben. Mit ihnen stimmte Kopernikus’ System auch ohne komplizierte Epizyklen besser als das von Ptolemäus mit den genauen Beobachtungen von Brahe überein – nach über 1.400 Jahren war erstmals ein besseres Modell für den Sternenhimmel gefunden.
Keplers Ellipsen legen vor allem nahe, dass die Bewegung der Planeten aus zwei zusammengesetzten Bewegungen gedacht werden kann. Das hatte zu der Zeit, als Kepler noch rechnete, in Padua der Mathematikprofessor Galileo Galilei mit der ähnlichen Bahn getan, die eine abgeschossene Kanonenkugel zurücklegt. Diese ist annähernd parabelförmig, und Galilei, der sich zuvor mit dem freien Fall beschäftigt hatte (050), spaltete sie in zwei Anteile auf: einem zur Erde hin gerichteten (dem freien Fall), und einer in horizontaler Richtung gleich bleibenden Bewegung (womit er sich dem modernen Begriff der Trägheit (034) annäherte). Für die Planetenbahnen sollte das aber erst Isaac Newton tun (siehe unten); die Astronomen Anfang des 17. Jahrhundert beschäftigten sich mit etwas ganz anderem: im selben Jahr 1609, als Kepler seine Ergebnisse veröffentlichte, hatte Galileo Galilei erstmals das soeben erfundene Fernrohr genutzt, um den Himmel zu beobachten (052). Das sollte seiner Forschung eine neue Richtung geben. Mit dem Fernrohr, das er im Laufe der Zeit immer weiterentwickelte, entdeckte er Dinge, die zuvor noch kein Mensch gesehen hatte: Unzählige neue Fixsterne, Berge auf dem Mond, Monde, die den Jupiter umkreisten, Ringe um den Saturn, die Phasen der Venus, Sonnenflecken, ... Die Monde des Jupiter bestätigten die kopernikanische Idee, dass nicht alle Himmelskörper die Erde umkreisen mussten; und die Venusphasen (also ein Übergang von einer schmalen Sichel zur vollen Scheibe) ließen sich nur erklären, wenn die Venus die Sonne umkreiste. Nach dieser Beobachtung bekannte sich Galilei, der sich bis dahin nur in vertraulichen Briefen zu der Lehre Kopernikus' bekannt hatte, öffentlich zu dieser – ohne jeden Zweifel, schreibt er, sei die Sonne das Zentrum aller großen Planetenumläufe. Das Fernrohr machte nicht nur für Galilei sichtbar, was zuvor nur errechnet worden war: Kopernikus hatte recht, die Erde und die anderen Planeten bewegten sich um die Sonne (054). Es war, so Galileo Galilei, das Ende der "Pseudowissenschaft" des Aristoteles. Dieses Bekenntnis brachte Galilei allerdings in Konflikt mit der Kirche (056). Die Wahl von Urban VIII zum Papst ermutigte Galilei dann jedoch, sein Lebenswerk mit einer Zusammenfassung zu krönen: 1632 erschien sein „Dialog über die beiden hauptsächlichen Weltsysteme, das ptolemäische und das kopernikanische“, ein literarisches Meisterwerk, in dem in Form eines Dialoges zwischen drei Freunden die Überlegenheit des kopernikanischen Systems gezeigt wird. In dem Dialog zeigt Galilei auch, warum wir von der Bewegung der Erde auf dieser nicht merken (058). Wenige Jahre später zeigte der französische Astronom Pierre Gassendi auf einer schnell fahrenden Galeere, dass eine Kugel, die vom Mast fallen gelassen wurde, tatsächlich gerade nach unten fiel, Galileis Erklärung also stimmte.
Die Ergebnisse von Kepler und Galilei bildeten die Basis für die Arbeiten von Isaac Newton (Galilei, Newton und die klassische Physik) in der zweiten Hälfe des 17. Jahrhunderts (060): Er benannte die Schwerkraft als Ursache der Planetenbewegung (062); mit seinen Bewegungsgesetzen konnten alle mechanischen Vorgänge exakt berechnet werden, und zwar sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Davon war zwar schon Galilei ausgegangen, aber es noch längst nicht selbstverständlich: Im Himmel, so dachten die meisten damals, wirken göttlich oder dämonische Kräfte oder beide. Aber Newton zeigte, dass auch dort die Naturgesetze gelten. Sogar das Auftauchen der bis dahin geheimnisvollen Kometen konnte jetzt genau vorhergesagt werden. Damit wurde das Kopernikanische System mit der Sonne im Mittelpunkt der Planeten von den meisten Selbstdenkern akzeptiert; die „Himmelsmechanik“ schien komplett entschlüsselt (064).
Sie war es nicht. 1864 fasste der englische Physiker James Clerk Maxwell die frühere Forschung über Elektrizität und Magnetismus zusammen und entwickelte die Theorie der elektromagnetischen Wellen – die aber stand in Widerspruch zu Newtons Annahmen. Die Lösung dieser Widersprüche fand Albert Einstein Anfang des 20. Jahrhunderts mit seiner Speziellen und Allgemeinen Relativitätstheorie (mehr über diese Entdeckung im Exkurs: Von Newton zu Einsteins Universum).
Die Relativitätstheorie hatte auch Auswirkungen auf unser Verständnis vom Universum. Nicht nur war dieses als ein verformbares, vierdimensionales Raumzeitgebilde erkannt worden, sondern Einsteins Feldgleichungen erlaubten interessante Einsichten. So zeigte der deutsche Astronom Karl Schwarzschild (der als erster eine korrekte Lösung für Einsteins Gleichungen fand) im Jahr 1916 (066), dass die Formeln an Grenzen stießen, wenn Masse und Energie im Inneren eines Himmelskörpers zu dicht wären (die Sonnenmasse etwa auf ein Durchmesser von drei Kilometer zusammengepresst würde): dann wäre die Raumzeit derart gekrümmt, dass nicht einmal Licht aus dem Inneren erweichen könnte. Auch Albert Einstein selbst beschäftigte sich in der Folgezeit mit kosmologischen Fragen: Die Gravitation sollte, das sich alle Körper gegenseitig anziehen, eigentlich dazu führen, dass sich die Sterne aneinander annähern und das Universum irgendwann zusammenfiele. Da er hieran nicht glaubte, führte Einstein 1917 (068) in seine Gleichungen eine „kosmologische Konstante“ ein, die für eine angenommene abstoßende Kraft stand, die die Schwerkraft ausgleichen sollte. Aber bald wies der holländische Astronom Willem de Sitter darauf hin, dass Einsteins Universum keineswegs stabil sein muss und entwickelte ein Gegenmodell; Sitter wies auch darauf hin, dass wir nur das gegenwärtige Universum kennen und daher nicht wissen, ob es immer so bleiben wird. Und der russische Mathematiker Alexander Friedmann beschrieb 1922 ein Universum, dass sich ursprünglich ausdehnte und nun – abhängig vom wirklichen Wert der “kosmologischen Konstante” vor einer von drei Möglichkeiten steht: Erstens könnte die Ausdehnung durch die Wirkung der Schwerkraft zum Stillstand kommen und in eine Kontraktion übergehen; zweitens könnte das Universum sich ewig ausdehnen oder drittens könnte die Ausdehnung sich verlangsamen, aber nie ganz zu Ende kommen. (Die Antwort ist bis heute nicht bekannt; sie hängt unter anderem von der noch unbekannten Gesamtmasse des Universums ab.) Friedmanns Gedanken der Ausdehnung dachte der belgische Priester und Kosmologe Georges Lemaître zu Ende: Was sich ausdehnt, muss einmal nahe beieinander gewesen sein; er formulierte 1927 (070) die Idee, dass das ganze Universum aus dem Zerfall eines „Uratoms“ hervorgegangen sei.
Welches theoretische Modell richtig war, musste die Beobachtung der Wirklichkeit entscheiden. Seit Galileis Zeiten waren die Fernrohre immer besser geworden: Die Astronomen hatten neue Planeten entdeckt; es war ihnen gelungen, mit trigonometrischen Berechnungen die Entfernung naher Sterne zu schätzen; die Milchstraße wurde als scheibenförmige Ansammlung von Sternen erkannt. (Uns erscheint sie als helles Band über dem Nachthimmel, da wir aus dem Inneren auf diese Scheibe sehen.) Ein Rätsel waren die teils – wie die Große und Kleine Magellansche Wolke am Südhimmel und der Andromedanebel am Nordhimmel – bereits mit bloßem Auge erkennbaren “Nebel”: Waren diese Gebilde Gaswolken in der Milchstraße, wie die einen glaubten; oder waren sie “Insel-Universen” außerhalb der Milchstraße? Das Rätsel konnte erst gelöst werden, als eine Methode zur Verfügung stand, auch die Entfernung weit entfernt liegender Sterne zu messen. Diese wurde von Henrietta Leavitt unter Nutzung der Cepheiden entdeckt. Cepheiden sind Sterne, deren Helligkeit regelmäßig schwankt; und Leavitt erkannte, dass die Schwankungsperiode mit der Helligkeit zusammenhing. Aus der Periode konnte man also die absolute Helligkeit dieser Sterne ermitteln, und damit auch ihre relative Entfernung voneinander – und nachdem es schließlich einem Team von Astronomen gelang, mit einer Kombination verschiedener Methoden die absolute Entfernung eines Cepheiden zu messen, konnte man auf dieser Basis die absolute Entfernung aller Cepheiden berechnen. 1923 entdeckte der Astronom Edwin Hubble einen Cepheiden im Andromedanebel, und bestimmte die Entfernung mit rund 900.000 Lichtjahren (080): Der “Nebel” lag eindeutig jenseits der Milchstraße, die einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren (082) hat. Damit erwies sich der Andromedanebel als eigenständige Anhäufung von Sternen. Heute nennen wir solche Sternenanhäufungen Galaxie, und unsere Milchstraße, Andromeda und die meisten Nebel sind eine solche Galaxie – einige Nebel erwiesen sich aber auch tatsächlich als Wolken aus Gas und Staub in der Milchstraße (nur diese werden noch heute als Nebel bezeichnet).



