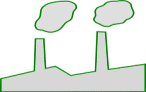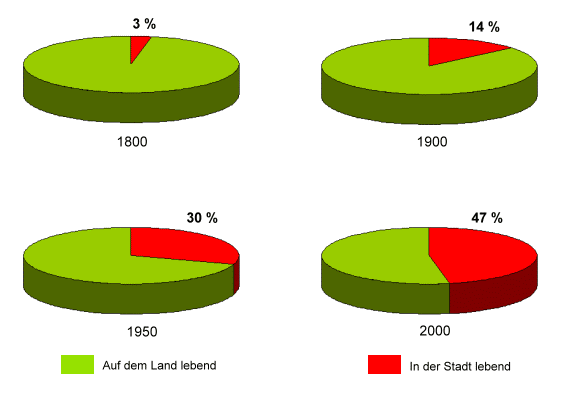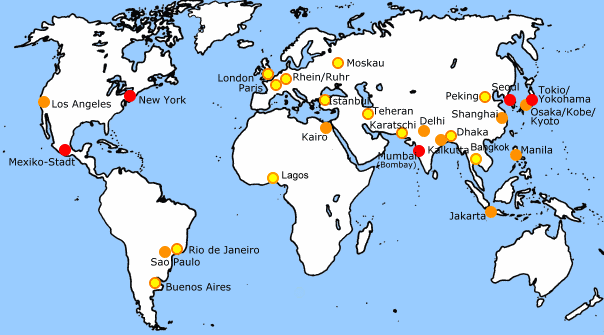Das Zeitalter der Industrie
Die Folgen der Industriellen
Revolution
Die Industrielle Revolution veränderte die
Länder, in denen sie geschah: der Bergbau und von Rauch und Schmutz
geplagte Industriereviere prägten ganze Regionen, die Städte wuchsen
und Verkehrsadern durchzogen das Land. Die wachsende Kluft zwischen
wohlhabenden Bürgern und armen Arbeitern brachte die soziale Frage
auf die Tagesordnung, eine Arbeiterbewegung zähmte den
Industriekapitalismus in den Ländern des Westens. Er prägte auch
große Teile des Rests der Welt und vertiefte die Kluft zwischen Arm
und Reich, brachte aber auch ungeheuren materiellen Reichtum. Die
Städte wurden immer attraktiver: heute lebt mehr als die Hälfte der
Menschheit in Städten, viele davon in Megastädten mit über 10
Millionen Einwohnern.

Industriearbeit in einem
Walzwerk (Ölgemälde von Adolph Menzel, entstanden 1872 bis 1875):
Die Arbeitsbedingungen in der Frühzeit der Industrialisierung waren
oftmals katastrophal. Abb. aus >>
wikipedia (abgerufen 30.8.2011), gemeinfrei.
Am Ende das Agrarzeitalters hatten gerade 3 Prozent der Menschheit
in Städten gewohnt,
die größten Städte im Jahr 1800 waren London, Edo (das heutige
Tokio), Beijing und Kanton; in Deutschland lebten über 90 Prozent
der Bevölkerung in Orten mit weniger als 5.000 Einwohnern, in den 18
“Großstädten” mit mehr als 20.000 Einwohnern lebten insgesamt
weniger als eine Million Menschen. Von der Industrialisierung
profitierten zuerst und am meisten die Stadtbewohner, und mit der
Industrialisierung wuchsen die Städte und entstanden neue
Städte: Baumwollstädte wie Lancashire, Zentren des Bergbaus und der
Metallverarbeitung wie Sheffield oder Manchester, Eisenbahnstädte
wie Swindon. Vor allem die von der Industrialisierung geprägten
Städte sahen ganz anders aus als die früheren Handelsstädte; 1803
beschrieb die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer die Stadt
Manchester, wo aufgrund der vielen Flüsse schon in vorindustrieller
Zeit viele durch Wasserkraft angetriebene Baumwollspinnereien
entstanden waren und dank des Bridgewater-Kanals früh Kohle in die
Stadt gelangte: “Dunkel und vom Kohlendampfe eingeräuchert, sieht
sie einer ungeheuren Schmiede oder sonst einer Werkstatt ähnlich”,
ihr englischer Kollege Charles Dickens berichtete von “Schmutz,
Finsternis und Elend". Die Industrialisierung ging mit ungeheurer
>> Luftverschmutzung
einher. Im Laufe der Zeit prägte überall in Europa, wo man mit Kohle
Maschinen antreiben konnte und eine eisen- und metallverarbeitende
Industrie entwickeln konnte – zuerst in Belgien, im Ruhrgebiet und
in Nordfrankreich – der Bergbau ganze Regionen und es entstanden
Industriereviere. Neue Kanäle und Eisenbahnlinien durchzogen das
Land. In Nordamerika wuchsen die Städte vor allem mit der
Einwanderungswelle ab 1840, es entstanden Industriestädte wie
Pittsburgh; New York erreichte 1860 800.000 Einwohner.
Die Einwohnerschaft der Städte unterschied sich immer deutlicher,
es entstand eine Trennlinie zwischen dem reichen Bürgertum und dem
armen "Proletariat" (wie die lohnabhängigen Arbeiter jetzt nach
römischen Vorbild wieder genannt worden), die in unterschiedlichen
Vierteln lebten. Die Arbeiter, die oft gerade erst der
Leibeigenschaft oder der Schuldknechtschaft des Feudalismus
entkommen waren, wurden vor allem in der Fabrikindustrie und den
Bergwerken mit Lohnarbeit konfrontiert: auf den ersten Blick ein
Fortschritt gegenüber der feudalen Zwangsarbeit, aber wie Karl Marx
mit seinem Wort vom >> doppelt
freien Bauern aufzeigte, war dieser Fortschritt zweischneidig:
die schiere Not zwang viele von ihnen in Arbeitsverträge, die nicht
besser waren als die Zwangsarbeit zuvor. War ein Arbeitsvertrag
geschlossen, war es mit der Freiheit nämlich vorbei: Die Arbeit in
den arbeitsteiligen Fabriken – im Takt und Tempo der Maschinen
– erforderte eine ganz andere Disziplin als etwa die
Heimarbeit zuvor, Aufsicht und Ausführung der Arbeit fielen
auseinander; und Verstöße wurden mit Geldstrafen, Androhung der
Kündigung und sogar mit körperlicher Züchtigung geahndet. Die
Arbeitszeiten waren extrem lang, 13 bis 16 Stunden am Tag keine
Seltenheit. Zwar wurde die Arbeit in den Fabriken besser bezahlt als
in der Landwirtschaft, aber in den neu entstehenden Städten
verdienten daran vor allem Spekulanten, die Häuser bauten und
Wohnungen teuer vermieteten; so teuer, dass auch die Kindern
arbeiten mussten – besonders gerne wurden sie in Textilfabriken, wo
sie die Spinnmaschinen reinigen mussten, und in den Bergwerken, wo
sie in die kleinsten Stollen passten, eingesetzt. Die Frühzeit des
Kapitalismus war auch von Not und Elend in den Industriestädten
geprägt (siehe >> Der
Kampf gegen die Infektionskrankheiten).
1842 bis 1844 lebte der Wuppertaler Fabrikentensohn Friedrich
Engels fast zwei Jahre lang in Manchester, wo er in einer
Baumwollspinnerei seines Vaters arbeitete und abends und am
Wochenende die Stadt erkundete. Er schrieb hierüber später das Buch
“Die Lage der arbeitenden Klasse in England”, in dem er nicht nur
von Arbeitszeiten von 12 bis 14 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche
berichtet und von unerträglichen hygienischen Verhältnissen in der
Stadt, in der Tuberkulose, Typhus und Scharlach grassierten, sondern
auch von einer großen Anzahl Verstümmelter – Maschinen wurden oft im
laufenden Betrieb geputzt, Verletzungen oder Tote waren dabei nicht
selten. Er lernt auch die Organisationen kennen, die die Lage der
Arbeiter verbessern wollen, wie die von Robert Owen inspirierten
Sozialisten. (Robert Owen, Leiter einer Baumwollspinnerei, hatte
schon 1799 zeigen wollen, dass auch mit menschenwürdigen
Arbeitsbedingungen Gewinne zu machen sind: Er senkte die
Arbeitszeit auf 10,5 Stunden am Tag und verbot in seiner Spinnerei
die Beschäftigung von Kindern unter 10 Jahren. Tatsächlich waren
Owens Änderungen ein Erfolg – auch, weil Owen viele Erfindungen
machte, die seine Konkurrenz nicht so schnell umsetzen konnten.
Owens Spinnerei wurde zum Musterbetrieb, den auch zahlreiche
Politiker besuchten.) Auf der Rückreise nach Deutschland lernte
Engels in Paris Karl Marx kennen, den er später
über Jahrzehnte finanziell über Wasser halten sollte und so die
Arbeit an seinem Hauptwerk “Das Kapital” ermöglichte, dessen zweiten
und dritten Band Engels nach Marx’ Tod aus dem Nachlass herausgab
(siehe >>
unten).
Die soziale Frage in den Industrieländern
Die „soziale Frage“ war von Anfang an mindestens in zwei Richtungen
zu verstehen: Die eine beschäftigte sich mit der Summe der
Umgestaltungen, die die Industriegesellschaft gegenüber
traditionellen Lebensformen bewirkte, etwa die Verdrängung von
Gemeinschaft und sozialen Bindungen durch Marktbeziehungen (oft war
diese Sorge aber auch verbunden mit der Idee von der
Wiederherstellung einer ständischen Gesellschaft). Die andere
konzentrierte sich auf die Konflikte zwischen Arbeitern und
Unternehmern, etwa um die Verteilung der erwirtschafteten Gewinne
(in Form von höheren Löhnen oder kürzeren Arbeitszeiten). Natürlich
hingen beide zusammen: Der Wandel der Gesellschaftsordnung, den die
Industrialisierung und die zunehmende Marktorientierung
auslösten, hatten erst einen freien Markt für Arbeit
(und damit die Konflikte zwischen Unternehmern und Arbeitern)
geschaffen; und auch einen Markt für Grund und Boden:
der Gemeinbesitz der Dörfer wurde zunehmend eingefriedet und zu
privatem Grundbesitz gemacht. Reich gewordene Grundbesitzer
investierten in die Industrie, verelendete Bauern konnten sich dort
als Arbeiter verdingen.
Die
Privatisierung der Gemeinschaftsgüter
Dass eine Zunahme des Privateigentums auf Kosten der
Gemeinschaftsgüter erfolgte, wie bei der Einfriedung beim Grund und
Boden deutlich erkennbar, hatte schon im 17. Jahrhundert den
englischen Philosophen John Locke nachdenklich: Da
Gott die Erde allen Menschen gegeben habe, dürfe der einzelne nur
soviel aus der Natur nehmen, wie er für seinen Unterhalt braucht und
sich durch Arbeit aneignen kann. Vorausgesetzt, dass “genug und
ebenso gutes den anderen gemeinsam verbleibt.” Diese Einschränkungen
galten mit zunehmender Marktorientierung nicht mehr; aber immer
wieder erkannten Beobachter, dass diese Umwandlung nur eine
Minderheit begünstigte: So schrieb etwa Thomas Paine,
einer der Gründerväter der USA, in seinem 1795/96 geschriebenen Buch
“Agrar-Gerechtigkeit”, dass die Einrichtung von Landeigentum die
große Mehrheit der Menschen von ihrem Naturerbe und der Möglichkeit
eines unabhängigen Überlebens fernhalte. Paine schlug vor, dass
jeder Bürger eine Entschädigung für die verlorengegangenen
naturrechtlichen Ansprüche erhalten soll (eine Einmalzahlung am 21.
Geburtstag und ab dem 50. Lebensjahr eine Entschädigung von 10 Pfund
Sterling jährlich – manche sehen Paine daher als Vorläufer der
späteren social security in den USA).
Noch heute weisen viele Kritiker (etwa >> Peter
Barnes) darauf hin, dass das gewaltige Kapital, das für die
Industrialisierung nötig war, vor allem durch die Aneignung (oder
auch “Diebstahl”) von Gemeineigentum zusammenkamen –
erstaunlicherweise, ohne dass die meisten Menschen dies auch nur
bemerkt hätten. Die Gemeinschaftsgüter sollten noch eine weitere
wichtige Rolle bei der Industrialisierung spielen: Da die Industrie
ihre Abgase, Abwässer und Abfälle kostenlos in Luft, Flüsse und
ungenutzte Landschaft – ebenfalls alles Gemeinschaftsgüter –
deponieren konnte, brauchte sie für deren Zerstörung nichts zu
zahlen, so dass diese Kosten bis heute als “externe Effekte”
vernachlässigt wurden (>>
hier). Für Barnes haben die Probleme auch damit zu tun, dass
die neuen Privateigentümer zunehmend gar keine Unternehmer mehr
waren, sondern Kapitalgesellschaften: Während Unternehmer wenigsten
noch als Person für ihr Handeln einstehen müssen, dienen
Kapitalgesellschaften nicht anderem als dem Maximieren von Renditen
für Aktionäre, und ihre Manager werden auch nur daran gemessen.
Rechtlich sind diese ihren Aktionären verpflichtet, aber wirklichen
Einfluss haben nur einige Großaktionäre – und das sind wiederum
oftmals Investmentfonds, die ebenfalls nur an der Rendite gemessen
werden. Wie immer: Wenn viele verantwortlich sind, übernimmt
letztlich niemand die Verantwortung.
Kapitalgesellschaften
verfügen außerdem über riesige Geldmengen, die sie nicht nur für die
Produktion einsetzen, sondern auch, um politischen Einfluss zu
erlangen. So finanzieren sie eine riesige Lobbyindustrie. Dieser
politische Einfluss sorgt dann auch dafür, dass Regelungen, die den
freien Markt zugunsten der Allgemeinheit einschränken – etwa der
Verbot, bestimmte Schadstoffe in die Atmosphäre abzugeben, oftmals
verspätet oder abgeschwächt getroffen werden (denken Sie etwa an den
Widerstand der Autoindustrie gegen die Einführung bleifreien
Benzins, des Katalysators oder aktuelle gegen niedrigere
Verbrauchsgrenzwerte). Da nach den Gesetzen des Marktes Gewinne auf
Grundlage der gehaltenen Anteile verteilt werden, fließt Geld nach
oben – wer schon hat, dem wird gegeben. Daher werden die
Kapitalgesellschaften immer größer und mächtiger: In den USA
umfassten die Umsätze der 500 größten Unternehmen im Jahr 1955 ein
Drittel des Bruttoinlandsproduktes, im Jahr 2004 schon zwei
Drittel. Ihr Einfluss wird daher immer größer.
Die Entstehung einer Arbeiterbewegung
Auch wenn die "freie" (Lohn-)Arbeit sich anfänglich nur graduell
von der Zwangsarbeit unterschied, eins hatte sich mit ihr doch
geändert: die Machtverhältnisse zwischen Unternehmern und
Lohnarbeitern waren zwar ungleich, aber nicht-ökonomische Zwänge
weniger bedeutsam geworden. Auch wirkten die Erkenntnisse der
Aufklärung und die Ideen von natürlichen Rechten aller Menschen
weiter. Die Staaten versuchten, mit Reformen eine Wiederholung der Ereignisse von 1789
zu verhindern, so wurde im britischen "Great Reform Act" die Zahl
der Wahlberechtigten von 400.000 auf 650.000 (etwa jeder fünfte
erwachsene Mann) erhöht. Auch die Arbeiter konnten sich zur Wehr
setzen und – individuell oder kollektiv – für Verbesserungen
kämpfen. Zum einen schlossen sie sich zusammen, um sich etwa im
Krankheitsfall gegenseitig zu unterstützen, um anderen setzten sie
sich gegen die Zustände zur Wehr. Ein Beispiel ist der schlesische
Weberaufstand von 1844 (der unter anderem Gerhard Hauptmanns Drama
“Die Weber” inspirierte). Arbeitervereine waren in Deutschland seit
den 1840er Jahren entstanden; im Vereinigten Königreich hatten sich
schon 1829 die Spinnereiarbeiter in einer Generalunion – der ersten
Gewerkschaft – zusammengeschlossen. Teils bewaffnete soziale
Unruhen und Generalstreiks, die mitunter blutig niedergeschlagen
wurden, begleiteten die Frühphase der Industrialisierung. 1848 kam
beides – der Ruf nach Reformen in der Gesellschaft und die
Unzufriedenheit in der Arbeiterschaft – zusammen: als der
französische König ein reformistisches Bankett verbot, kam es zu den
Demonstrationen der "Februarrevolution", der sich auch Heer und
Nationalgarde anschlossen. Die Welle erfasste halb Europa, auch in
Berlin, Wien, Budapest und Rom etwa kam es zu Aufständen. Als im
Juni die Pariser Nationalwerkstätten (in denen Arbeitslose
beschäftigt wurden) geschlossen wurden, kam es zu einem erneuten
Aufstand. Die Mittelschicht war aber nicht bereit, eine offene
Revolution zu wagen: Heer und Nationalgarde stellte sich jetzt
gegen die Arbeiter, und es gab mindestens 3.000 Tote. 15.000
Arbeiter wurden anschließend in Straflager verbannt. Einzige
Errungenschaft war in Frankreich die Wiedereinführung des auch von
der Mittelschicht geforderten allgemeinen Wahlrechts für Männer.
Auch die anderen europäischen Aufstände wurden allesamt
niedergeschlagen. (Das allgemeine Wahlrecht für Männer – eine der
Forderungen von 1848 – wurde 1870 in den USA eingeführt und galt ab
1871 auch im Deutschen Reich, allerdings erst ab einem Alter von 25
Jahren. Das erste Land, das das Wahlrecht auch für Frauen einführte,
war 1893 Neuseeland, in Europa waren Finnland (1907) und Norwegen
(1913) die Vorreiter.)
Die Rechte der Frauen
Wählen durften Frauen Ende des 19. Jahrhundert nur in Neeseeland
und South Australia, wo das Frauenwahlrecht 1894 eingeführt wurde.
Dass Frauen im öffentlichen Leben einen ganz anderen – schlechteren
– Status hatten als Männer, war ein Erbe der konservativen
Gesellschaften des Agrarzeitalters. Die Frau galt mehr oder weniger
als Eigentum des Mannes, der sie in vielen Ländern auch schlagen
durfte (solange er sie dabei nicht umbrachte), auch ihr bewegliches
Eigentum gehörte ihren Ehemännern, auch das Geld, das sie womöglich
verdiente. Scheidungen waren lange fast unmöglich (in ganz England
gab es von 1700 bis 1857 , in dem die Ehe zu einem weltlichen
Vertrag wurden, im Durchschnitt zwei Scheidungen pro Jahr).
Seit 1833 erlaubte das neu gegründete Oberlin College im
US-Bundesstaat Ohio als erste Hochschule Frauen den Besuch von
Vorlesungen, seit 1837 konnten sie auch Abschlüsse erwerben. 1849
machte Elizabeth Blackwell am New Yorker Geneva Medical College als
erste Frau einen Abschluss als Ärztin, in Europa verteidigte 1867
eine Russin erfolgreich ihre Doktorarbeit an der Universität Zürich.
In Deutschland konnte 1880 die Britin Hope Bridges Adams als erste
Frau ihr Medizinstudium mit einem Staatsexamen in Leipzig
abschließen, das jedoch nicht anerkannt wurden, so dass sie in Bern
ihren Doktor machte und schließlich mit einer irischen Zulassung
(Approbation) in Deutschland praktizierte. In England konnten Frauen
seit 1878 auch Universitätsabschlüsse machen (am University College
London, aber die Universität Cambridge beispielsweise verlieh bis
1948 keine Abschlüsse an Frauen). 1903 erhielt Marie Curie
(>> Eine kleine Geschichte der
Atomkraft) als erste Frau einen Nobelpreis (und 1911 erneut –
sie war der erste Mensch, der einen zweiten Nobelpreis erhielt).
(Nebenbei: Marie Curie war nur deshalb nach Paris gegangen, wo sie
die mit dem Nobelpreis gekrönten Arbeiten durchführte, weil die
Universität Krakau in ihrem Heimatland Polen keine Frauen aufnahm.)
Mehr als von der höheren Bildung, die selten zur
Anerkennung von Frauen als gleichberechtigte Mitglieder in den
jeweiligen Fachkreisen führte, profitierten Frauen von der
Einführung der allgemeinen Schulpflicht (die in Preußen schon 1717,
aber etwa in den USA erst nach 1851 und in England erst 1880
eingeführt wurde): diese galt in der Regel für alle Kinder, und
führte dazu, dass Frauen ebenso gut lesen und schreiben lernten wie
Männer, in manchen Ländern wie Kanada sogar besser. Der nächste
Fortschritt kam – gänzlich unbeabsichtigt – mit dem Ersten
Weltkrieg, dem ersten "totalen Krieg", der die Ressourcen der ganzen
Nation in den Krieg einbezog: die Männer waren an der Front, also
"durften" die Frauen in den Munitionsfabriken arbeiten. Viele hatten
damit zum ersten Mal eine bezahlte Arbeit, und durften auch ohne
männliche Begleitung reisen. Auch wenn es sicher die eine oder
andere Auseinandersetzung gab, als die Männer aus dem Krieg
zurückkehrten (wenn sie denn zurückkehrten), ließen sich diese
Freiheiten nicht rückgängig machen – nach dem Ersten Weltkrieg
erhielten die Frauen z.B. auch in Deutschland das Wahlrecht. (In den
Ländern, wo dies nicht so war, geschah das dann nach dem Zweiten
Weltkrieg – etwa in Frankreich, Italien oder Japan.)
Im Jahr der Aufstände 1848 war
auch Marx' und Engels gemeinsam verfasstes „Kommunistisches
Manifest“ erschienen, das den Untergang des Systems
durch die Revolution der Arbeiterklasse voraussagte – das Buch wurde
zum Weltbestseller. Wissenschaftlichen Anspruch hatte Karl
Marx’ ab 1867 erscheinendes Hauptwerk >> „Das
Kapital“: Für Marx war der Drang, die Natur zu gestalten, das
Merkmal des Menschen; die Arbeit damit Ausdruck des menschlichen
Wesens. Mit der Lohnarbeit und der Arbeitsteilung verliere der
Mensch die Verfügungsgewalt über die Arbeit, sein wahres Menschsein
werde dadurch zerstört. Da die gesellschaftlichen Beziehungen
zwischen konsumierenden und produzierenden Menschen statischer
seien als die Produktivkräfte, also die Arbeitsgeräte, Maschinen und
das Wissen und Können der Arbeiter, würden die Spannungen so groß
werden, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse umgestürzt würden.
Die Klasse der Lohnarbeiter werde immer zahlreicher und die durch
Konzentrationsprozesse immer kleiner werdende Kapitalistenklasse
entmachten. Da die Lohnarbeiter damit die Produktionsmittel in die
Hand bekämen, würde die Arbeit selbstbestimmt und der Mensch würde
sich endlich selbst verwirklichen können.
Es sollte anders kommen. Die Arbeiterbewegung wurde zwar stärker –
in Sachsen wurde beispielsweise 1863 mit dem "Allgemeinen Deutschen
Arbeiterverein" eine erste Massenpartei der Arbeiter gegründet
wurde; 1864 entstand in London die Internationale
Arbeiter-Assoziation. 1875 vereinigte sich der Allgemeine Deutsche
Arbeiterverein mit der 1869 in Eisenach gegründeten
"Sozialdemokratische Deutsche Arbeiterpartei" zur Sozialistischen
Arbeiterpartei Deutschlands (die sich 1890 in
Sozialdemokratische Arbeiterpartei Deutschlands, SPD,
umbenannte). Andererseits wurden, wie von Marx vorhergesehen, die
Unternehmen immer größer, aber damit wurde die Kapitalistenklasse
nicht kleiner – vielmehr wurde sie um Manager und leitende
Angestellte erweitert (siehe >> unten).
Die Mittelschichten verschwanden nicht, wie von Marx vorausgesehen,
sondern wuchsen stärker an als die Industriearbeiterschaft. Aus
dieser stiegen zudem qualifizierte Facharbeiter in die
Mittelschichten auf.
In den 1870/1880er Jahren hatten die Nationalstaaten ausreichend
Gestaltungskraft gewonnen, mit der sie auch in Wirtschaft und
Gesellschaft eingriffen. Als Reaktion auf den >>
Gründerkrach, der an wirtschaftsliberalen Ideen zweifeln ließ,
und auch aus Angst vor der erstarkenden sozialdemokratischen
Bewegung – die Reichskanzler Bismarck in Deutschland 1878 mit einem
"Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der
Sozialdemokratie" (Sozialistengesetz) verbieten wollte – erließ
derselbe Bismarck (sozusagen als Zuckerbrot zur Peitsche) in
Deutschland eine Sozialgesetzgebung: seit 1883
sind Arbeiter in Deutschland krankenversichert, seit 1884
unfallersichert und seit 1889 altersversichert. Bismarcks
Sozialgesetzgebung wurde in vielen anderen Ländern übernommen und
gilt als Beginn des Sozialstaats. In Deutschland
führte sie aber nicht (wie erhofft) dazu, die Arbeiterschaft von der
Sozialdemokratie zu entfremden, sondern eher dazu, diese zu
radikalisieren und ein von der bürgerlichen Gesellschaft
abgeschlossenes "sozialdemokratisches Milieu" zu schaffen. 1890
lehnte der Reichstag die Verlängerung des Sozialistengesetzes ab,
die Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands nannte sich
daraufhin in Sozialdemokratische Arbeiterpartei
Deutschlands, SPD, um. Diese strebte nach intensiver
Debatte nicht mehr an, den Kapitalismus durch eine Revolution zu
besiegen, sondern ihn durch Reformen zu verbessern. Dazu trugen auch
steigende Löhne bei, durch die auch Lohnarbeiter so weit vom
materiellen Reichtum profitierten, dass sie im Ganzen eher an
pragmatischen Verbesserungen ihrer Lage als an revolutionären
Umstürzen interessiert waren. (Der Marxismus wurde in keinem Land
durch einen Aufstand der Arbeiterklasse an die Macht gebracht; und
die Sowjetunion und China waren zum Zeitpunkt ihrer „Revolutionen“
nicht einmal Industriestaaten.) Und in den Industrieländern hat der
Industriekapitalismus insbesondere den Menschen, die nicht der
Oberschicht angehören, einen materiellen Lebensstandard und eine
(gesunde) Lebensdauer ermöglicht, für die es keinen historischen
Vergleich gibt.
Leben
in einer Industriegesellschaft
Die materielle >>
Produktivität der Industrie führte vor allem in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhundert zu nie gekanntem materiellen Reichtum in
den Industriegesellschaften. In diesen Ländern besitzen heute die
Armen mehr materielle Güter als die Reichen vor der
Industrialisierung. Die Symbole dieser Warengesellschaft war die
Entstehung der ersten Warenhäuser: Bon Marché in Paris, Hermansky in
Wien, Tietz in Berlin. Im 20. Jahrhundert entstanden die ersten
Supermärkte, die Lebensmittel anboten, und schließlich
Einzelhandelskonzerne wie Wal Mart oder Carrefour, die
Einkaufszentren außerhalb der Städte aufbauten.
Nachdem die Menschen ihre Grundbedürfnisse nach Nahrung, Wohnung
und Kleidung so befriedigen konnten, entstanden immer neue Märkte:
Etwa gleichzeitig kämpften das >>
Auto und die elektrischen Haushaltsgeräte um den Geldbeutel
der Verbraucher, als auch hier die Märkte weitgehend gesättigt
waren, folgte die Unterhaltungselektronik: Radios, Fernseher,
Videorekorder und heute DVD-Player, Fernseher mit Flachbildschirmen,
MP3-Player, Digitalkameras, ... Der Zugang zu diesen Produkten wurde
durch Kreditangebote erleichtert: Ratenkauf, Verbraucherkredite und
Kreditkarten ermöglichten den Kauf über die Verhältnisse hinaus;
immer mehr Produkte, die in früheren Jahrzehnten nur den Reichen zur
Verfügung standen, wurden Massenware. Ein Beispiel sind Fernreisen.
Ohnehin entwickelte sich der Freizeit- und Tourismussektor zum
nächsten Gewinner: In England entstand 1885 die erste professionelle
Fußballliga, bald bezahlten 300.000 Menschen jede Woche Geld, um bei
einem Fußballspiel zusehen zu dürfen. Anfang des 20. Jahrhundert
entstanden Kinos, 1869 bereits hatte Thomas Cook die erste
außereuropäische Reise (nach Ägypten und Palästina) angeboten, 1900
erschien der erste Michelin-Reiseführer. Das Flugzeug gewann ab den
1950er Jahren an Bedeutung. Heute ist Tourismus einer der
wichtigsten Wirtschaftszweige der Welt.
Dabei zeigen aber Befragungen und andere Indikatoren
– die Zahl der Selbstmorde, die Zahl der Depressionen – dass
die Menschen durch allen materiellen Wohlstand ab einer bestimmten
Schwelle nicht glücklicher werden (>> mehr).
Da gleichzeitig die Herstellung all der Produkte und
Dienstleistungen die natürlichen Lebensgrundlagen gefährden (siehe
links >>
hier), hat die Suche nach einem neuen Lebensmodell längst
begonnen (>> mehr).
Der
Aufstieg des Managerkapitalismus
In der Frühzeit der Industriellen Revolution waren Eigentümer und
Unternehmer zumeist identisch: Der Eigentümer besaß das Unternehmen
und leitete es. Wenn das eigene Kapital nicht ausreichte, wurde es
oft im Familien- und Verwandtenkreis eingesammelt, viele
Unternehmen wurden auch von mehreren Familienmitgliedern geleitet
(etwa das Bankhaus Rothschild oder Siemens). Über ihre Familien
waren diese frühen Kapitalisten eng mit ihrem sozialen Umfeld
verbunden. In solchen Familienunternehmen war der Gewinn in aller
Regel nicht das alleinige Erfolgskriterium; mitunter wurden etwa
mögliche Expansionen nicht wahrgenommen, um den Familieneinfluss zu
erhalten. In kleinen und mittelgroßen Unternehmen findet man diese
Konstellation immer noch; aber bei vielen Großunternehmen reichte
das Familienkapital nicht aus, um mit der Entwicklung Schritt zu
halten: Siemens etwa hatte 1874 noch 650 Mitarbeiter, 1914 bereits
über 57.000. Neue Industrien wie die Elektrotechnik wuchsen schnell,
und nach dem >>
Gründerkrach von 1873 kam es auch zu Zusammenschlüssen in Form
von Kartellen, Holdings oder Konzernen – mit ihnen sollte die
Konkurrenz begrenzt oder sogar ausgeschaltet werden. Diese
Großunternehmen gehörten in vielen Fällen keinem einzelnen
Eigentümer mehr, sondern gehörten – über Aktienbesitz – zum
Beispiel den Banken, die nun stärker als früher in die Industrie
investierten. Viele dieser Konzerne waren zudem hochgradig
integriert und hatten von der Rohstoffversorgung über die
Produktion bis hin zum Vertrieb alle Schritte der Produktherstellung
in der Hand.
Damit veränderte sich aber das Unternehmen: War zuvor der Markt das
zentrale Koordinationsinstrument gewesen, mussten die Tätigkeiten
der Konzerne auch im Inneren koordiniert werden; die
Unternehmensorganisation und damit angestellte Manager gewannen an
Bedeutung. Da nun nicht mehr Eigentümer(-Familien) die Ausrichtung
der Unternehmen bestimmten, sondern stärker am Gewinn orientierte
Investoren und die leitenden Manager zum Teil erfolgsabhängig
bezahlt wurden, fürchteten viele, dass das unternehmerische Handeln
im Managerkapitalismus rücksichts- und verantwortungsloser (da ein
angestellter Manager kaum mit seiner gesamten Existenz für Verluste
einstehen werde) werden könnte. Familienbezogene Rücksichten nahmen
sicher auch ab, aber schließlich standen auch angestellte Manager
oftmals mit ihrem Namen für den Unternehmenserfolg (etwa Emil
Rathenau für die AEG), aber waren eben auch mit Misserfolgen
sichtbar verbunden, so dass wirtschaftliches Handeln immer noch so
weit in einen sozialen Zusammenhang eingebettet blieb. Es konnte
noch nicht generell von „organisierter Verantwortungslosigkeit“
geredet werden.
Der Aufstieg des Finanzkapitalismus
Das änderte sich, als sich im Gefolge der ersten >> Ölkrise
von 1973 >> neoliberale
bzw. marktkapitalistische Ideen wie die von Friedrich August
von Hayek und Milton Friedman vor allem in Großbritannien und den
USA durchsetzen und die staatliche Regulierung abgebaut wurde:
Dies, und das Ende des >>
Bretton-Wood-Systems der internationalen
Währungsstabilisierung, führte zu neuen >> Geschäftsmodellen
für Banken und einem raschen Anwachsen des Finanzsektors,
dessen Bedeutung am wirtschaftlichen Gesamtprodukt deutlich wuchs:
In den USA etwa von den 1950er Jahren bis 2008 von zwei auf acht
Prozent. Dabei verlor er seine einst dienende Funktion – die
Finanzierung von Investitionen in produktive Zwecke – und wurde zum
Selbstzweck: es wurde spekuliert – Geld sollte Geld verdienen; die
Profite stammten nicht mehr daraus, dass Werte geschaffen wurden.
Aber die Gewinne stiegen exorbitant an; so dass auch große
Industrieunternehmen bald eigene Finanzdienstleister gründeten, die
schnell mehr Geld verdienten als das Kerngeschäft. Die Profite des
Finanzsektors führten auch dazu, dass zahlreiche
Kapitalbeteiligungs-Gesellschaften entstanden, etwa Investment-
und Pensionsfonds.
Diese Fonds mussten aber ihre Anleger im Wettbewerb mit anderen
Fonds gewinnen, und das Kriterium für die Anleger war in der Regel
der erzielte Gewinn. Die Fonds konnten ihn steigern, indem sie
einerseits Aktien schneller kauften und verkauften, und andererseits
ihre Interessen – im Namen der Anteilseigner – deutlich gegenüber
den Unternehmensleitungen vertragen. So verloren die Manager
produzierender Unternehmen an Macht, die sie gegenüber den an
langfristigen Erfolg orientierten Banken (zumindest, solange die
Geschäfte gut liefen) oder bei zersplitterter Eigentümerstruktur
noch hatten; das Interesse der Anteilseigner ("shareholder
value") wurde zum wichtigsten Maßstab, an dem sie gemessen
wurden. Nicht-ökonomische Werte und Zusammenhänge wie die
Traditionen der Unternehmen, Inhalte oder die Interessen der
Mitarbeiter zählten nur insofern, als sie dem shareholder
value dienten. Mit den Investmentbankern, Analysten und
Rating-Experten gewannen rein nach der Logik der Finanzmärkte
arbeitende Finanzmanager ohne soziale Einbindung immer mehr Einfluss
auf das Wirtschaften von Unternehmen; die Deregulierung erlaubte
zudem, dass die Gewinne der Kapitalanlagegesellschaften
reinvestiert, sondern an Manager und Anteilseigner ausgeschüttet
wurden.
Ein Gesicht in der Öffentlichkeit hatten diese Investmentbanker,
Analysten und Rating-Experten aber nicht; und ihre rein ökonomische
Logik wurde auch kritisiert. Aber vielen galt der >> Zusammenbruch
des Ostblocks auch als Beweis für die Überlegenheit des
Marktkapitalismus. Die Existenz einer nicht-kapitalistischen
Alternative hatte zudem bis dahin dazu geführt, dass Vertreter der
Kapitalseite und ihnen nahestehende Politiker Forderungen nach
sozialer Gerechtigkeit ein Stück weit entgegenkamen, um so noch
radikaleren Veränderungen vorzubeugen. Vor allem international und
vor allem im Bereich der Finanzwirtschaft nahm die Deregulierung
weiter zu; und führte zu einem Ausmaß an „organisierter
Verantwortungslosigkeit“, den die >> Finanzkrise
von 2008 deutlich zeigte: für die Folgen seiner Entscheidungen
wollte (und konnte) der Finanzsektors nicht eintreten, so dass
letztendlich die exorbitanten Gewinne der Bankmanager durch
öffentliche Finanzmittel getragen werden. Und ein handlungsfähiges,
grenzüberschreitendes politisches Entscheidungssystem, das den
global tätigen Finanzsektor wieder in einen sozialen Zusammenhang
einbettet und zu einer Übernahmen von Verantwortung – auch für
nicht-ökonomische Werte – zwingt (ähnlich etwa den staatlichen
Regelungen, die einst die Lage der Arbeiter verbesserten), ist nach
wie vor nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die einseitige ökonomische
Logik unter dem Druck durch die Globalisierung führen dazu, dass
Managergewinne steigen, während auch in den am weitesten
entwickelten Industriegesellschaften informelle, weitgehend
ungeschützte Arbeitsverhältnisse wieder zunehmen. So arbeiten in
Deutschland etwa 1,7 Millionen Menschen für einen Stundenlohn von
weniger als 5 Euro die Stunde. Mindestlöhne werden dadurch umgangen,
dass die Betroffenen Werkverträge (für die es keinen Mindestlohn
gibt) erhalten oder bei Scheinfirmen, die im (ost-)europäischen
Ausland (für die das dortige Recht gilt) ansässig sind, beschäftigt
werden. In den Ländern, die gerade die Phase der
Frühindustrialisierung durchlaufen, bedienen sich auch westliche
Konzerne gerne mittels "outsourcing" lokaler
Subunternehmer, die fundamentale gesetzliche Vorschriften oder
Sozial-, Sicherheits- und Umweltstandards häufig umgehen oder
ignorieren.
Die Auswirkungen auf den Rest der Welt
Die Industrielle Revolution beruhte von Anfang an auf Rohwaren
aus der ganzen Welt: Die Baumwolle für die englische
Textilindustrie kam aus dem Süden Amerikas und aus Indien, später
auch aus Ägypten und anderen afrikanischen Ländern; Färbestoffe und
-techniken kamen aus Indien und dem Ottomanischen Reich. Im Gegenzug
kamen fertige Produkte zurück. Vor der Industriellen Revolution
stellten die meisten Länder ihre eigene Kleidung her; im Jahr 1700
war Indien der weltgrößte Textilexporteur. Mit dem Aufstieg der
englischen Textilindustrie wurden all diese weniger effizienten
Hersteller vom Markt verdrängt: Die Bevölkerung des indischen
Textilzentrums Dhaka (im heutigen Bangladesch) sank von 1750 bis
1850 um mehr als die Hälfte, das persische Isfahan verlor von 1830
bis 1890 90 Prozent seiner Seidenspinnereien. Anderen Branchen ging
es ähnlich: Englische Metallwaren waren billiger als die aus Asien,
Afrika oder Lateinamerika und verdrängten sie aus großen Teilen des
Marktes.
England kaufte nicht nur Rohwaren, sondern auch Lebensmittel und
andere Waren (Getreide aus Amerika und Russland, Holz aus Kanada und
dem Baltikum, Schafe aus Australien, Rindfleisch aus Argentinien und
Nordamerika, Tee aus Indien und China, Kaffee und Zucker aus der
Karibik, ...). Mit den Erfindungen der Industriellen Revolution, dem
Dampfschiff, der Eisenbahn, den Lastkraftwagen und
später den Flugzeugen
und ihrer Verknüpfung zu einem schließlich globalen Verkehrsnetz
nahm der Waren- und Personenverkehr stetig zu. Viele der
Erzeugerländer sahen ihre Zukunft nicht wie die europäischen
Nachbarn Englands in ihrer eigenen Industrialisierung, sondern als
Lieferant von Agrarprodukten für die Industrieländer. Mit den
schnellen Verkehrsmitteln konnten Lebens- und Genußmittel in immer
größeren Mengen und immer weiter transportiert werden,
ebenso wie Maschinen, Werkzeuge, Dünger und Pestizide zu ihrem
Anbau. Das führte zu einer globalen Spezialisierung in der
Landwirtschaft: Warum sollte man etwa in den hügeligen Regionen
Englands Weizen anbauen, wenn dieser billiger aus Kansas zu
importiert werden konnte? So trug die Industrielle Revolution zur
globalen Industrialisierung
der Landwirtschaft bei. Das ermöglichte ein nie gesehenes Bevölkerungswachstum der
Menschheit, damit wurde die Nahrungsmittelversorgung aber auch
von fossilen Brennstoffen für die Maschinen, die sie erzeugte und
für die Fahrzeuge, die sie transportierten, abhängig – ohne fossile
Brennstoffe wären die meisten Menschen auch in den Industrieländern
heute wieder vom Hunger bedroht.
Zur Versorgung der Industrieländer müssten in den Lieferländern
neue Gehöfte und Plantagen angelegt werden, und Arbeitskräfte
wurden gebraucht. Oft wurden diese gekauft. Das frühe
Industriezeitalter führte daher außerhalb Westeuropas zunächst nicht
zu einem Anstieg der Lohnarbeit, sondern zu einer Blüte
der Sklaverei: In Amerikas Süden arbeiten Sklaven in der
Baumwollproduktion, in Brasilien auf Kaffee- und Zuckerplantagen;
in Russland und Osteuropa arbeiteten Leibeigene auf den
Getreidefeldern, und in Westafrika in der Palmölproduktion. Zwar
äußerten sich seit den 1780er Jahren immer mehr Menschen gegen die
Sklavenhaltung; aber bis zu ihrer Abschaffung sollte es >> noch 80 Jahre dauern.
Die Abschaffung der Sklaverei befreite unter anderem vier Millionen
Menschen in den USA, eineinhalb Millionen in Brasilien – und 50
Millionen Leibeigene in Russland. Aber das führte noch immer nicht
zu einem Sieg der Lohnarbeit. Neue Arbeitskräfte wurden auch in den
armen Regionen der Welt gesucht: Vor allem Indien und China
lieferten jetzt Arbeitskräfte – 30 bis 40 Millionen Inder arbeiteten
vor allem im Britischen Empire, chinesische “Kulis” gingen vor allem
auf die Plantagen Südostasien, aber auch zum Eisenbahnbau nach
Nordamerika und Kanada. Im Gegenzug für die Bezahlung der Überfahrt
verpflichteten sich diese Menschen oft zu einer "Vertragsknechtschaft",
die dem Arbeitgeber oft jahrelang eine nahezu unbeschränkte
Verfügungsgewalt über den Vertragspartner verlieh. Das traf nicht
nur Inder und Chinesen: auch die armen Regionen Europas verließen ab
1840 etwa 50 bis 60 Millionen Menschen; 70 Prozent von ihnen gingen
nach Nordamerika, aber vor allem Italiener, Spanier und Portugiesen
auch nach Argentinien und Brasilien.
Eine Arbeiterbewegung wie in Westeuropa entstand im 19. Jahrhundert
nur in den USA (wo die Gewerkschaften allerdings zunehmend auch zu
einer Schutzgemeinschaften der Facharbeiter gegenüber [ungelernten]
Einwanderern und Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern wurden). Das zeigt,
dass diese nicht zwangsläufig aus dem Spannungsfeld Kapital – Arbeit
hervorgeht, sondern auch von den gesellschaftlichen Bedingungen
abhängt: Die freiheitlichen Verfassungsordnungen seit dem 18.
Jahrhundert begrenzten in Westeuropa die Wahrnehmung des
Eigeninteresses der wirtschaftliche Starken und erlaubten – bei
allen Einschränkungsversuchen wie Bismarcks Sozialistengesetz – ein
gemeinschaftliches Handeln der Arbeiter. Sklaven und Vertragsknechte
hatten dieses Recht nicht. (Auch im heutigen China gab und gibt es
zahlreiche Proteste der Lohnarbeiter, die durchaus den frühen
Lohnarbeitern in Westeuropa vergleichbar ausgebeutet und entwurzelt
werden – aber eine überregionale Arbeiterbewegung ist dort nicht
entstanden.)
Die oben beschriebene Entwicklung in den Kolonien hatte schon vor
der Entstehung des Industriekapitalismus begonnen (siehe >> hier), die
Abhängigkeit der Industrieländer von den Rohstoffen und
Nahrungsmitteln aus den Kolonien steigerte aber die Gewinne der
exportorientierten Plantagenwirtschaft und führte damit zu einem
weiteren Ausbau. Auch die Gewinne aus Sklavenhandel, Sklavenarbeit
und anderer Formen der Zwangsarbeit wie der Vertragsknechtschaft
haben den Industriekapitalismus in seiner Frühzeit angetrieben,
nicht nur die Ausbeutung der Lohnarbeiter. Eine Alternative hatten
die Lieferländer kaum: Die Industrieländer nutzten ihre
industriellen Kenntnisse auch für die Herstellung von Waffen, und
dampfbetriebene Kanonenboote und Maschinengewehre machten sie
militärisch auch einer großen Übermacht gegenüber derart überlegen,
dass Militäraktionen oft schon bei geringen Anlässen ausgelöst
wurden. England hatte 1783 die Vereinigten Staaten verloren, aber
verleibte sich von 1750 bis 1860 Indien stufenweise ein – zunächst
mit Hilfe der East India Company, und später dann direkt.
1914 umspannte das >> Britische
Empire die ganze Welt. Andere Industrieländer waren nicht
besser: Frankreich eroberte Kolonien in Afrika und Indochina,
Belgien in Afrika. Deutschland, obwohl durch seine späte Vereinigung
im Jahr 1871 ein Nachzügler, zog in Afrika und im Westpazifik nach
(mehr: >> Die Welt wächst
zusammen).
Wachsende Ungleichheit
Die Kolonialisierung, der globale Austausch von
landwirtschaftlichen Produkten und Industriewaren und die
Auswanderung vieler Millionen Menschen – alle drei übrigens
erleichtert durch die >> Erfindung
des Telegrafen – führten zu einer ersten
Globalisierung: Es entstand ein Weltmarkt, der durch den
1878 eingeführten >> Goldstandard
(die Deckung von Währungen durch Gold) unterstützt wurde. Er machte
einerseits Wirtschaftskrisen weltweit spürbar, führte aber auch zu
enormem Wirtschaftswachstum – von 1870 bis 1913 verdreifachte sich
die Produktion nahezu. Gleichzeitig nahm die Ungleichheit zu: Vom
neuen Reichtum profitierten vor allem die Industrieländer und einige
besonders bevorzugte Agrarregionen in den USA, Kanada, Argentinien
und Australien. Diese Regionen sollten sich >>
ebenfalls industrialisieren, andere wurden abgehängt. Zu
Anfang des 21. Jahrhunderts erhalten die ärmsten 20 Prozent der
Weltbevölkerung etwa ein Prozent des Welteinkommens, drei
Milliarden Menschen leben von höchstens 2 US-$ am Tag. Das ist oft
nicht genug, um ausreichend Essen zu kaufen (>>
mehr).
Kulturelle Folgen
Mit dem weltweiten Verkehrsnetzwerk wurden nicht nur Waren
exportiert, sondern auch Ideologien. Die westliche Welt sah ihre
säkularen, materialistischen, egalitären und demokratischen Werte
als die Krönung der Zivilisation und wollte den Rest der Welt damit
beglücken. Auch das war nicht neu: schon der Erfolg der
Kolonialisierung hatte europäische und amerikanische Missionare dazu
verführt, ihren Glauben über die Welt zu verbreiten. Die
Einheimischen hatte diesen oft mit ihren alten Religionen
verschmolzen, wodurch neue Glaubensrichtungen entstanden. Die
Sprachen der Kolonialherren – vor allem Englisch, Spanisch und
Französisch – breiteten sich aus und einheimische Sprachen wurden
seltener und starben oft ganz aus; mitunter schufen aber die
zugewanderten Arbeiter eigene Sprachen als Gemisch aus ihren
Ursprungssprachen (so gibt es auf den karibischen Inseln heute mehr
als 25 kreolische Mischsprachen). Da sie Handelspartner und die
Politiker in den Ländern des Südens, wenn sie sich nicht abschotten
wollten, zumindest so tun mussten, als ob sie westliche Praktiken
übernehmen wollten, waren sie dazu gezwungen, innerhalb weniger
Jahrzehnte die wissenschaftliche, medizinische, landwirtschaftliche
und industrielle Entwicklung des Westens nachzuvollziehen. So
entstanden in den Ländern Enklaven des Westens; im Jahr 2000 lebte
zum Beispiel schon fast die halbe Menschheit in Städten.
Die Verstädterung der
Menschheit
Ab Mitte der 1850er Jahre hatten die schlechten
hygienischen Bedingungen in den Armenvierteln zu teils groß
angelegten Stadtsanierungen geführt: In Paris ließ George-Eugène
Haussmann alte Viertel abreißen, ließ Straßen verbreitern und
gliederte Vororte in die Stadt ein, in London führte eine
Choleraepidemie und der Gestank aus der Themse, in die die Abwässer
eingeleitet wurden, in der zweiten Hälfte zum Bau eines
Kanalisationssystems. Gaslaternen beleuchteten zunehmend die
Straßen der Städte, Straßen- und U-Bahnen (die erste wurde 1863 in
London eröffnet – gezogen von einer Dampflok und ausgestattet mit
Gaslampen) erleichterten die Bewegung in der Stadt.
Mit der Verbreitung des Autos (ab 1920 in den USA, ab 1950 in
Europa) dehnten sich die Städte noch weiter in ihr Umland aus. Auch
die neu entstehende Leichtindustrie wanderte oft hierhin ab. Neue
Städte entstanden in den sich industrialisierenden Gesellschaften,
so stieg der Anteil der Stadtbevölkerung in der Sowjetunion von 20
auf über 60 Prozent, Moskau wurde bis Ende des Jahrhunderts zur
6,5-Millionen-Stadt. In Japan entstanden Städte rund um Tokio,
dessen Fläche sich von 1923 bis 1945 verdoppelte. Noch schneller
wuchsen aber die Städte in den Entwicklungs- und Schwellenländern,
wo Riesenstädte entstanden: Lagos in Nigeria, Nairobi in Kenia,
Ankara in der Türkei. Vor allem aber erreichte Lateinamerika einen
Verstädterungsgrad wie Europa oder Nordamerika (in Afrika und Asien
leben “nur” ein Drittel der Menschen in Städten). Die Attraktivität
der Städte hat hier vor allem damit zu tun, dass sich hier die
wirtschaftliche Aktivität der Länder konzentriert und wenigstens
eine minimale Infrastruktur besteht. Aber in vielem gleichen die
Lebensbedingungen denen der frühen Industriestädte; etwa ein
Drittel der Stadtbevölkerung lebt in Slums – weltweit über eine
Milliarde Menschen. Stadt zu Beginn des 21. Jahrhunderts – das ist
die Pracht von New York oder Tokio ebenso wie die Slums von Lagos
oder Kalkutta.
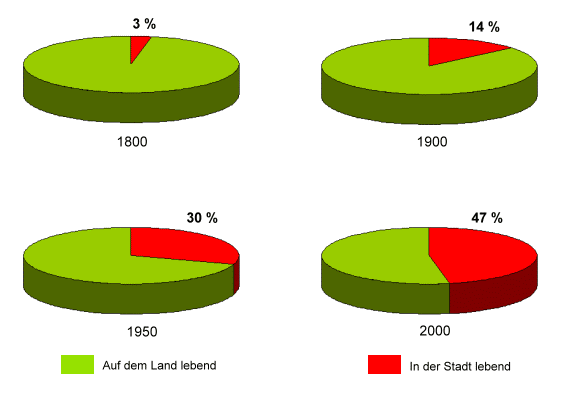
Im Verlaufe des
Industriezeitalters zogen immer mehr Menschen in die Städte.
Im Jahr 2006 lebten erstmals mehr Menschen in der Stadt als auf dem
Land. Eigene Abbildung nach >> Clive
Ponting: A New Green History of the World.
Gemeinsam ist all diese Städten aber, dass die Menschen in ihnen
unter dem Lärm und in vielen Regionen auch noch unter der
Luftverschmutzung der Last- und Lieferwagen zu ihrer Versorgung und
der Autos zum Transport der Menschen leiden. Die Verkehrssystem
führten zu einer Konzentration auf die Stadtzentren;
Verkehrsverbindungen zu ihrer Versorgung hatten Vorrang vor den
Fußgängern, Fahrradwegen und Gärten und anderen Lebensräumen.
Gebäude und Straßen prägten die Umwelt des Menschen in den Städten,
wo heute die Mehrheit der Menschen wohnt – vermutlich auch ein Grund
für die Entfremdung des Menschen von der Natur. Dennoch blieben die
Städte attraktiv; für die Reichen ist das Unterhaltungs- und
Kulturangebot offenbar Kompensation genug für ihre Schattenseiten.
Im 20. Jahrhundert stiegen die Mieten in den besseren Vierteln der
Ballungsgebieten deutlich an; um all die Menschen, die in den
Städten wohnen wollten, unterzubringen, wurde immer höher gebaut. Im
Jahr 1990 war das Park Row Building in New York mit 119 Metern das
höchste Wohngebäude, im Jahr 2000 war dieses – die Petronas Towers
in Kuala Lumpur – schon 375 Meter hoch. Die ersten Megastädte
entstanden noch als Folge der Industrieentwicklung, etwa im
Ruhrgebiet, dessen Einwohnerzahl 1939 4,5 Millionen Menschen betrug,
oder das durchgehend besiedelte Gebiet zwischen Tokio und Kobe in
Japan. Heute gibt es auf der Erde 27 Städte mit mehr als 10
Millionen Einwohnern. Diese Megastädte sind das extremste Beispiel
der weitgehend künstlichen Umwelt, die sich der Mensch mit der Stadt
geschaffen hat. Sie stellen eine besondere Konzentration des
Energie- und Ressourcenverbrauchs dar – so verbraucht etwa der Sears
Tower in Chicago mehr Strom als eine amerikanische Stadt mit 150.000
Einwohnern. Ohne eine aufwändige Infrastruktur – ohne U-Bahnen,
Aufzüge, Klimatisierung und künstliche Beleuchtung – wären
Megastädte kaum attraktiv.
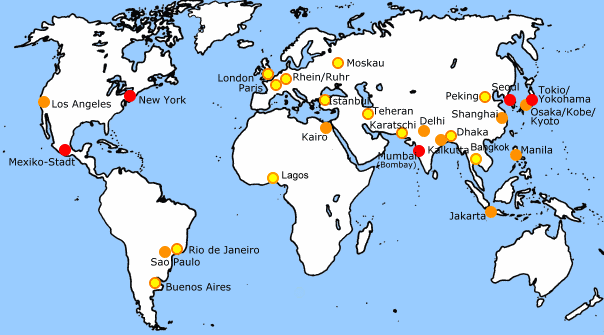
Siebenundzwanzig Ballungsgebiete
und Megacities der Erde haben mehr als 10 Millionen Einwohner. Rot
bedeutet: Hier leben über 20 Millionen Menschen, orange: über 15
Millionen Menschen, gelb-orange: über 10 Millionen Menschen. Eigene
Abbildung.
Ökologische Folgen
Und die Industrielle Revolution hatte ökologische Folgen: Die
städtische Luftverschmutzung erreichte nie zuvor gekannte
Dimensionen, der Ausbau der Landwirtschaft führte zu Ausweitung von
Acker- und Weideland auf Kosten der Wälder, belastete die Böden mit
Düngern und Pestizigen und zog riesige Bewässerungsprojekte nach
sich, verschmutztes Wasser brachte Cholera- und Typhusepidemien.
Diese Folgen werden umfassend auf den folgenden Seiten dargestellt:
Die Folgen der Industrialisierung für das Ökosystem Erde
>> Die
Bevölkerung der Erde
>> Rohstoffe
>> Böden
>>
Wassernutzung
>>
Wasserverschmutzung
>>
Luftverschmutzung
>> Klimawandel
>>
Gefährdung der Biodiversität
Weiter mit:
>>
Die Industrialisierung der Landwirtschaft
Zurück zur:
>>
Übersicht Das Zeitalter der Industrie